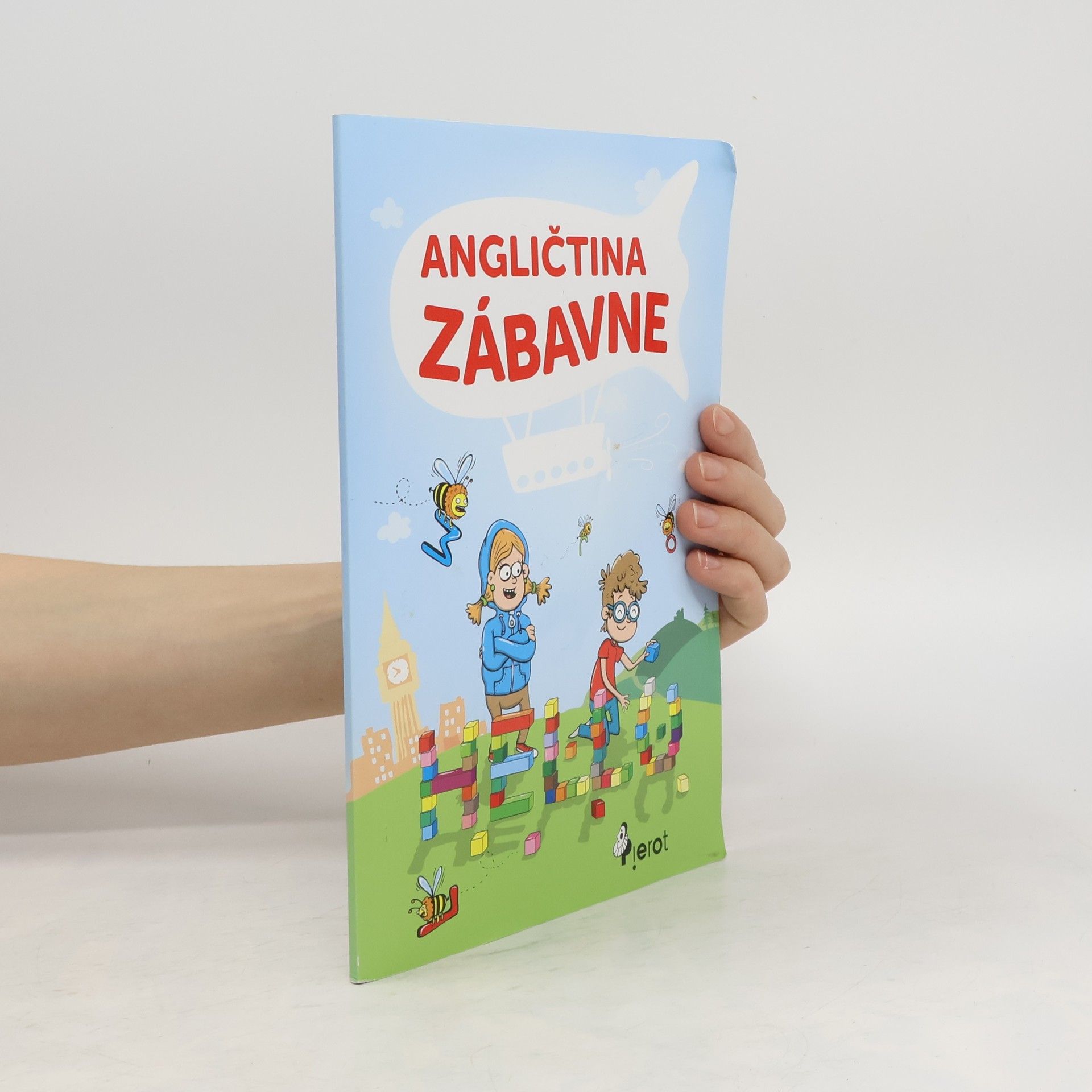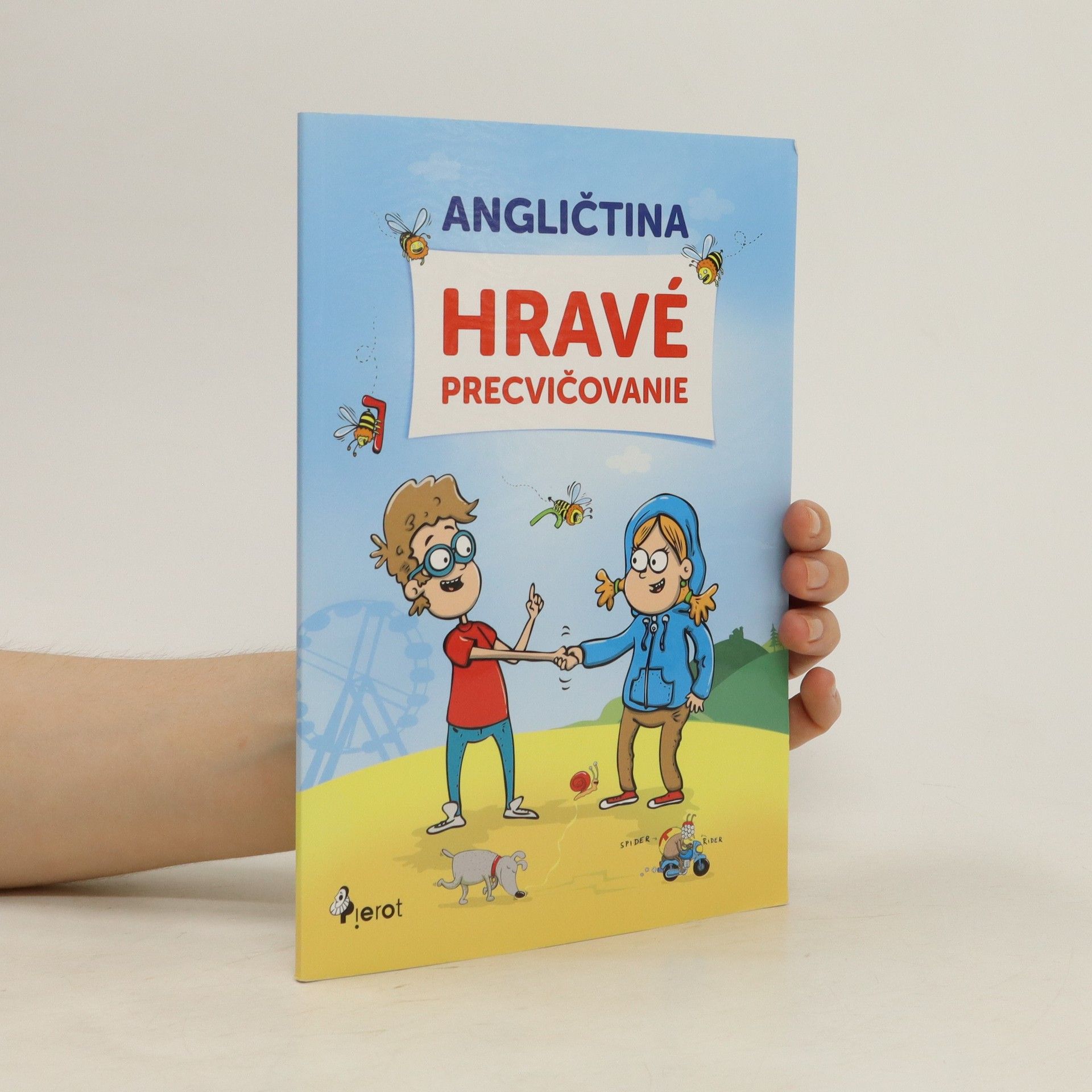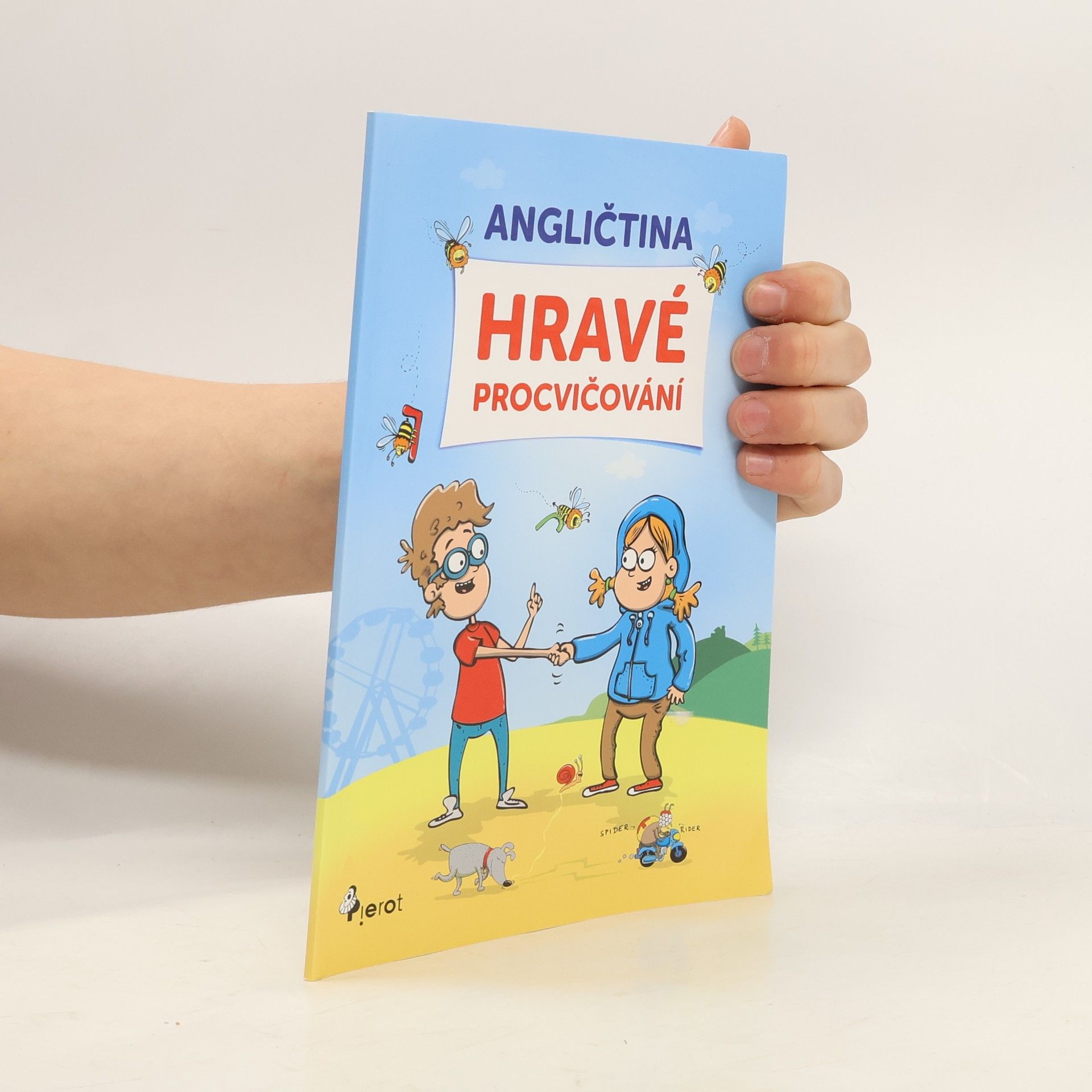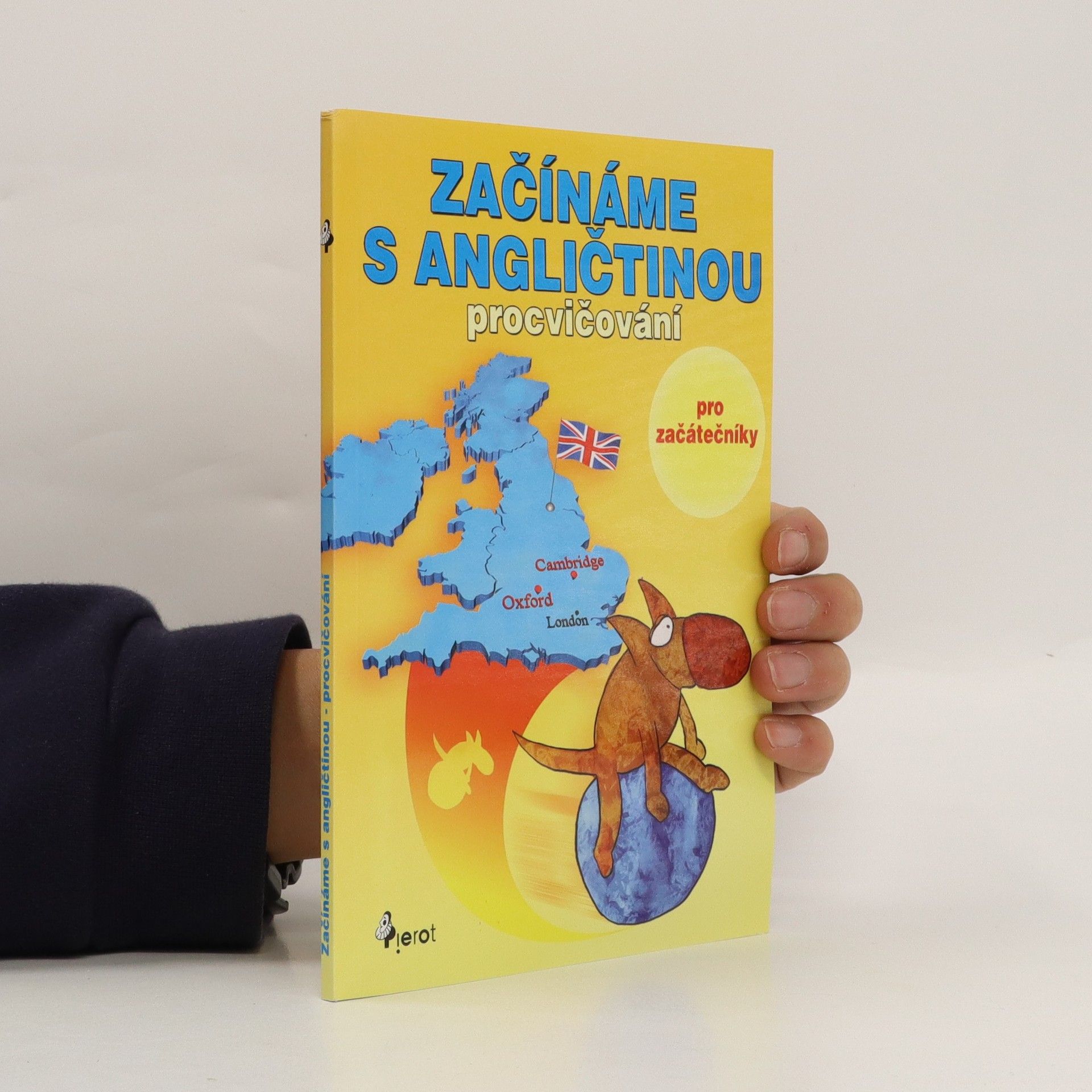Der Konservatismus befindet sich gegenwärtig in Deutschland in einer kulturellen Transformation. Wieder einmal wird die Werteperspektive dessen, was "konservativ" ist, angepasst an die gesellschaftlichen Veränderungen. Hierbei nimmt der Konservatismus pragmatisch eine Mittelposition zwischen Liberalismus und Sozialismus ein. Das zeigt sich in der aktuellen Konstellation sowohl in den nachhaltigen Wertepräferenzen als auch in den modifizierten Inhalten.
Peter Nitsche Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
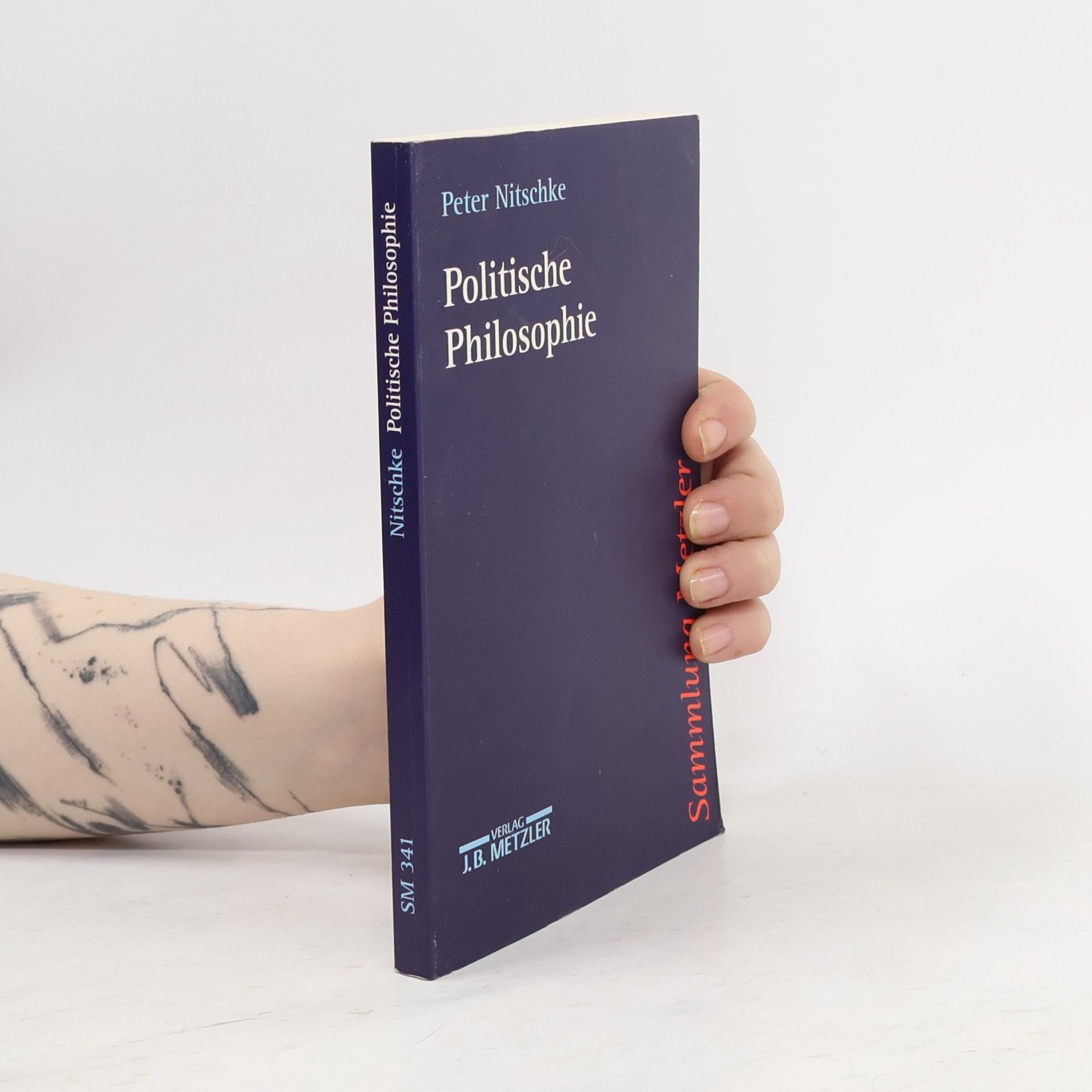
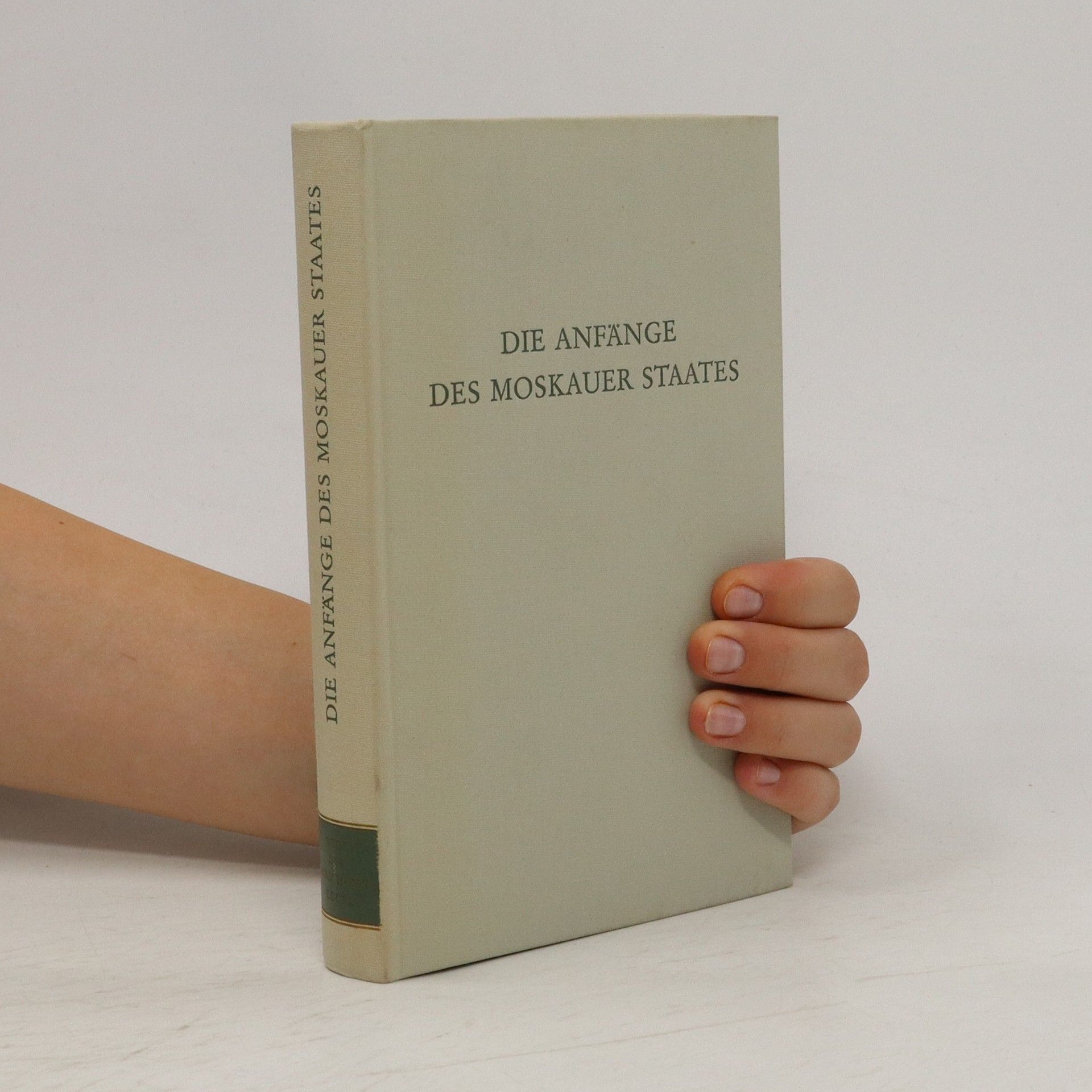




Die Analyse der Globalisierung beleuchtet die Widersprüche, die in zentralen Themen wie Armut und Reichtum, Digitalisierung, Kulturkämpfen sowie Migration und Demokratie auftreten. Diese Antinomien erzeugen eine dynamische und komplexe Realität, die auch Aspekte wie neue Kriege und Terrorismus umfasst. Der Autor bietet einen tiefen Einblick in die Herausforderungen und Spannungen, die die gegenwärtige Weltordnung prägen, und regt zur Reflexion über die Zukunft der globalen Gesellschaft an.
Peter Nitschke gibt in dieser Einführung einen generellen Überblick über die Themen der Politikwissenschaft, um das Bewusstsein für die Beschäftigung mit poltischen Fragestellungen zu schaffen. Am Beispiel von praktischen Anforderungen des modernen Alltags vermittelt er die Dimensionen und Probleme demokratischer Ordnung, die persönliche Verwicklung in politische Vorgänge aber auch analytische Vorgehensweisen.Neben den Grundprinzipien der Politikwissenschaft in Deutschland - von der Theorien- und Ideengeschichte über das politische System bis hin zu den internationalen Beziehungen - werden auch Grundfragen von Globalisierung, Europäischer Integration und Klimapolitik interdisziplinär behandelt. Mit der zweiten Auflage liegt dieses übersichtliche Einführungsbuch nun wieder in einigen zentralen Aspekten aktualisiert und überarbeitet vor.
Publikácia slúži na hravé precvičovanie angličtiny pre jazykovú úroveň A1 – A2. Prostredníctvom krížoviek, rébusov a doplňovačiek si deti zopakujú základnú slovnú zásobu i základnú gramatiku. Autorom publikácie je skúsený anglický profesor Peter Nitsche. Zábavné poňatie knihy skvele dotvárajú vtipné ilustrácie Libora Drobného.
Publikácia slúži na hravé precvičenie základnej slovnej zásoby a gramatiky angličtiny. Spracoval ju skúsený anglický profesor Peter Nitsche, ktorý je tiež vynikajúcim prekladateľom a tlmočníkom. Kniha ponúka v praxi osvedčené postupy, ako žiakov zoznámiť s aktuálnou slovnou zásobou a jednoduchou gramatikou. Svieže a vtipné ilustrácie Libora Drobného výborne dotvárajú zábavné poňatie knihy.
Domácí procvičování pro začátečníky : angličtina
- 96 Seiten
- 4 Lesestunden
Tato publikace dětem usnadní první kroky při práci s jazykem. Pomocí křížovek a doplňovaček si děti hravou formou procvičí základní slovní zásobu a gramatiku. Kniha je perfektní pomůckou pro domácí procvičování anglického jazyka. Součástí publikace je samozřejmě klíč se správnými výsledky jednotlivých cvičení.
Začínáme s angličtinou: procvičování pro začátečníky
- 95 Seiten
- 4 Lesestunden
Tato publikace usnadňuje první kroky při práci s jazykem. Studenti pomocí křížovek a doplňovaček procvičí základní slovní zásobu i gramatiku, proto se tato publikace stala oblíbeným doplňkem při výuce angličtiny.