Im Spätsommer 1943, als die militärische Niederlage Deutschlands längst absehbar war, gründete die SS das KZ-Außenlager Dora bei Nordhausen in Thüringen. Seine Insen mussten Zwangsarbeit bei der Verlagerung der Raketenrüstung von Peenemünde in das unterirdische Mittelwerk leisten.Im Herbst 1944 wurde Dora mit benachbarten Außenlagern zum KZ Mittelbau zusammengeft, dessen 40 Einzellager sich bei Kriegsende über den gesamten Harz erstreckten. Die Mehrzahl der Häftlinge musste in mörderischer Zwangsarbeit Stollenanlagen für unterirdische Flugzeugfabriken bauen. Bis April 1945 verschleppte die SS mehr als 60.000 Menschen aus allen Teilen Europas in das KZ Mittelbau. Mindestens 20.000 von ihnen starben.Der Band dokumentiert die ständige Ausstellung zur Lagergeschichte in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Er verortet Mittelbau-Dora im Kontext des Totalen Krieges und gibt Auskunft nichtnur über die Häftlinge, sondern auch über Täter, Profiteure und Zuschauer im Umfeld der Lager.
Jens-Christian Wagner Bücher

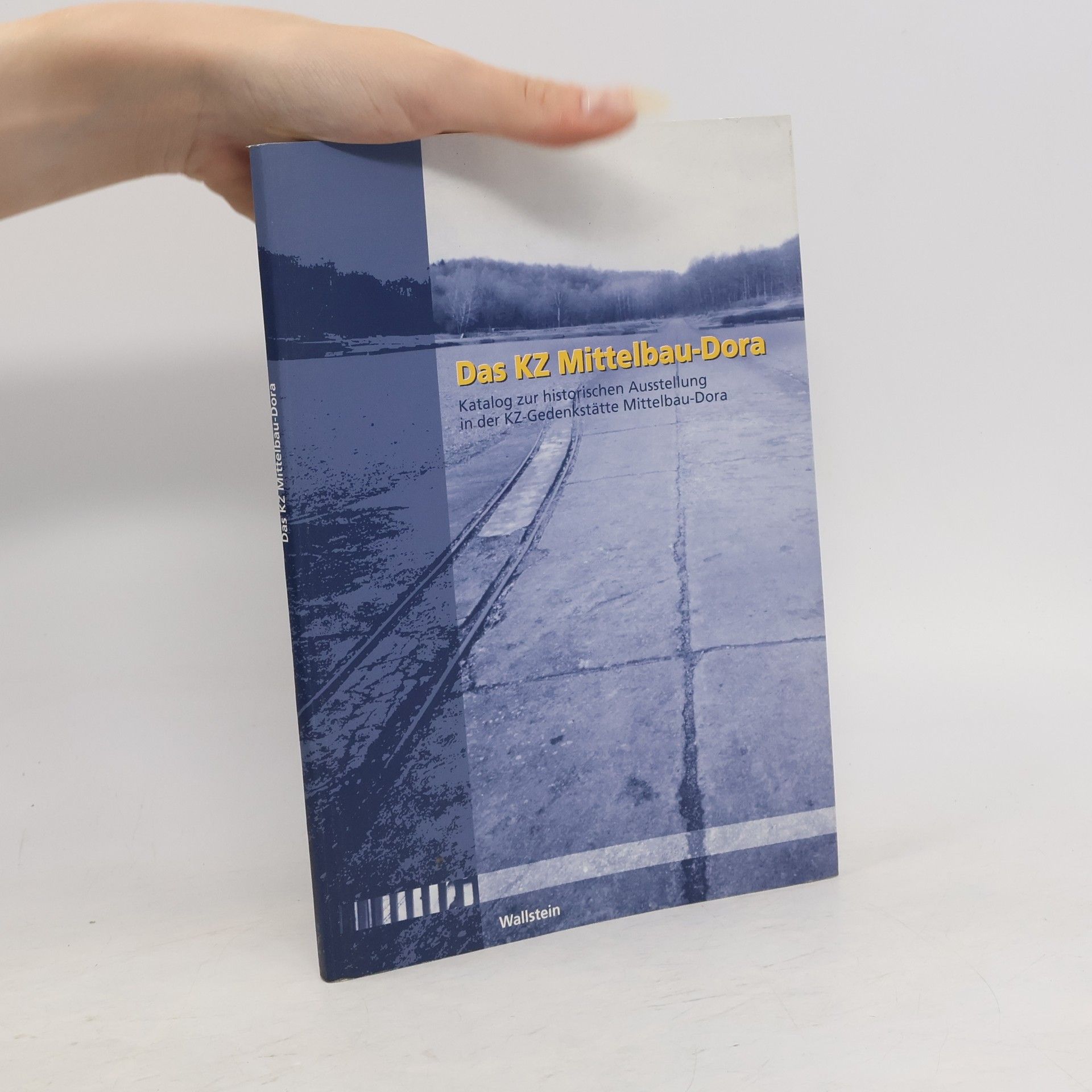



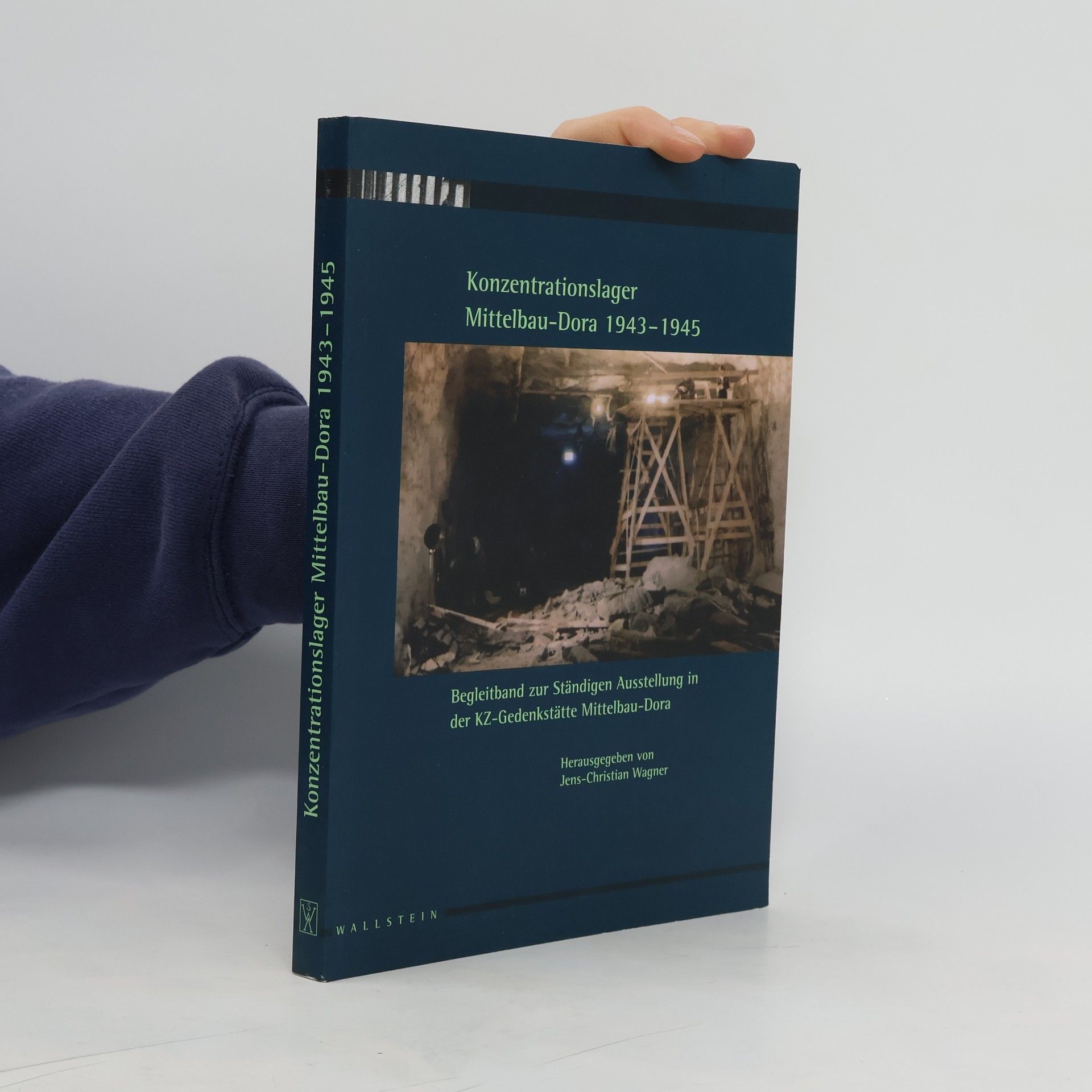
Aufrüstung, Krieg und Verbrechen
Die Wehrmacht und die Kaserne Bergen-Hohne. Begleitband zur Ausstellung
"Der Truppenübungsplatz und die Kaserne Bergen-Hohne wurden 1935 im Rahmen der Aufrüstungs- und Kriegspolitik des NS-Regimes eingerichtet. Hier übte die Wehrmacht den Angriffskrieg, dem ab 1939 Millionen Menschen zum Opfer fielen - darunter Zehntausende Kriegsgefangene, die in Lagern am Truppenübungsplatz untergebracht waren, und mehr als 52.000 Häftlinge des KZ Bergen-Belsen. Der Geschichte des historischen Ortes wie auch der Geschichte der Wehrmacht und ihrer Verbrechen widmet sich die 2019 eröffnete Ausstellung in einem Originalgebäude in der heutigen Niedersachsen-Kaserne. Die Ausstellung verdeutlicht, dass Krieg und Verbrechen von Beginn der NS-Herrschaft an geplant waren. Anschaulich stellt sie dar, dass die Wehrmacht zu den tragenden Säulen der NS-Diktatur gehörte. Zudem wendet sie sich den Fragen zu, welche Handlungsspielräume Soldaten hatten und wie die deutsche Gesellschaft und die Bundeswehr nach 1945 mit dem schwierigen Erbe der Wehrmacht umgingen. Der Band dokumentiert die Ausstellung in ihren wesentlichen Zügen. Wissenschaftliche Essays bieten zusätzlich vertiefende Informationen." (Verlagsinformation)
Zwischen Verfolgung und »Volksgemeinschaft«
Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus
Wissenschaftliche Beiträge zur Integration, Ausgrenzung und Verfolgung von Kindern und Jugendlichen im Nationalsozialismus. - Im Leben von Kindern und Jugendlichen im Nationalsozialismus spiegelte sich die Gesellschaftsordnung, die radikal rassistisch organisiert war und sich durch das Wechselverhältnis zwischen Integration und Exklusion auszeichnete: Für den Nachwuchs der propagierten >>Volksgemeinschaft<< gab es Integrationsangebote - die Kinder derer, die nicht dazugehörten, vor allem Juden sowie Sinti und Roma, wurden ausgegrenzt, verfolgt und am Ende ermordet. In diesem ersten Heft der >>Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung<< wird untersucht, wie Ausgrenzung und Verfolgung, Praktiken der Vergemeinschaftung und individuelle Handlungsweisen das Leben von Kindern und Jugendlichen im Nationalsozialismus geprägt haben. Wie wirkten sich Integration und Repression in Schule und Hitlerjugend aus? Welche Kinder und Jugendlichen wurden mit welchen Mitteln verfolgt? Wie sahen die Überlebensbedingungen verfolgter Minderjähriger in Lagern und anderen Haftstätten aus, etwa im KZ Bergen-Belsen? Welche Spezifika, auch erfahrungsgeschichtlich, hatte die Verfolgung von Kindern und Jugendlichen gegenüber der von Erwachsenen?
Das KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen in Nordthüringen war das letzte von den Nationalsozialisten gegründete KZ-Hauptlager. Seine Geschichte ist untrennbar verbunden mit dem von Joseph Goebbels im Februar 1943 nach der deutschen Niederlage von Stalingrad ausgerufenen „Totalen Krieg“. Mittelbau-Dora wurde gegründet, als die Kriegsniederlage Deutschlands längst absehbar war. Viele Deutsche wollten die Niederlage jedoch nicht wahrhaben. Sie glaubten der NS-Propaganda, die den „Endsieg“ durch den Einsatz von „Wunderwaffen“ versprach, die in vor Luftangriffen sicheren Untertagefabriken hergestellt werden sollten.
Produktion des Todes
- 688 Seiten
- 25 Lesestunden
Law. Crime. Consequences
Wolfenbüttel Prison under National Socialism