Die Analyse des Lebensstandards im 19. Jahrhundert zeigt dessen enge Verknüpfung mit gesellschaftlichen Normen und ökonomischen Überzeugungen. Bernhard Kleeberg beleuchtet, wie verschiedene Wissensformationen und der Glaube an die Absicherung sozialer Risiken die Diskurse und Praktiken der Standardisierung in Deutschland und Großbritannien prägten. Besonders hervorgehoben werden die selbstregulativen Mechanismen der Gewohnheitsbildung, die als Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Wissensfeldern fungieren. Diese Untersuchung bietet einen tiefen Einblick in die Entwicklung sozialwissenschaftlicher Standards und deren gesellschaftliche Implikationen.
Bernhard Kleeberg Bücher
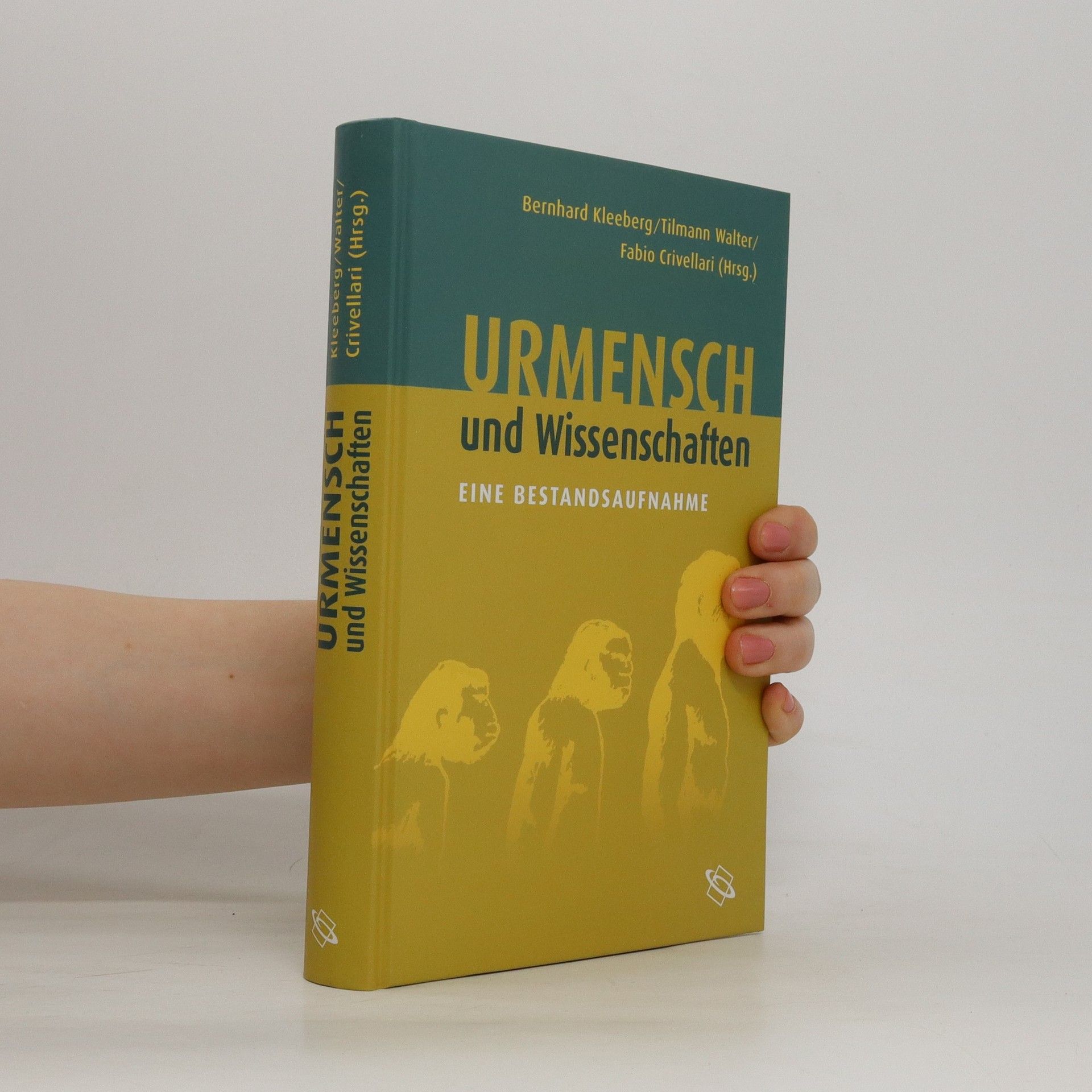
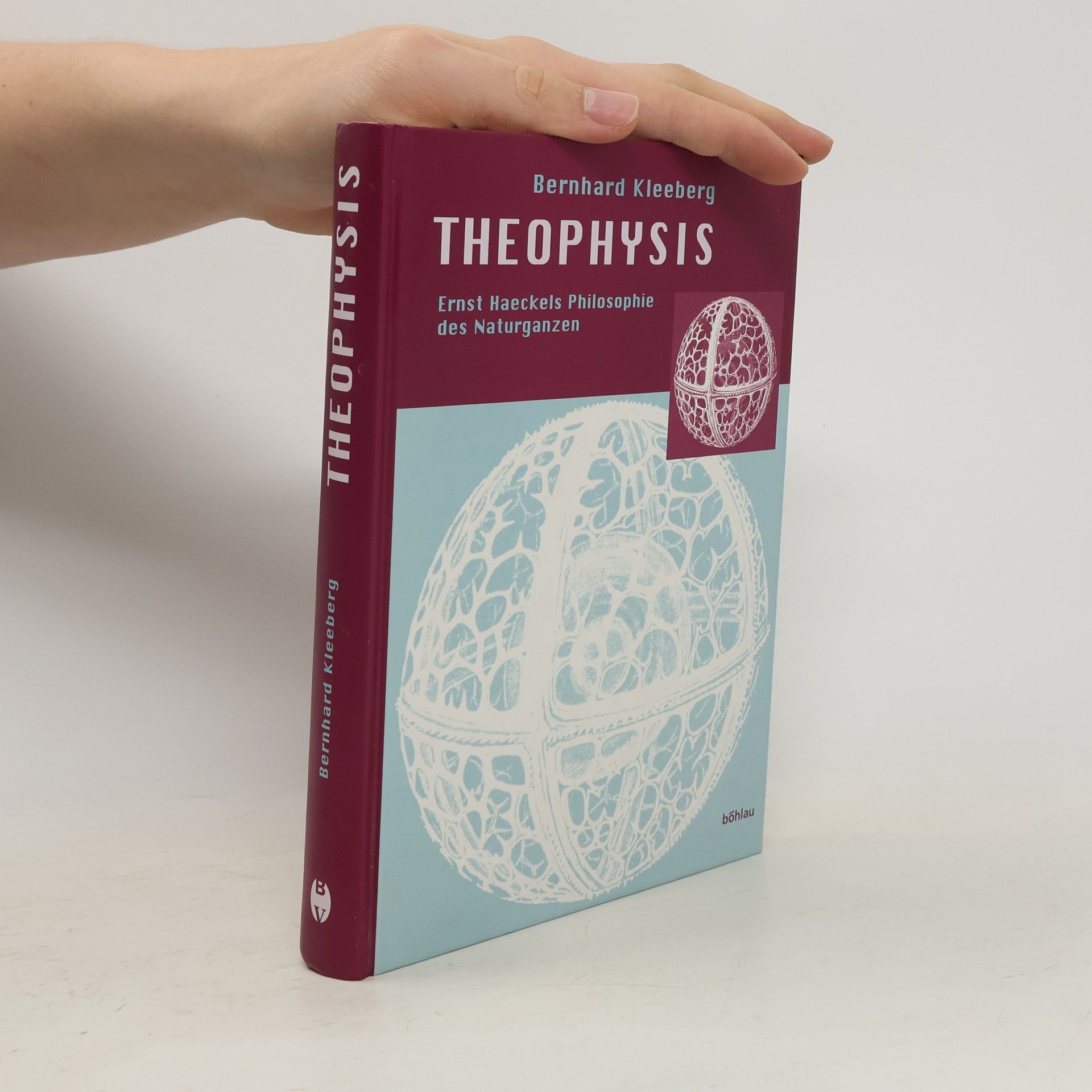

Theophysis
- 324 Seiten
- 12 Lesestunden
In den 1860er Jahren entwarf der Zoologe Ernst Haeckel die wissenschaftliche Weltanschauung des Monismus, die er in einer Vielzahl populärwissenschaftlicher Schriften mit großem Erfolg verbreitete. Auf der Grundlage der Darwinschen Theorie rief er die Biologie zur neuen Leitwissenschaft aus und postulierte die Einheit von Natur und Kultur. Seither galt Haeckel vielen als der deutsche Darwin, der die Gottesebenbildlichkeit des Menschen sowie die Schöpfungstheologie zu Grabe getragen und so dem modernen Weltbild zum Durchbruch verholfen habe. Infolgedessen wurden die naturtheologischen und pantheistischen Züge des Monismus lange Zeit vernachlässigt. Demgegenüber formuliert Bernhard Kleeberg die These, dass gerade diese nicht-darwinistischen Elemente das monistische Denken nachdrücklich bestimmt haben. Anhand der wesentlichen Schriften Haeckels sowie an Auszügen aus seiner Korrespondenz rekonstruiert der Autor Genese und Kernaussagen des Monismus. Es wird deutlich, dass auch Haeckels Naturphilosophie letztlich im Banne romantischer und naturtheologischer Deutungsmuster steht.
Urmensch und Wissenschaften
- 350 Seiten
- 13 Lesestunden
Wie lassen sich die ersten Anfänge wissenschaftlichen Denkens und Handelns in der Urkultur beschreiben, analysieren und in geschichtliche Modelle einordnen? Was kann die Genetik zur Feststellung der Verwandtschaft zwischen Affen und Menschen beitragen? Wie sieht der aktuelle Stammbaum des Menschen aus? Welchen Phantasien unterlag der Urmensch in Wissenschaft, Literatur und Kunst im Lauf der Geschichte? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Urgesellschaften und modernen Gesellschaften? Forscher, vor allem geisteswissenschaftlicher Disziplinen unternehmen hier den Versuch, ein vielfältiges Bild prähistorischer Kultur und unserer Bilder von ihr zu entwickeln.