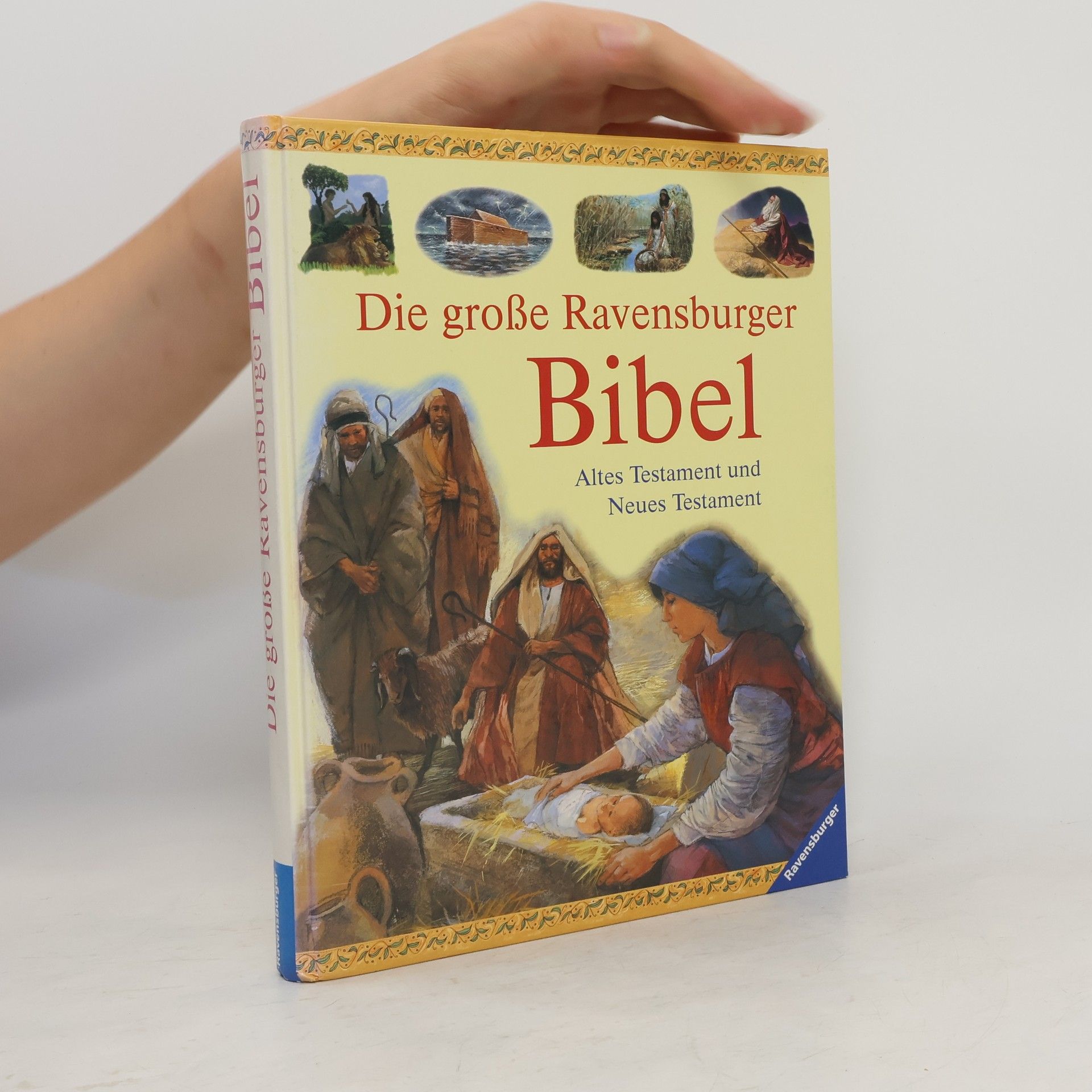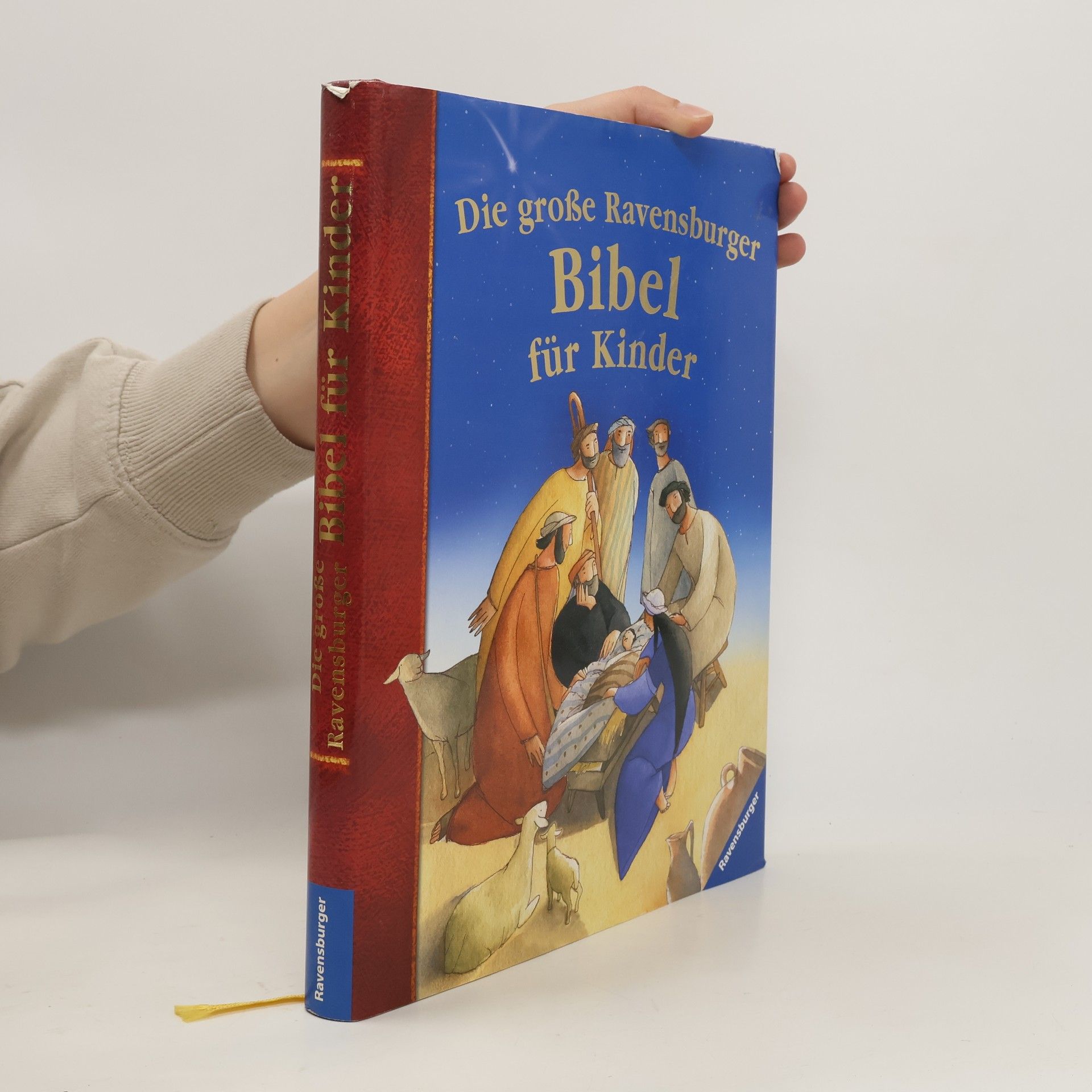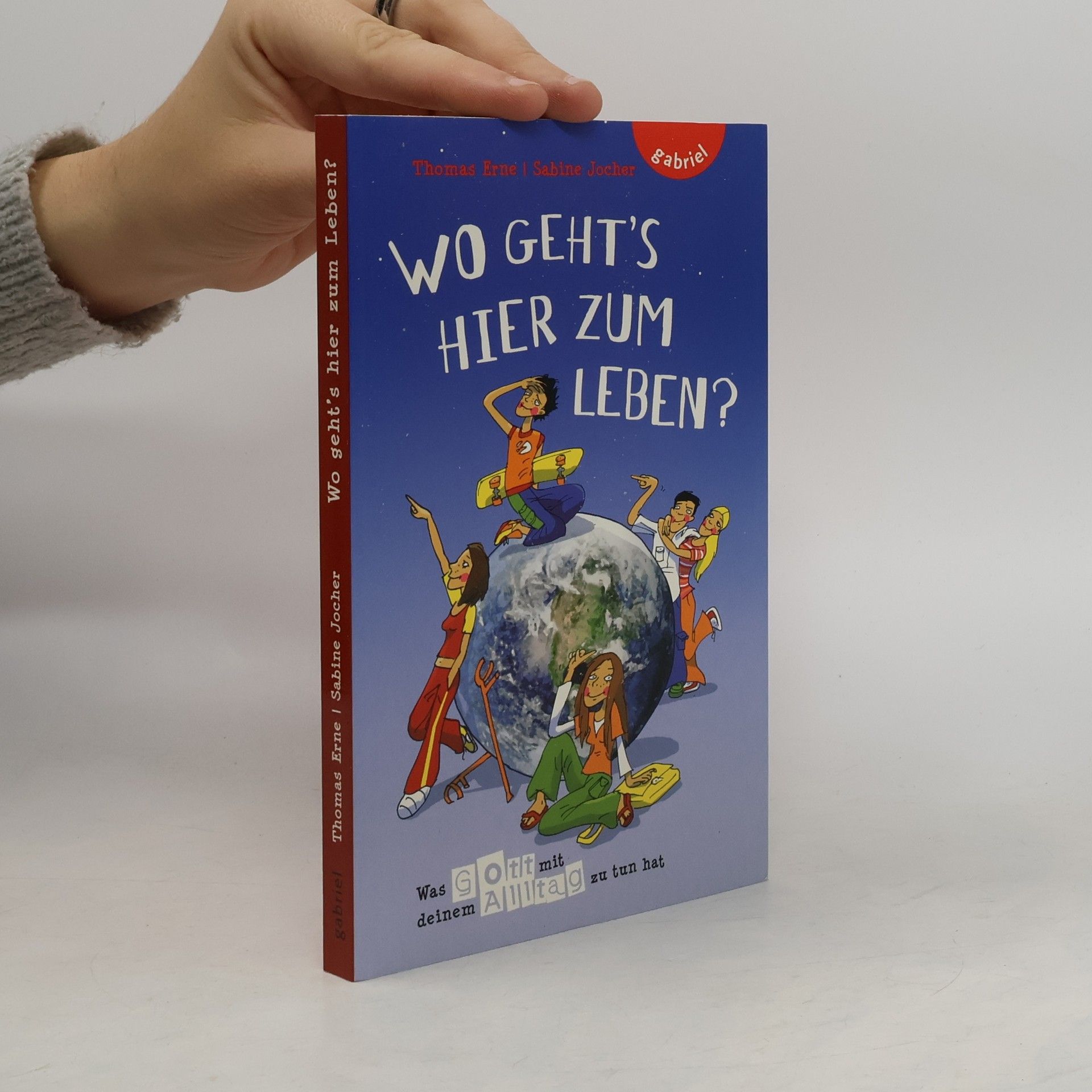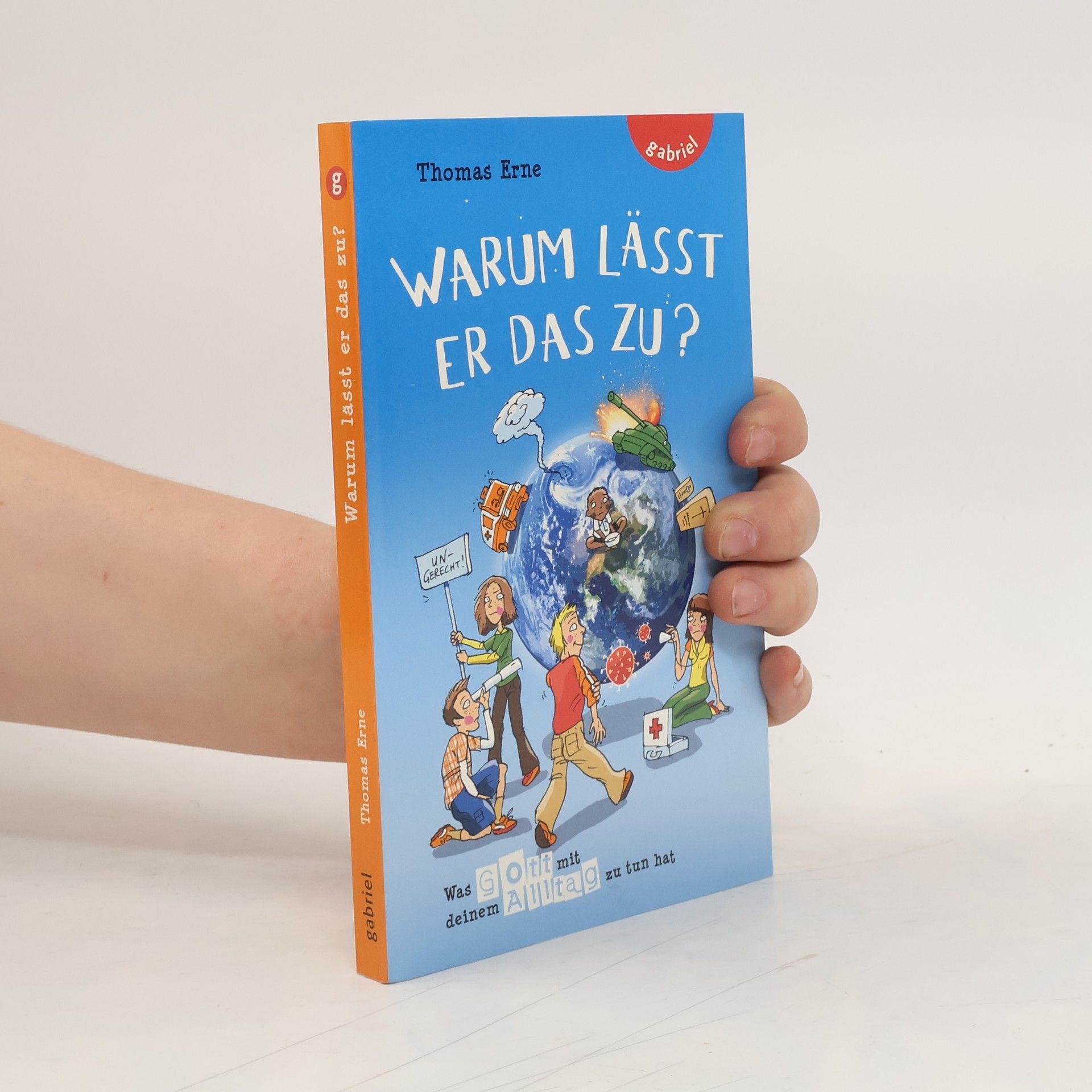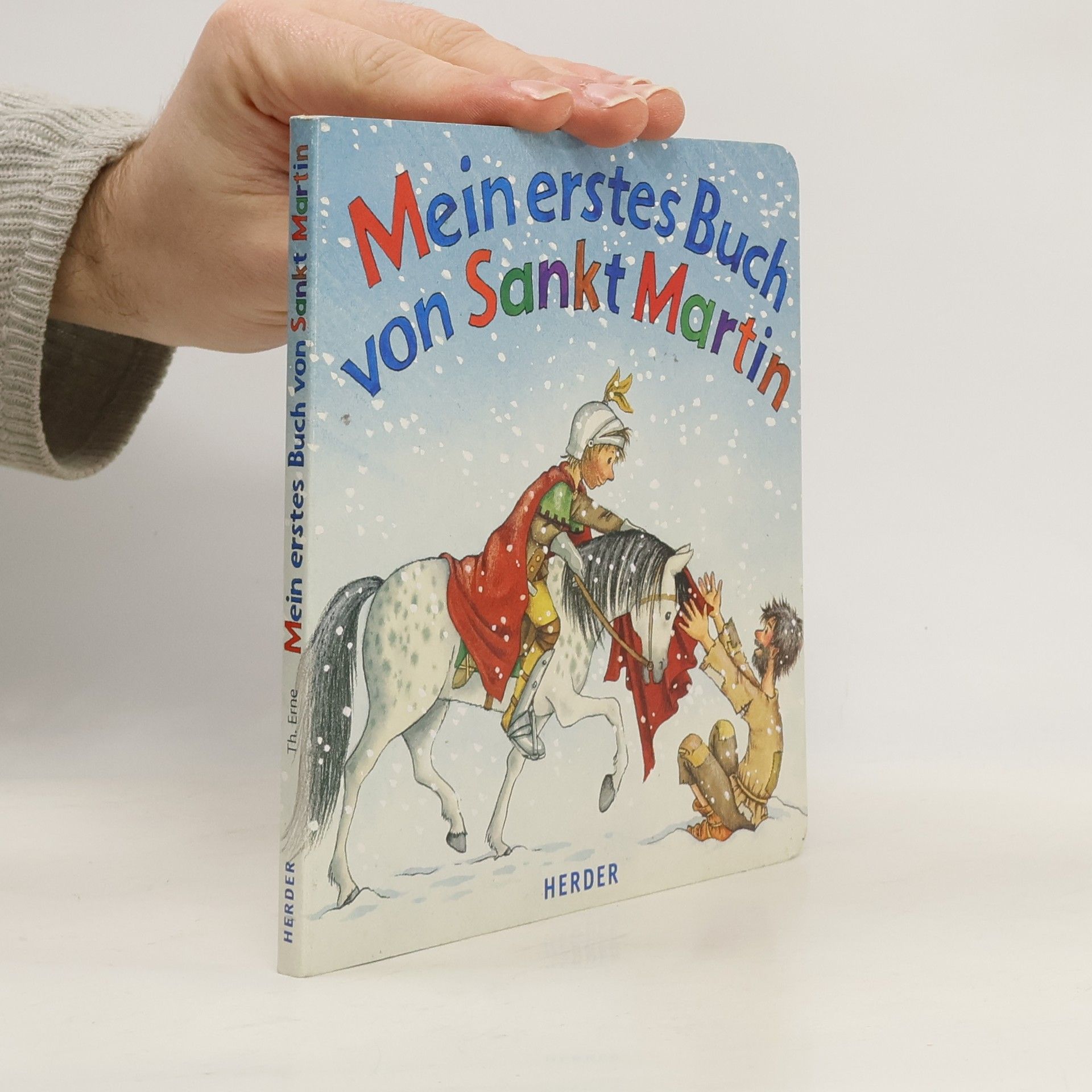Transzendenz im Plural
Schleiermacher und die Kunst der Moderne
Thomas Erne entfaltet im Anschluss an Schleiermachers Ästhetik das Verhältnis von Kunst und Religion. Dabei nimmt er über Schleiermacher hinaus auch die moderne, autonome Kunst in Blick. Im Dialog mit exemplarischen Kunstwerken der Gegenwart fragt er nach Transzendenzerfahrungen in der Gegenwartskunst, in der die Kunstwerke selbst zu "autonomen Sinndomänen" werden. Der Band dokumentiert die Schleiermacher-Lecture 2019 an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Rahmen dieser Reihe sollen ausgewählte Aspekte von Schleiermachers Werk mit Fragen und Problemkonstellationen der Gegenwart in Beziehung gesetzt werden.