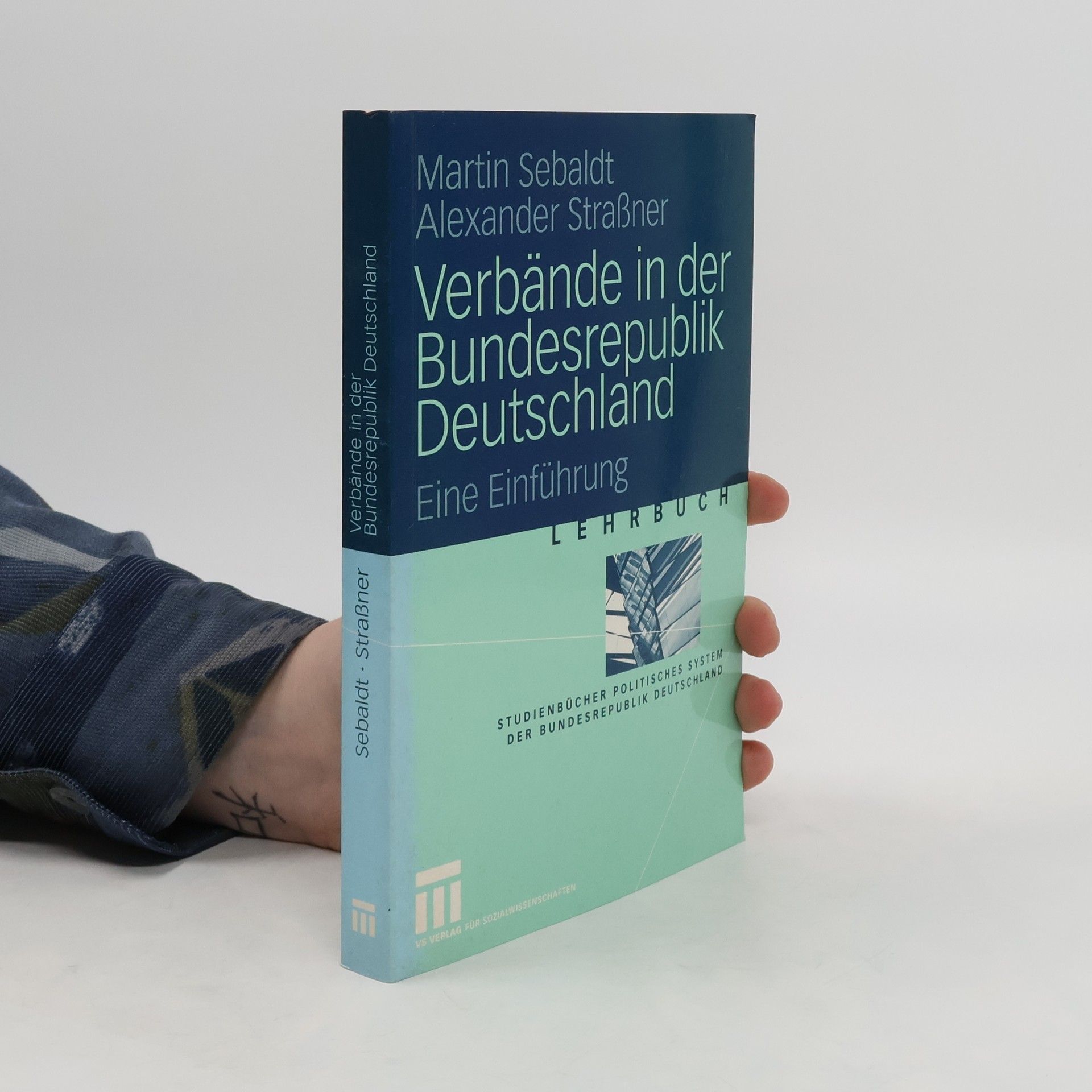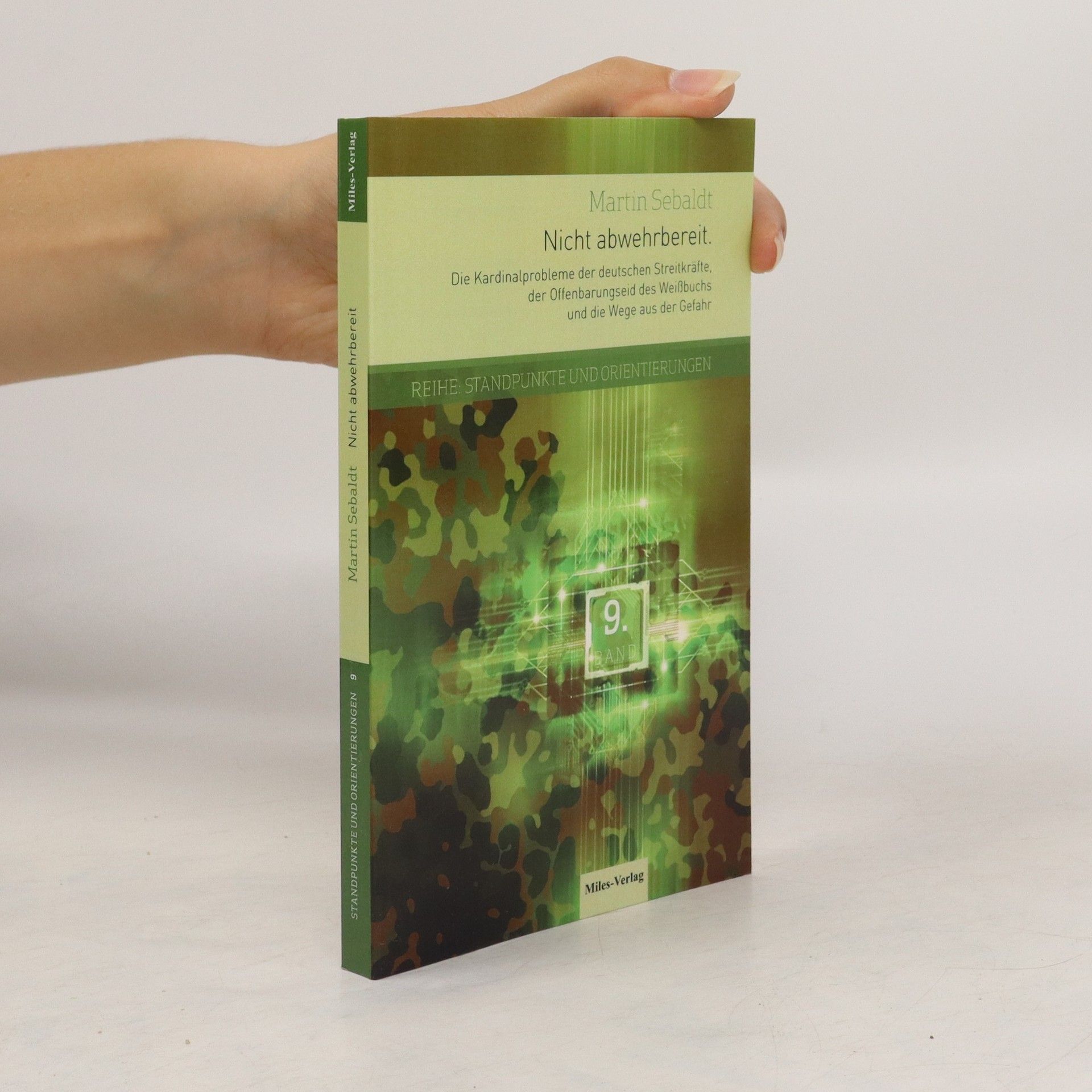Nicht abwehrbereit.
Die Kardinalprobleme der deutschen Streitkräfte, der Offenbarungseid des Weißbuchs und die Wege aus der Gefahr
- 156 Seiten
- 6 Lesestunden
Deutschland ist nicht abwehrbereit. Die Bundeswehr kann den Auftrag des Grundgesetzes zur Verteidigung unseres Landes nicht erfüllen, und sie wird auch den Ansprüchen unserer westlichen Bündnispartner nicht mehr gerecht. Vorbei die Zeiten, als man sich noch über die nur „bedingte“ Abwehrbereitschaft bundesdeutscher Streitkräfte Sorgen machen musste. Die bedrückende Gesamtdiagnose des Politikwissenschaftlers und Reserveoffiziers Martin Sebaldt lautet, dass die Bundeswehr aufgrund fehlender Aufwuchspotentiale, einer nicht nachhaltigen Personallage, ihrer zunehmenden Distanz von der Gesellschaft, einer immer bedrohlicher werdenden Ausstattungsmisere, zunehmend veraltender Organisationsstrukturen und nicht zuletzt wegen strategisch-konzeptioneller Blindstellen ihrem derzeitigen Aufgabenportfolio nicht gerecht werden kann. Für eine umfassende Reform unserer Streitkräfte, die diesen Namen auch verdient, ist es höchste Zeit.