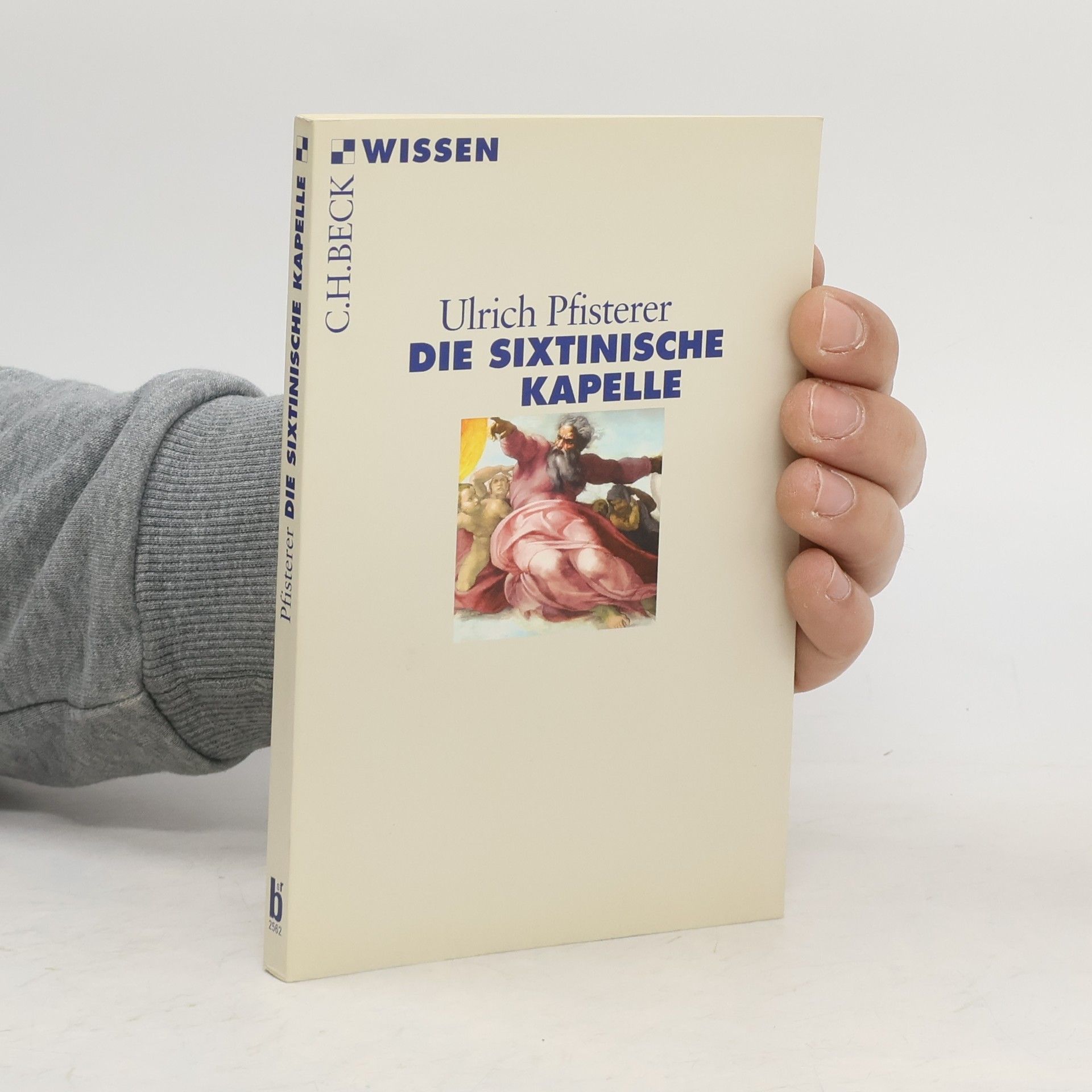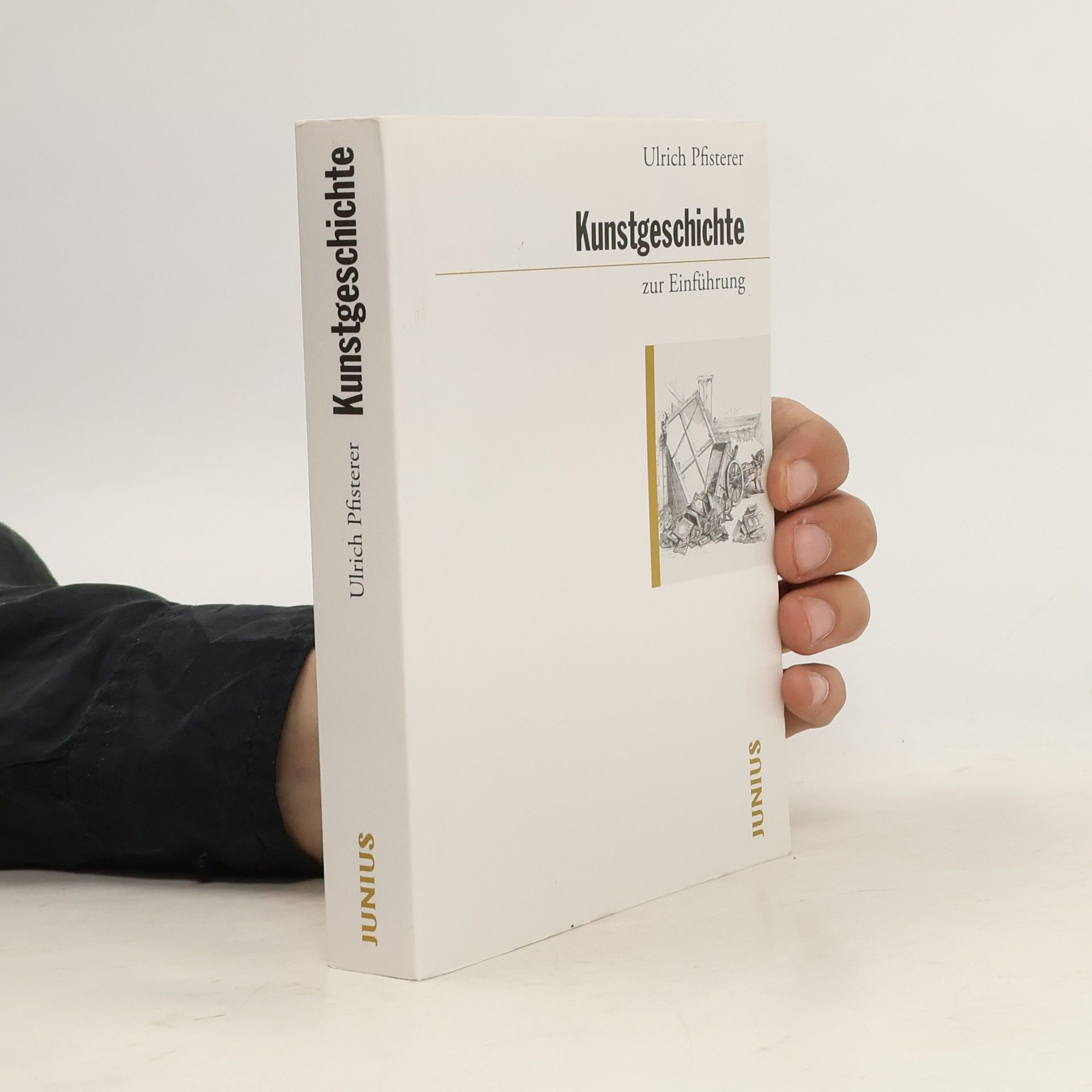Studieren bei Warburg und Panofsky
Ludwig Heinrich Heydenreich und die Kunstgeschichte in Hamburg 1925-1928
- 272 Seiten
- 10 Lesestunden
Ausgehend von Archivmaterial aus der Studienzeit Ludwig Heinrich Heydenreichs richtet diese Publikation den Blick auf historische Unterrichtsformen im Fach Kunstgeschichte sowie auf die engen Verflechtungen von kunsthistorischer Lehre und Forschung. Heydenreichs Aufzeichnungen machen den Gang eines Hamburger Studenten von der Immatrikulation bis zur Promotion in allen Details nachvollziehbar. Gleichzeitig erlauben sie Einblicke in die Abläufe am Kunsthistorischen Seminar Hamburg sowie an der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Der Band enthält Mitschriften der Gotik Vorlesungen Erwin Panofskys (1925/26) ebenso wie detaillierte Aufzeichnungen der Methoden-Übungen Aby Warburgs inkl. aller Referate und auch Bildtafeln, die die Studierenden für ihre Vorträge zu arrangieren hatten.