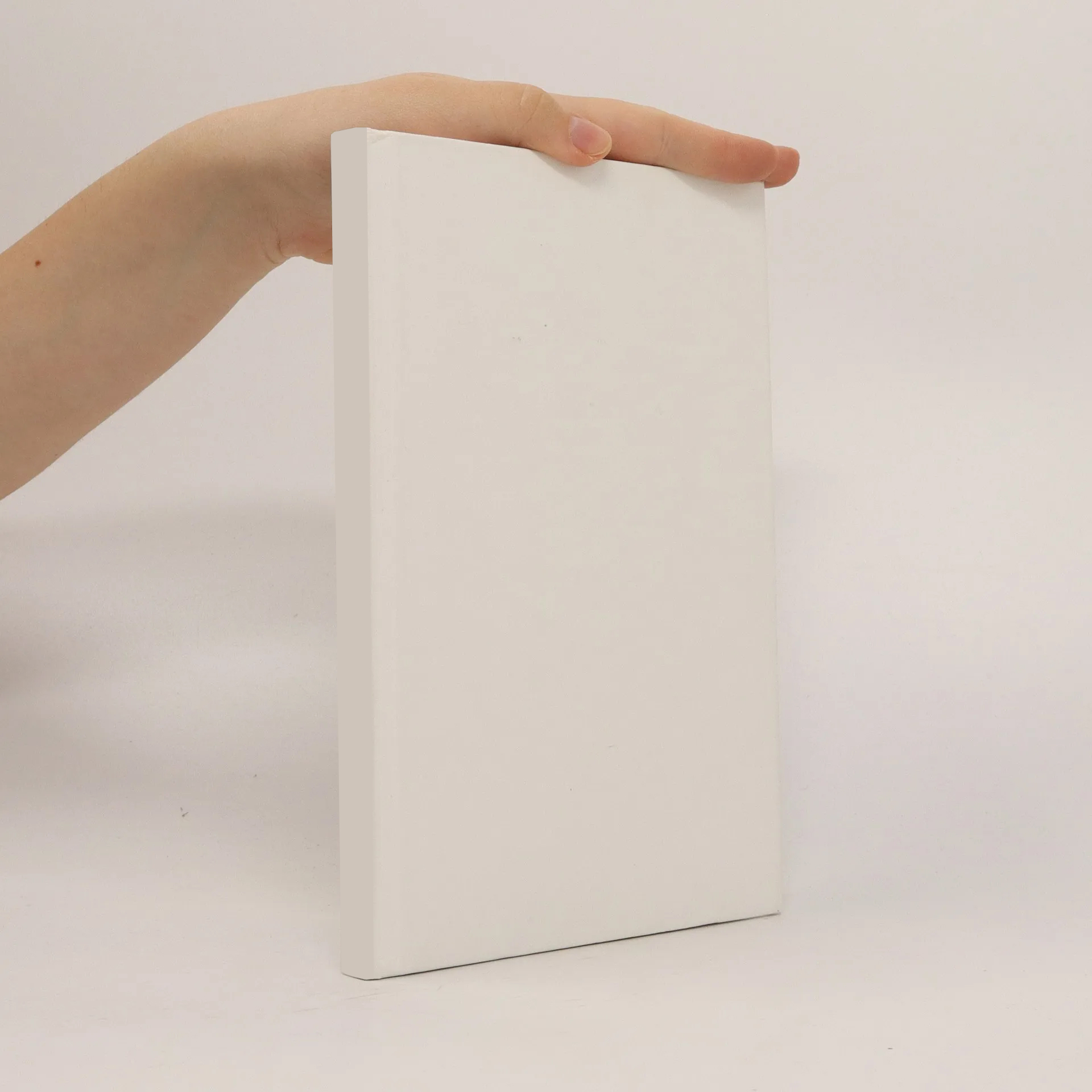
Parameter
Mehr zum Buch
Der Zweite Weltkrieg hat einen großen Graben zwischen den am Krieg beteiligten Vätern und ihren Söhnen gezogen. Ungefähr ein Viertel aller deutschen Kinder wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Vater auf. In der Mehrzahl der Fälle war er gefallen oder vermisst. Diejenigen, die aus dem Krieg zurückkamen, waren meist durch die Kriegserfahrungen psychisch erkrankt, wohingegen ihre Frauen gelernt hatten, das Leben auch ohne sie zu bewältigen. Die tradierte männliche Autorität konnte nicht mehr aufrechterhalten werden. In der Psychologie wird von „Parentifizierung“ der Söhne gesprochen, die aufgrund der Abwesenheit des Vaters dessen Rolle übernehmen. Dass dadurch eine „Identitätskrise von Männlichkeit“ entstand, wie sie in psychoanalytischen Schriften immer wieder erwähnt wird, kann auf den fehlenden Vater zurückgeführt werden. Überlagert wird dies durch die vom Industrialisierungsprozess „sozial bedingte Schwäche“ des Vaters. Ein Millionenheer von Angestellten brachte einen neuen Vatertypus hervor, mit dem sich die Söhne nicht mehr identifizieren konnten. Der Sohn nahm zwar die gewaltsame Autorität stets als die stärkere wahr, durchschaute aber deren Launen als Ausdruck der Schwäche und hielt deshalb Ausschau nach einem höheren, machtvolleren Vater, einem Übervater. Die Phase des Faschismus kann folglich als eine Hochblüte der Entfaltung von Ersatzvaterschaft im Führerprinzip gesehen werden. Der leer gewordene Platz des Vaters diente dabei als Entstehungsort des verhängnisvollen Ersatzes. Die Söhne von Vätern, die in der Zeit des Nationalsozialismus aufwuchsen, mussten daher nach dem Krieg nicht nur mit einer unbrauchbar gewordenen Vaterfigur umgehen, sondern auch mit einer problematisch gewordenen Ersatzvaterschaft. Autorität war nunmehr negativ konnotiert. Bei der 68er Generation in der BRD wurden fehlende Anlehnungsmodelle in Form der Revolte deutlich. Sie entwickelten Gegenmodelle wie die antiautoritäre Erziehung, setzten auf Brüderlichkeit und neue Moralvorstellungen. Die Sehnsucht, die Lücke des Vaters zu füllen, bestand jedoch weiterhin und war nicht zu ersetzen, so lautet die Grundthese dieser Arbeit. Anhand des in Vergessenheit geratenen Romans Die Messe von Günter Herburger wird das Vater und Sohn Verhältnis untersucht, das ein aufschlussreiches künstlerisches Dokument zum Umgang der 68er Söhne mit ihren Vätern darstellt. Wie die Vaterattacken des Expressionismus konnten sich auch die Romane und Erzählungen der 60er und 70er Jahre, die sich mit Vätern im Nationalsozialismus befassten, nie der vereinfachenden Problematik entziehen, dass statt der Alten die Jungen als Ankläger auftraten. Die neue Autorität stellte zuletzt doch nur die Reproduktion der verworfenen Vatermacht dar. Statt Brüderlichkeit wurde das Gesetz des Vaters durch das Gesetz des Sohnes ersetzt, die Pole der Autorität umgedreht. In Herburgers Roman Die Messe übernimmt die Autorität nicht der Sohn, er träumt sich keine bessere Welt, vielmehr geht es ihm darum, in der Welt, in der er lebt, zurecht zukommen. Peter von Matt beschreibt die moralische Überlegenheit der Jüngeren gegenüber den Älteren als „Idèe fixe“, die sich durch die Literatur des 20. Jahrhunderts zieht. Wenn die Sehnsucht, die Lücke des Vaters zu füllen, weiter fortbestand, so stellt sich die Frage, wie mit dieser Sehnsucht umgegangen werden konnte. Wie gestaltet sich die fehlende Vorbildfunktion des Vaters und auf welche Weise tragen Vaterdefizite zu den Individuationsbestrebungen der Söhne bei? Gregor Eppinger geht diesen fragen nach.
Buchkauf
Stumme Väter, stammelnde Söhne, Gregor Eppinger
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2008
Lieferung
Zahlungsmethoden
Keiner hat bisher bewertet.