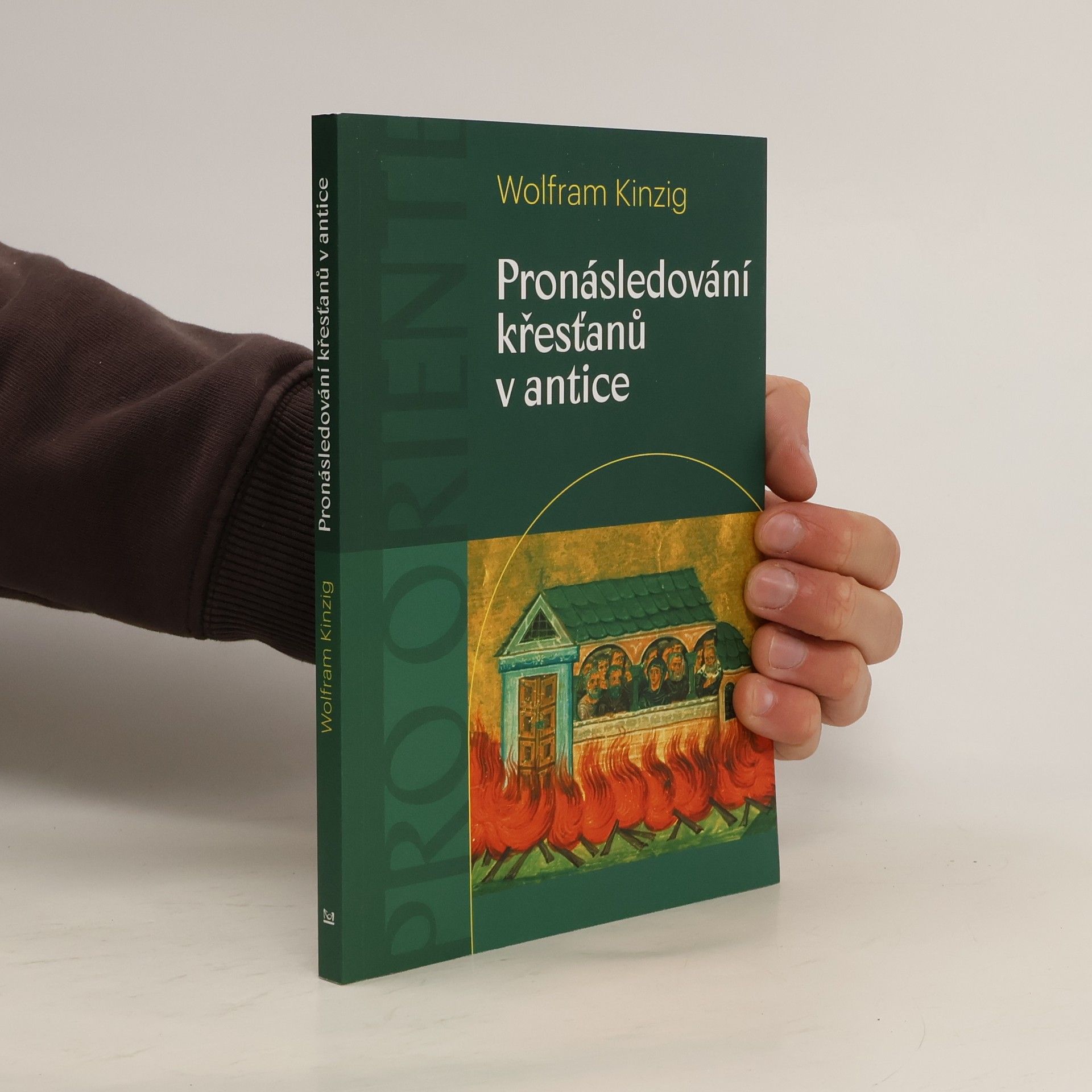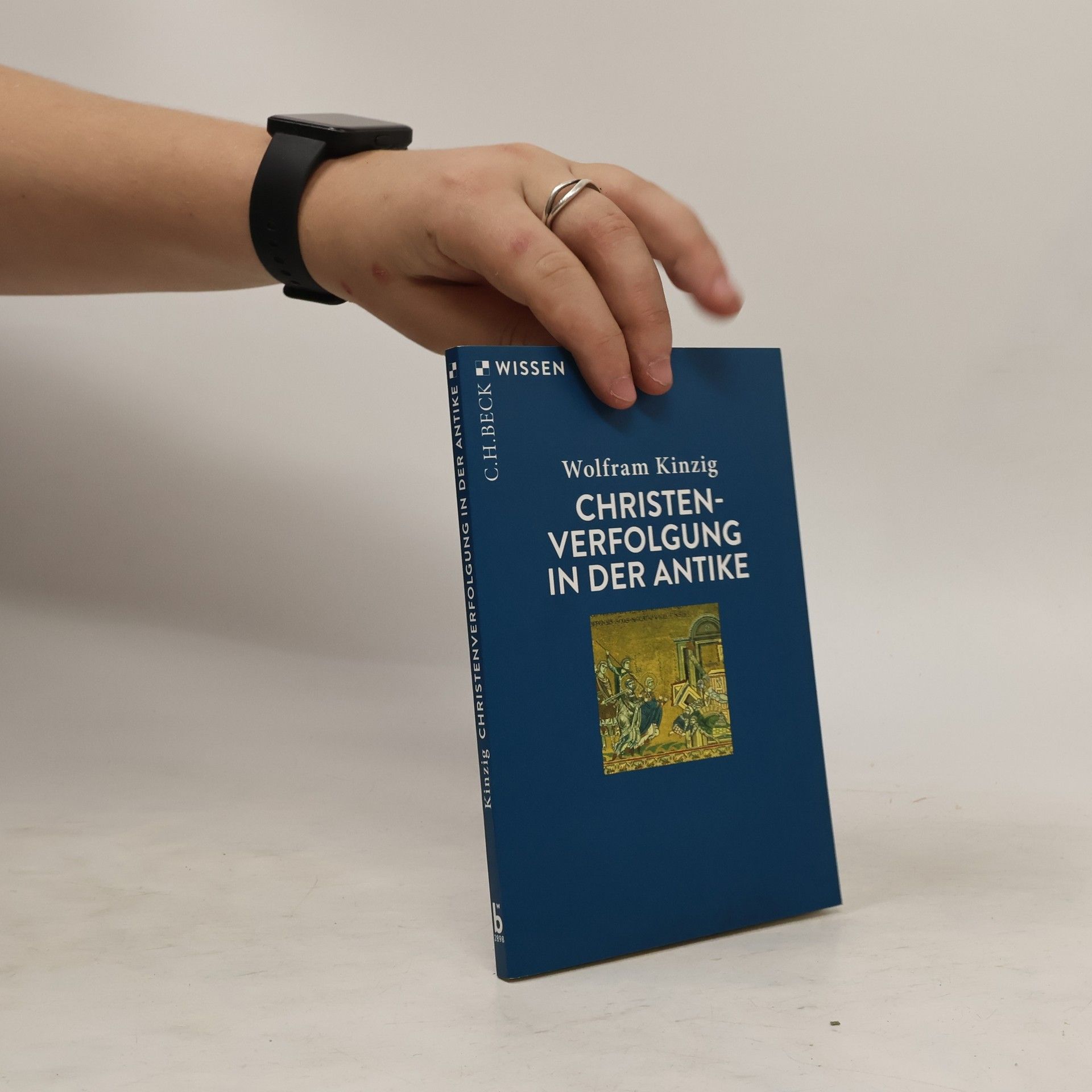Christenverfolgung in der Antike
- 128 Seiten
- 5 Lesestunden
Jahrhundertelang wurden Christen zur Zeit der frühen Kirche (1. bis 4. Jahrhundert) mit unfassbarer Grausamkeit gequält und ermordet. Die Verfolgten haben ihre Nöte mit oft übermenschlichem Mut erduldet - manchmal auch ihr Martyrium in einem uns heute sehr fremd anmutenden Verlangen geradezu gesucht. In diesem Buch werden Motive und Verlauf der Christenverfolgung beschrieben, Verantwortliche und Opfer benannt, aber auch die Gründe erhellt, weshalb die Pogrome und systematischen Nachstellungen schließlich an ihr Ende gelangten.