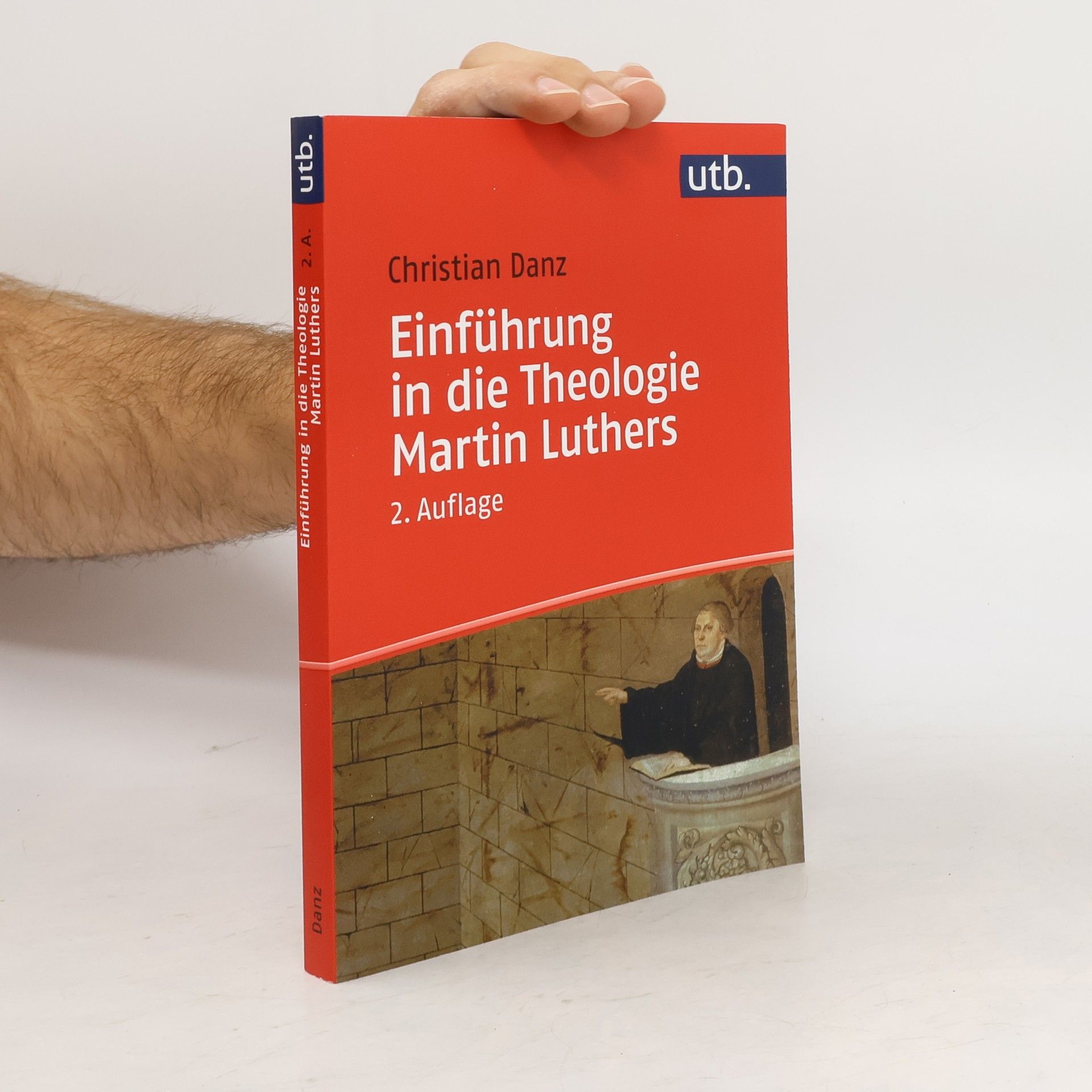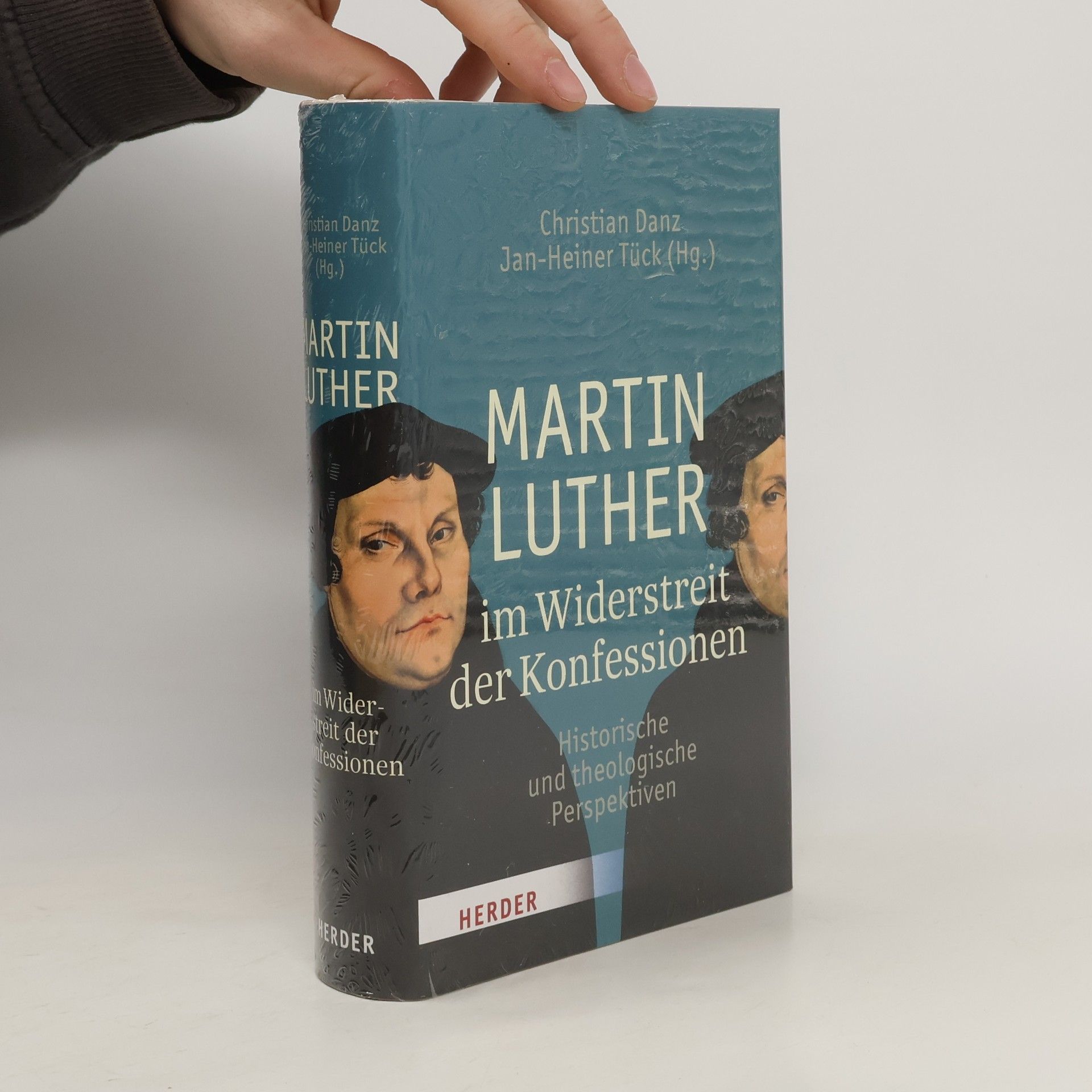Christian Danz Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)



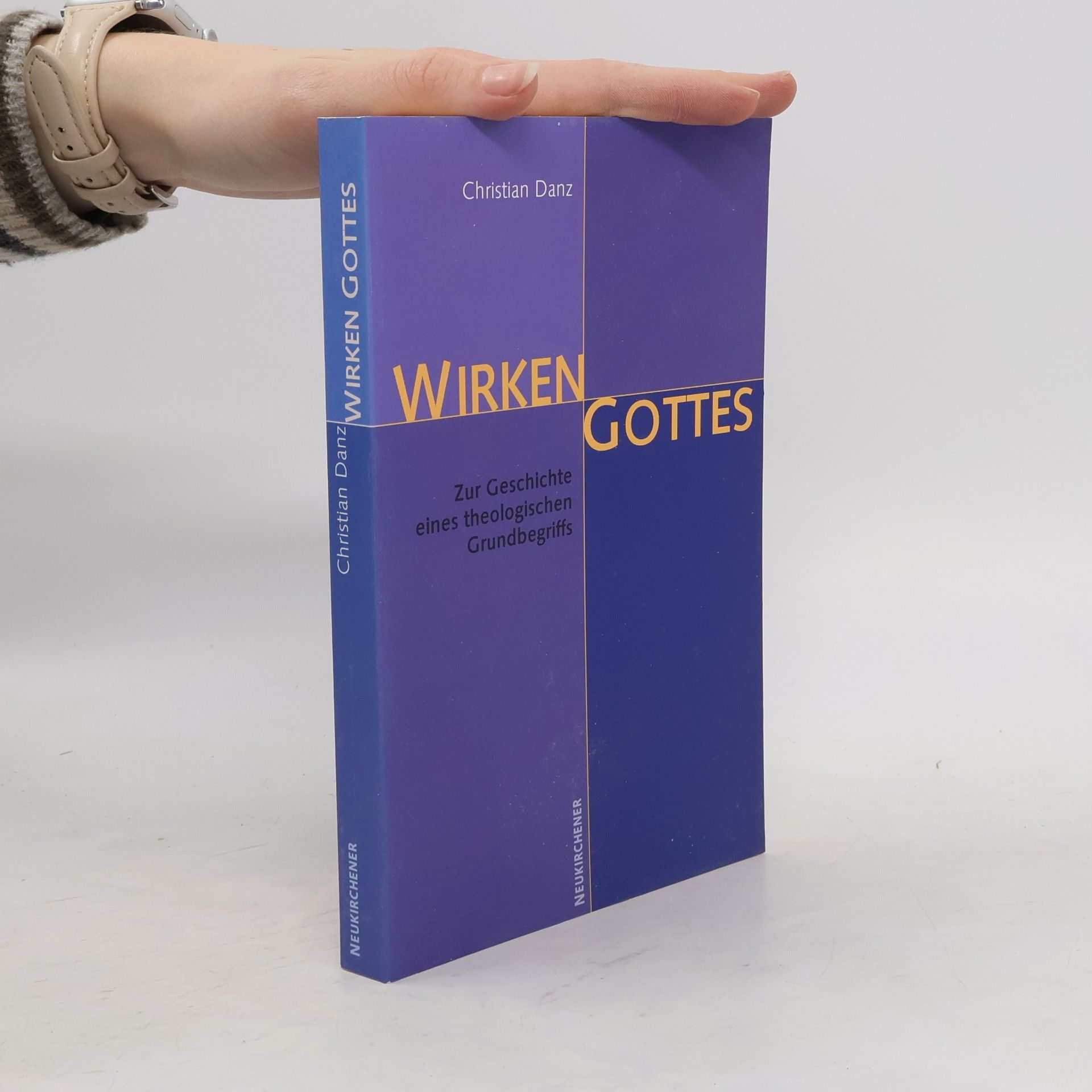


Der Band präsentiert Paul Tillichs Rezensionen, die er zwischen 1911 und 1955 publizierte. Damit rückt erstmals der Rezensent Tillich, seine Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit anderen theologischen und philosophischen Positionen in den Blick, die bislang weitgehend unbekannt blieb. Dabei macht gerade die öffentliche Auseinandersetzung mit theologischen, philosophischen oder sozialwissenschaftlichen Neuerscheinungen sichtbar, wie sich die eigene Position in der Kritik und Affirmation von anderen Autoren formiert. Rezensionen geben stets einen Überblick über das eigene Fach, die in diesem diskutierten Probleme sowie seine Weiterentwicklung und zeigen, wie sich die Rezensentin oder der Rezensent in dem Diskursfeld der Disziplin positioniert. Doch nicht nur im Hinblick auf Paul Tillich ist die Rezensionstätigkeit von Theologen nur wenig erforscht.
Transformation of Religion
Interdisciplinary Perspectives
This volume presents different approaches to the concept of religion. Religion in modern societies is undergoing accelerated change. Traditional religious forms are dissolving and being overlaid with or replaced by new ones. This poses particular challenges for analyses of the current religious situation, which already presuppose an understanding of religion. But it is precisely this that is disputed in academic discourse about it. Against the background of this complex situation, this volume turns to the transformations of religion. It brings together inter- and transdisciplinary approaches to religion and its definition. In this way, it takes into account the fact that the transformations of religion can only be grasped by incorporating diverse methodological approaches.
Jesus Christus - Alpha und Omega
Festschrift für Helmut Hoping zum 65. Geburtstag
- 768 Seiten
- 27 Lesestunden
Die Festschrift versammelt in triadischer Gliederung Beiträge namhafter Stimmen aus Theologie und Kirche. In einem ersten Teil werden Themen der Schöpfungstheologie, der Theologie als Glaubenswissenschaft und der Israeltheologie behandelt, ein zweiter Teil legt den Schwerpunkt auf christologische, soteriologische und liturgietheologische Aspekte, ein dritter Teil schreitet eschatologische Grenzfragen ab. Im Gespräch mit theologischen Anstößen von Helmut Hoping wird das facettenreiche Werk des renommierten und streitbaren Freiburger Theologen gewürdigt.
Theologie als Streitkultur
- 384 Seiten
- 14 Lesestunden
Wo zwei oder drei Theologinnen oder Theologen zusammenkommen, ist Streit vorprogrammiert. Diese Aussage wird durch einen Rückblick auf die Geschichte des Christentums untermauert, der viele Auseinandersetzungen zeigt, darunter solche, die zu Verurteilungen und Schismen führten. In der heutigen Zeit wird jedoch eher von Pluralität, Dialog und Diskurs gesprochen; echte theologische Streitgespräche sind selten geworden, obwohl die Themen weiterhin zahlreich sind. Dieser Band beleuchtet das Thema aus exegetischer, historischer, systematisch-theologischer und praktischer Perspektive. Zudem enthält er Beiträge aus aktuellen Forschungsprojekten von Mitgliedern der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum
Eine christologische und religionstheologische Skizze
- 290 Seiten
- 11 Lesestunden
Jesus von Nazareth lebte als Jude im Judentum der Zeit des Zweiten Tempels. Was bedeutet das fur die dogmatische Christologie und fur das Verhaltnis von Judentum und Christentum? Christian Danz erlautert dies in seiner christologischen und religionstheologischen Skizze. Er arbeitet die These aus, dass die dogmatische Lehre von Jesus Christus nicht gegenstandlich-realistisch zu verstehen sei, sondern als eine theologische Beschreibung der christlichen Religion. Hieraus ergibt sich eine neue Sicht sowohl des Judentums als auch anderer nichtchristlicher Religionen.
Paul Tillichs Systematische Theologie
- 342 Seiten
- 12 Lesestunden
Paul Tillichs Systematische Theologie (1951-1963) gehört zu den wichtigsten und einflussreichsten theologischen Werken des 20. Jahrhunderts. In ihr fasst er den Ertrag seines theologisch-philosophischen Denkens von vier Jahrzehnten zusammen. Obwohl Tillich sein Hauptwerk in den USA geschrieben hat, liegen die Anfänge seines systematisch-theologischen Denkens in seiner deutschen Zeit. Bereits 1913 konzipierte er einen Entwurf einer Systematischen Theologie, und 1925 begann er in Marburg eine Dogmatik-Vorlesung, die 1926 in Dresden fortgesetzt wurde. Der komplexe Entstehungszusammenhang, die problem- und debattengeschichtlichen Voraussetzungen, die sich in der Systematischen Theologie niederschlagen, stellen an den Leser hohe Anforderungen. Diese zusammen mit dem Text von Tillichs Hauptwerk zu erschließen, ist die Zielsetzung dieses Buches. Es bietet einen werk- und problemgeschichtlich angelegten Kommentar zur Systematischen Theologie .
Martin Luther im Widerstreit der Konfessionen
- 531 Seiten
- 19 Lesestunden
Welche Relevanz haben Rechtfertigungslehre, Anthropologie, Offenbarungsverständnis und Kirchenbegriff Martin Luthers für das Selbstverständnis der Theologien heute? Welche Impulse seines Denkens sind heute noch rezeptionsfähig? Der Band geht auf ein Symposium der beiden theologischen Fakultäten der Universität Wien zurück, das die bleibende Bedeutung Luthers und der Reformation für den Katholizismus und Protestantismus auslotete. Neben einem Beitrag der Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff über „Luther als Sprachereignis“ diskutieren renommierte Theologen strittige Aspekte von Luthers Theologie. Kardinal Kurt Koch und Bischof Michael Bünker bringen die Perspektive der Kirchenleitungen ein.
Studien zur Phänomenologie und Praktischen Philosophie - 38: Ausgehend von Kant
Wegmarken der klassischen deutschen Philosophie
- 347 Seiten
- 13 Lesestunden
Dieser Sammelband geht aus Beitragen junger Forscherinnen und Forscher hervor, die ihre Arbeiten auf einer DissertantInnen-Tagung zum Thema "Kant und der Deutsche Idealismus" prasentiert haben, die vom 31. Januar bis 2. Februar 2013 am Institut fur Philosophie der Universitat Wien unter Leitung von Violetta L. Waibel, Wien, Lore Huhn, Freiburg im Breisgau und Christian Danz, Wien, stattgefunden hat.