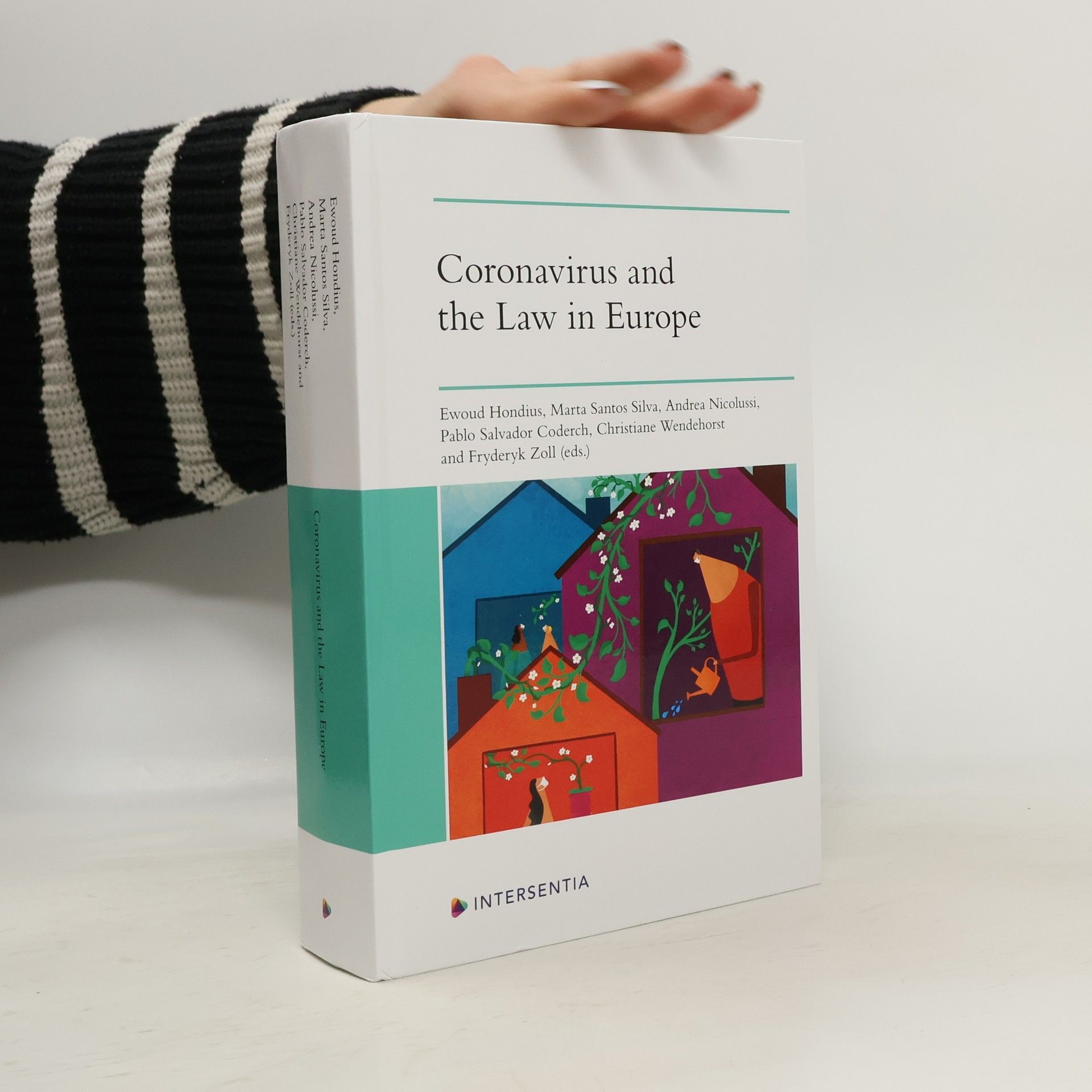Christiane Wendehorst Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)


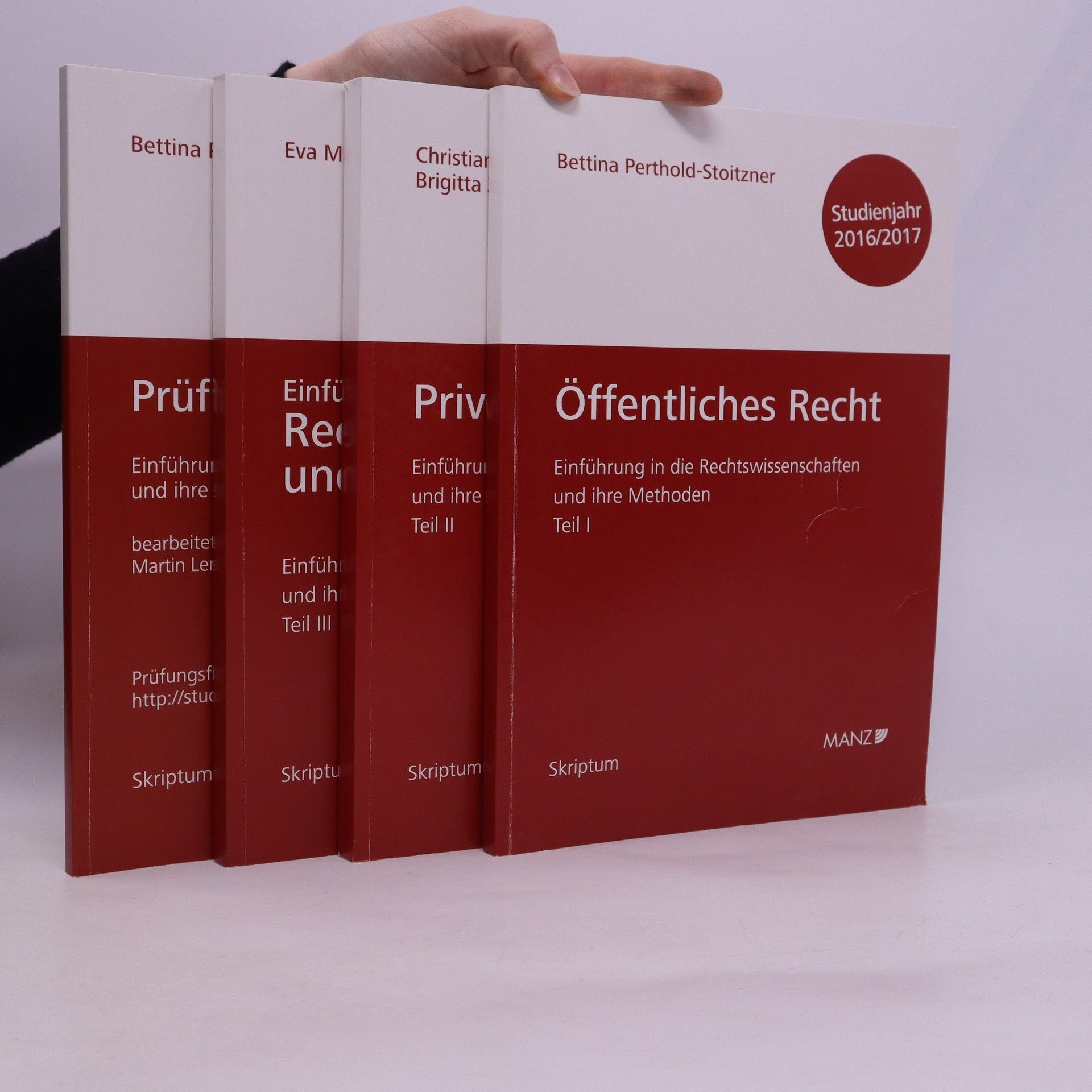

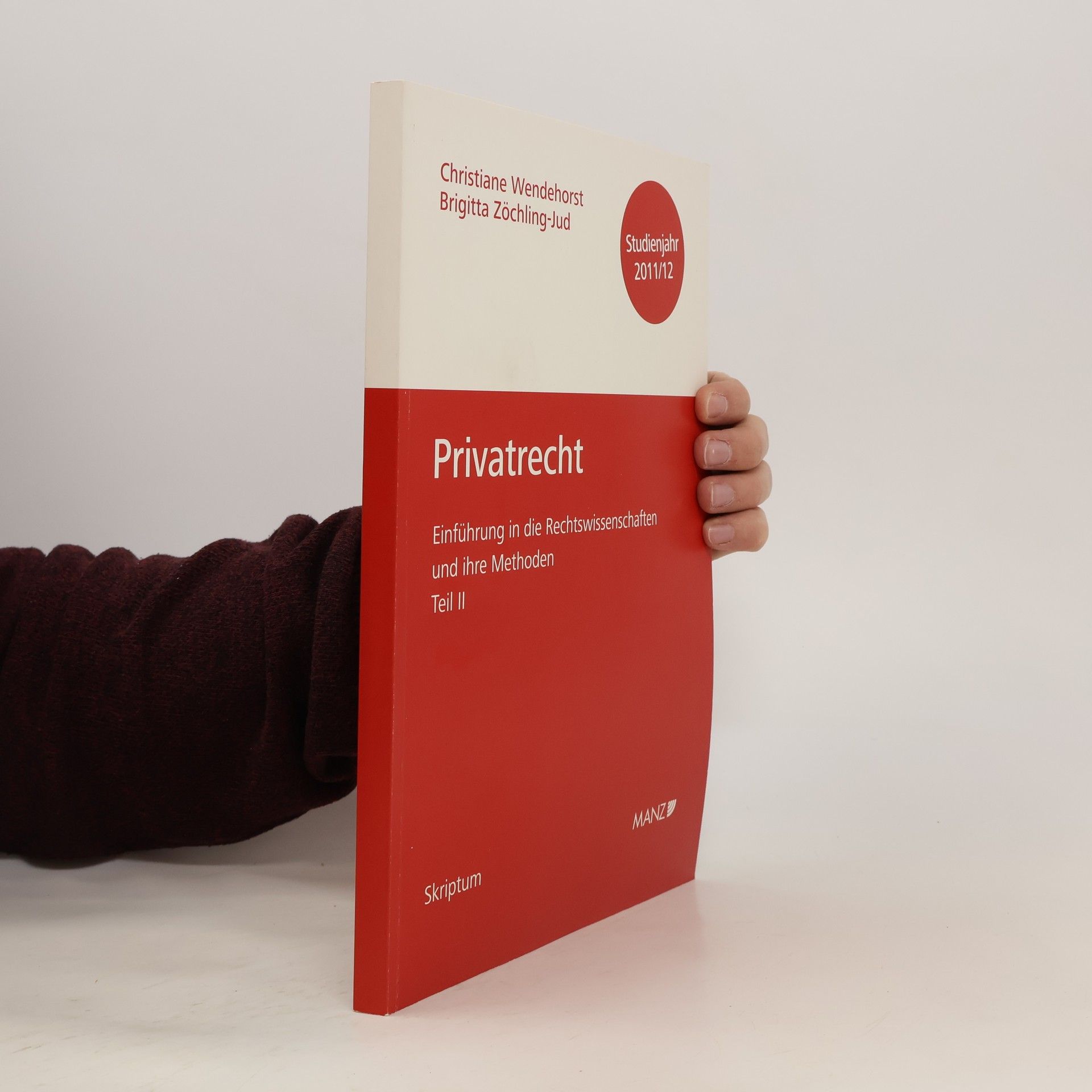

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in verschiedenen Lebensbereichen nimmt kontinuierlich zu, was zahlreiche rechtliche Fragen aufwirft, auf die die KI-VO Antworten geben soll. Im April 2021 stellte die Europäische Kommission einen ersten Verordnungsentwurf vor. Nach intensiven Verhandlungen wurde im Dezember 2023 der Trilog zwischen Kommission, Parlament und Rat abgeschlossen, und 2024 wurde die Verordnung verabschiedet. Mit Inkrafttreten der KI-VO wird sie das erste umfassende Regelwerk zur Künstlichen Intelligenz weltweit darstellen, das in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar Anwendung findet. Dieser Großkommentar bietet eine ausführliche, strukturierte und verständliche Erläuterung aller Vorschriften der KI-VO. Er verbindet wissenschaftliche Tiefe mit einem engen Praxisbezug. Eine komprimierte Einleitung ermöglicht den Leserinnen und Lesern einen schnellen Zugang zu dieser komplexen Rechtsmaterie. Die Vorteile umfassen eine detaillierte Kommentierung aller Normen der KI-VO, eine übersichtliche Aufbereitung, wissenschaftliche Fundierung und Praxisnähe durch zahlreiche Beispiele. Zudem werden Überschneidungen und Abgrenzungen zu anderen Regelwerken, wie der DS-GVO, erläutert. Die Zielgruppe umfasst Rechtsanwälte mit Schwerpunkt IT- und Datenschutzrecht, Richter, Behördenmitarbeiter, Datenschutzbeauftragte, Unternehmensjuristen, Compliance-Beauftragte, NGOs und alle Interessierten.
Verbraucherkreditrecht
- 700 Seiten
- 25 Lesestunden
Die 2. Auflage enthält: Kommentierung des VerbraucherkreditG und des neuen Hypothekar- und ImmobilienkreditG sowie der ABGB-DarlehensbestimmungenJudikatur zum VKrGErläuterungenausführliche LiteraturhinweiseEU-Richtlinien
Coronavirus and the Law in Europe
- 1100 Seiten
- 39 Lesestunden
On 30 January 2020, in response to the globalisation of COVID-19, the World Health Organization declared a Public Health Emergency of International Concern. The deadly outbreak has caused unprecedented disruption to travel and trade and is raising pressing legal questions across all disciplines, which this book attempts to address.00The aims of this book are twofold. First, it is intended to serve as a "toolbox" for domestic and European judges. They will soon be dealing with the interpretation of COVID-19-related legislation and administrative measures, as well as the disruption the pandemic has caused to society and fundamental rights.00Second, it aims to assist businesses and citizens who wish to be informed about the implications of the virus in the existence, performance and enforcement of their contracts.
Privatrecht
Einführung in die Rechtswissenschaften und ihre Methoden - Studienjahr 2019/20
- 254 Seiten
- 9 Lesestunden
Privatrecht
- 254 Seiten
- 9 Lesestunden
Privatrecht 2.
- 230 Seiten
- 9 Lesestunden
Einführung in die Rechtswissenschaften und ihre Methoden - Privatrecht - Studienjahr 2013/14
- 230 Seiten
- 9 Lesestunden