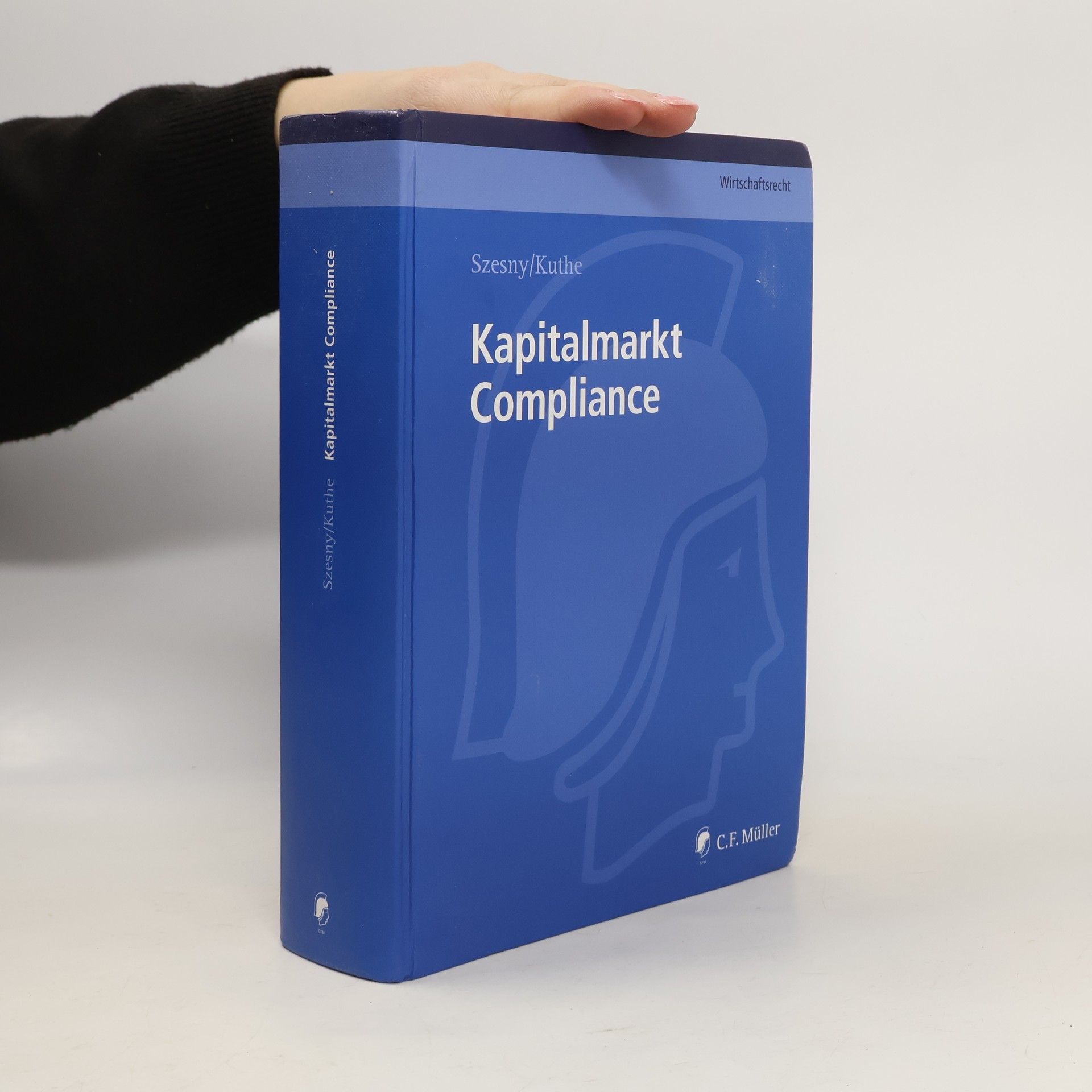C.F. Müller Wirtschaftsrecht: Kapitalmarkt Compliance
- 1272 Seiten
- 45 Lesestunden
Die strenge und stetig zunehmende Regulierung des Kapitalmarkts stellt Compliance-Verantwortliche in kapitalmarktorientierten Unternehmen immer wieder vor große Herausforderungen. Das Handbuch bereitet das Kapitalmarktrecht verständlich und praxisfreundlich auf und bietet eine Hilfe beim Aufbau bzw. der Effektivierung eines Compliance-Systems im Unternehmen. Der Aufbau folgt dem Adressatenkreis: Emittenten, Banken und Finanzdienstleister. So erhält der Praktiker Zugang zu den für ihn maßgeblichen Themenkreisen. Die Autoren zeigen die enge Verzahnung des materiellen Kapitalmarktrechts mit dem Strafrecht. Fast alle Ge- oder Verbote in den Kapitalmarktgesetzen werden mit einer Geldbuße oder gar Geld- und Freiheitsstrafe geahndet. Die straf- und bußgeldrechtlichen Aspekte des Kapitalmarktrechts werden daher in einem eigenen Teil ausführlich und abschließend erläutert. Das Handbuch verbindet so die kapitalmarktrechtliche Compliance mit der Criminal Compliance.