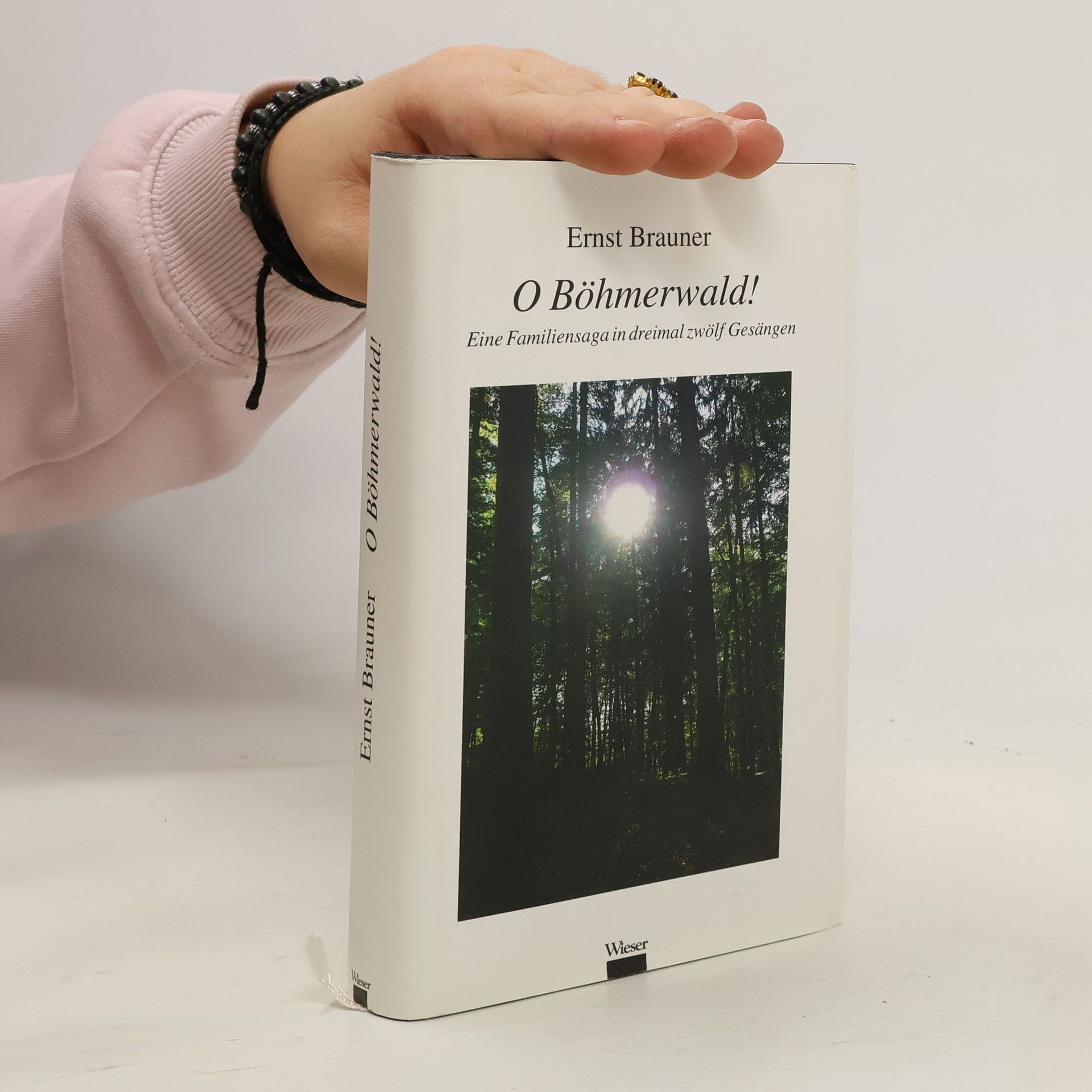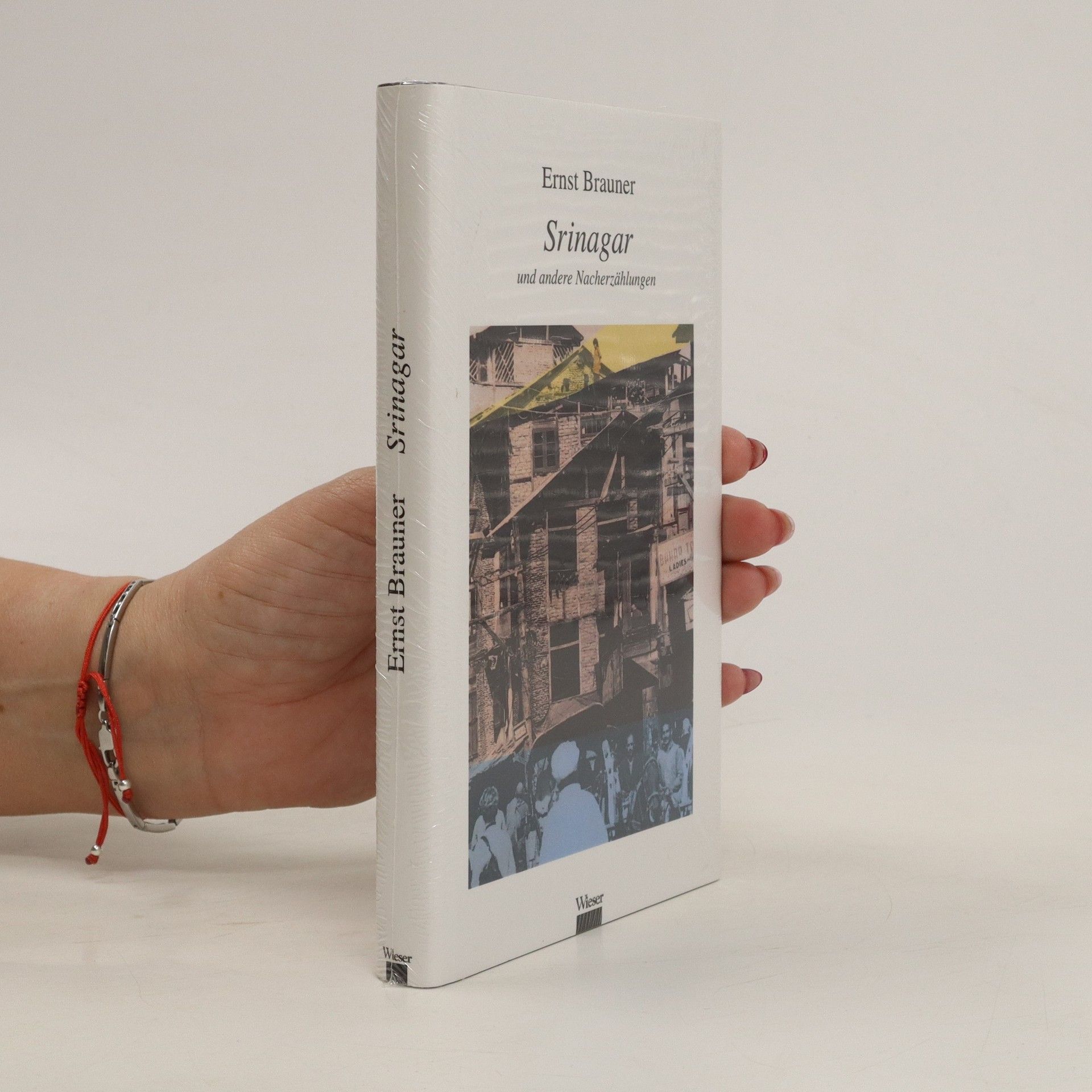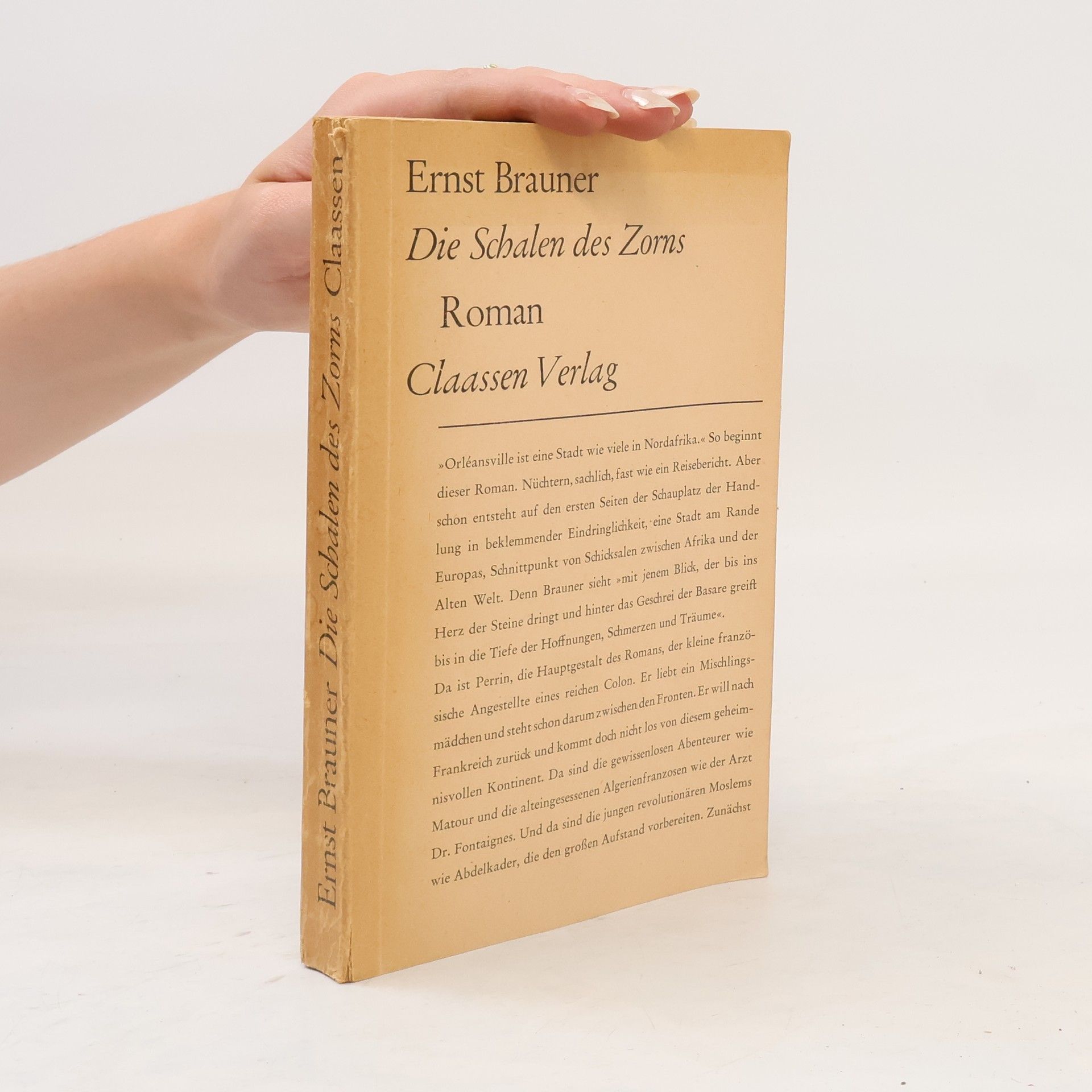Srinagar und andere Nacherzählungen
- 184 Seiten
- 7 Lesestunden
Srinagar ist eine Stadt in Kaschmir, wo nach dem Glauben einer islamischen Sekte Jesus, der ja als einer ihrer Propheten gilt, begraben ist. Also nicht, wie fälschlich berichtet, am Kreuz gestorben, sondern aus dem Grab in Jerusalem, das ja später tatsächlich leer gefunden worden ist, nach Srinagar entkommen und nach langer fruchtbarer Lehrtätigkeit in einer noch heute zu besichtigenden Gruft bestattet wurde. Historie? Oder eine der zahllosen „Nacherzählungen“, mit denen wir Menschen unser Leben meist nach irgendwelchen Archetypen, nach überlieferten Mythen und Märchen oder gar nur nach den flimmernden Bildern irgendwelcher Fernsehshows nachzuleben versuchen?