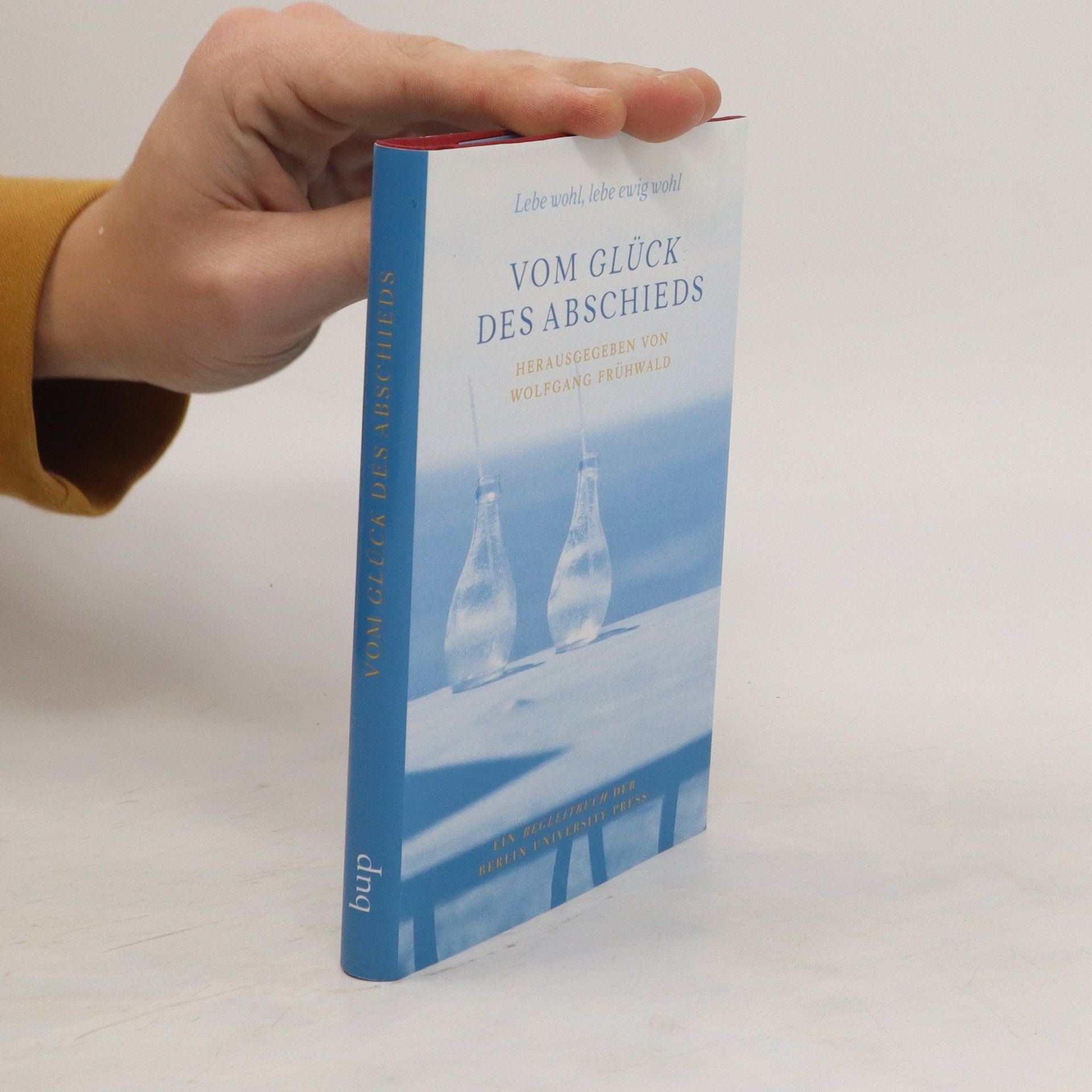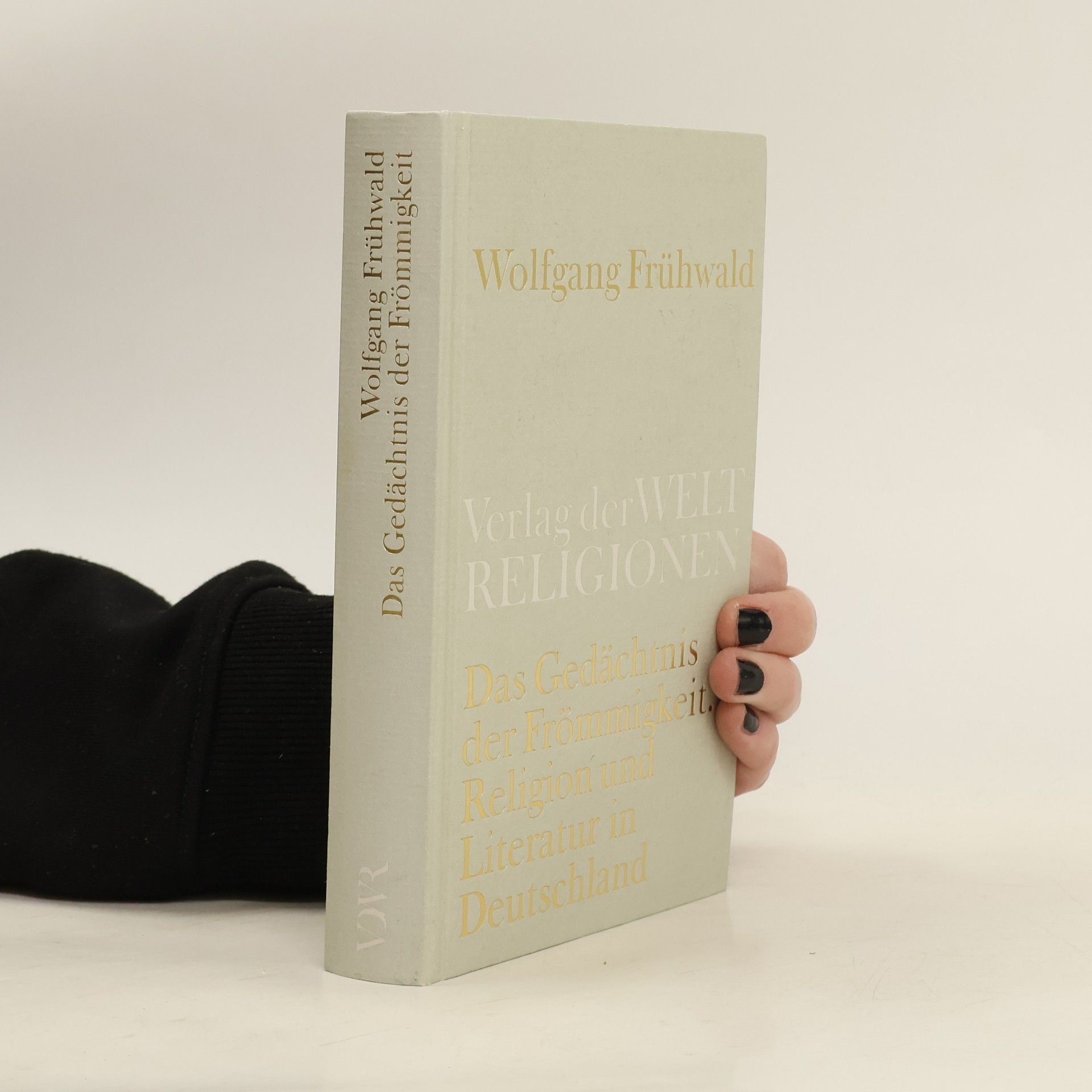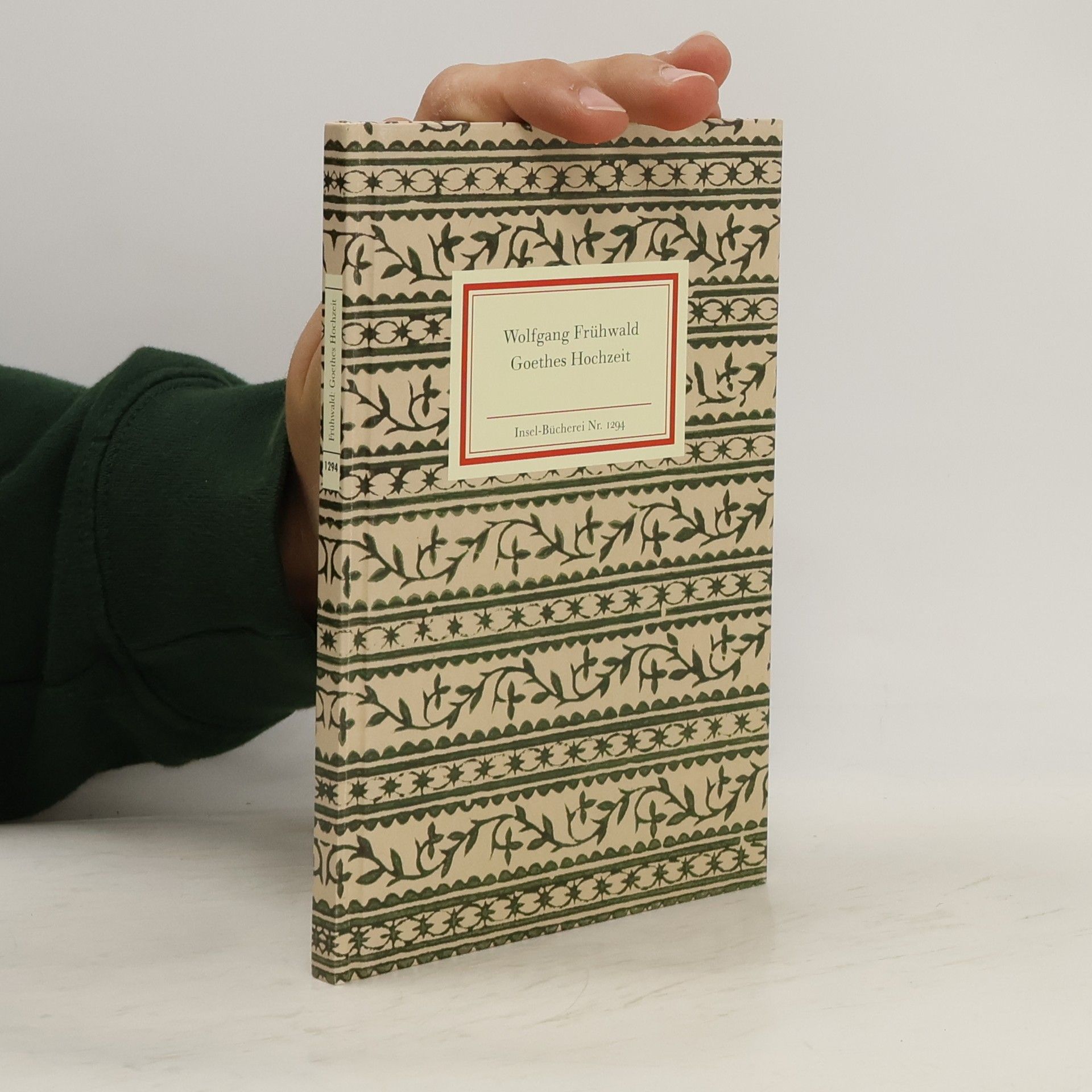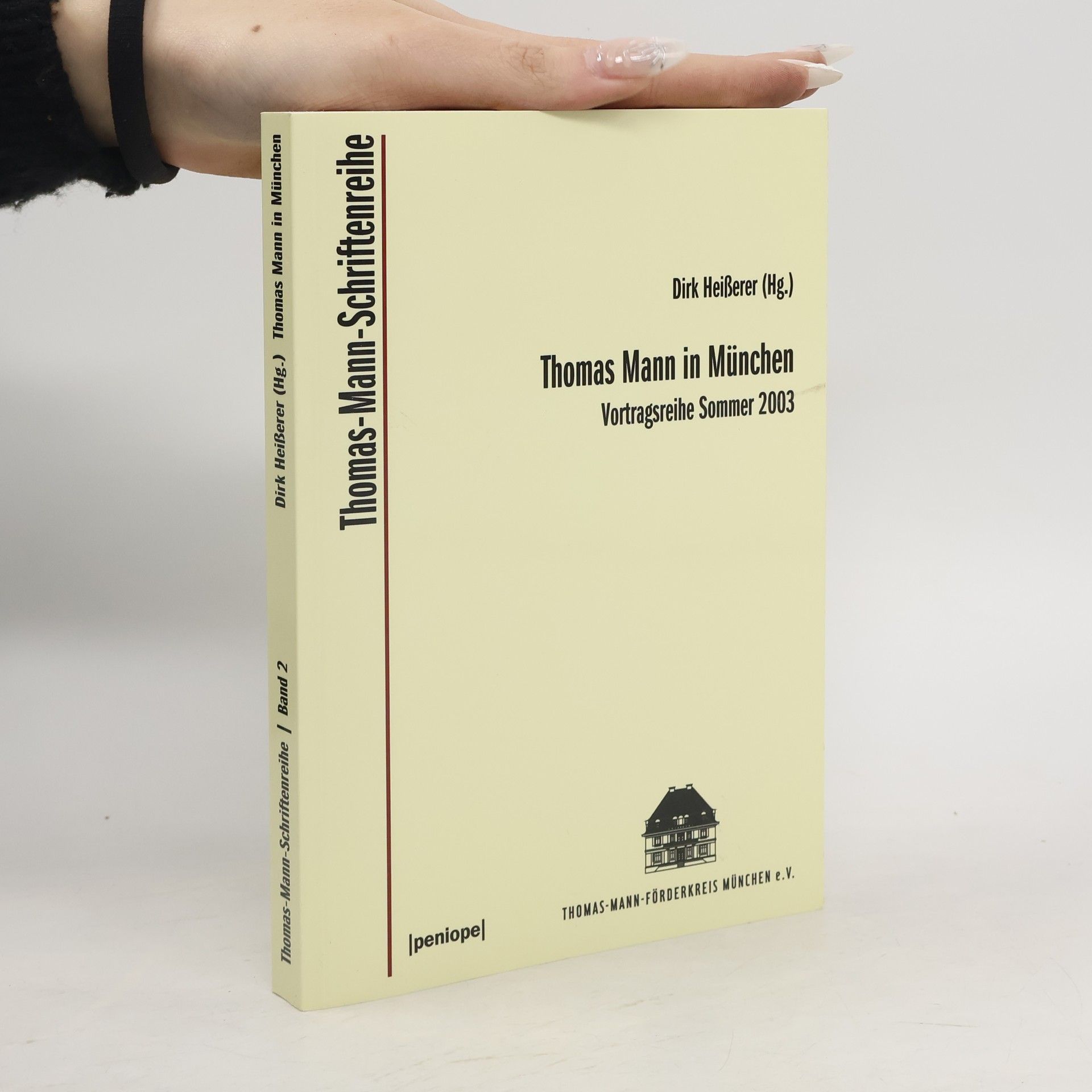Als Christiane Vulpius am 12. Juli 1788 Goethe eine Bittschrift ihres verarmten Bruders Christian überreichte, nahm eine ganz besondere Lebenspartnerschaft ihren Anfang. In der sechzehn Jahre jüngeren Frau aus bedrängten Verhältnissen fand der Dichter eine Partnerin, die ihn mit Lebenslust, Weiblichkeit und handfest-praktischem Sinn im bürgerlichen Leben befestigte – und zugleich seine Verse beflügelte. Von Anfang an aber, über die Geburt von fünf Kindern und über die späte Eheschließung im Jahre 1806 hinaus, mußte Goethe diese Verbindung gegen Legendenbildung, Klatsch und Vorurteile am Weimarer Hof verteidigen. Den qualvollen Tod seiner Frau (1816) ertrug der Dichter nicht aus der Nähe, doch fand er so innige wie todestraurige Verse für ihren Verlust: »Der ganze Gewinn meines Lebens / Ist ihren Verlust zu beweinen.«
Wolfgang Frühwald Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
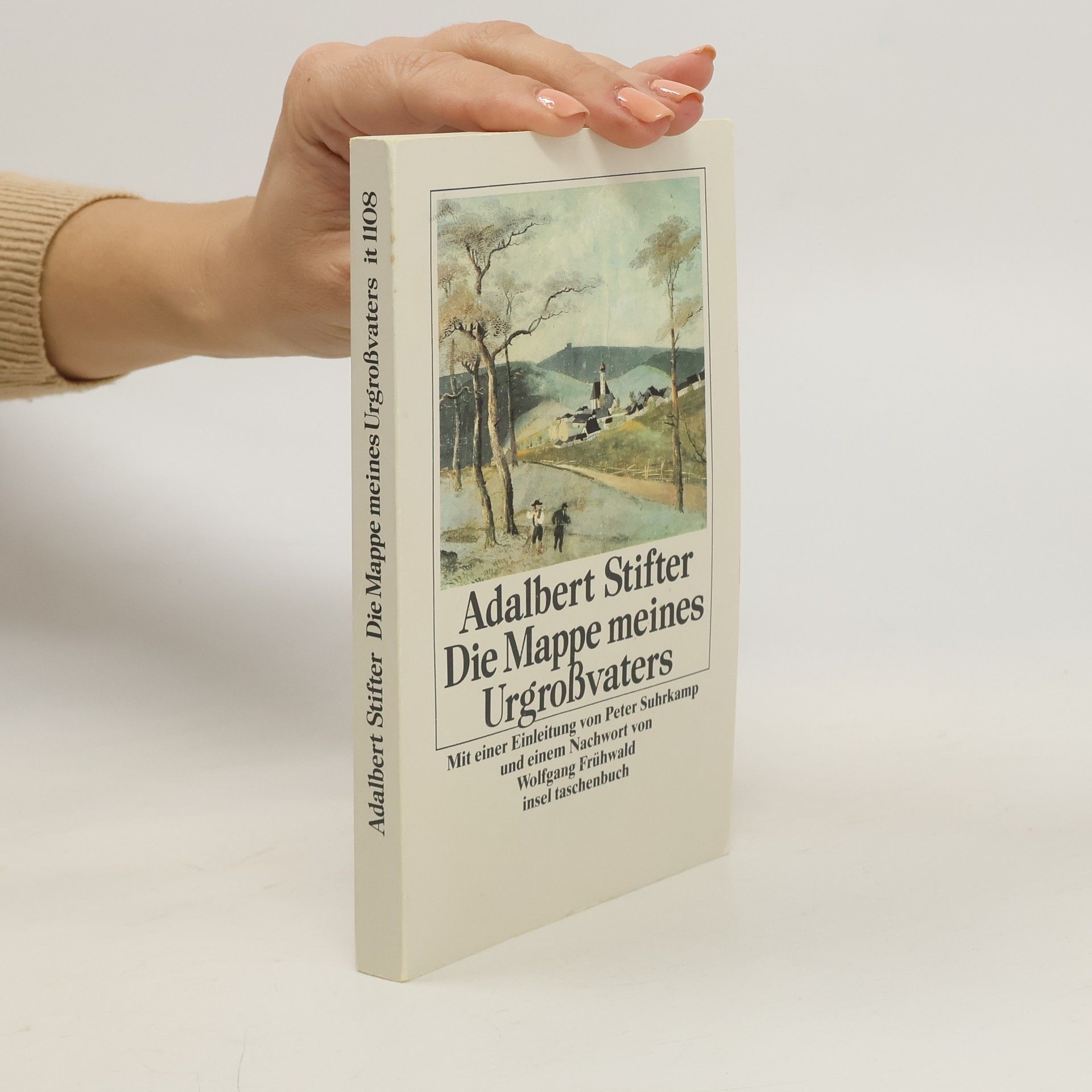
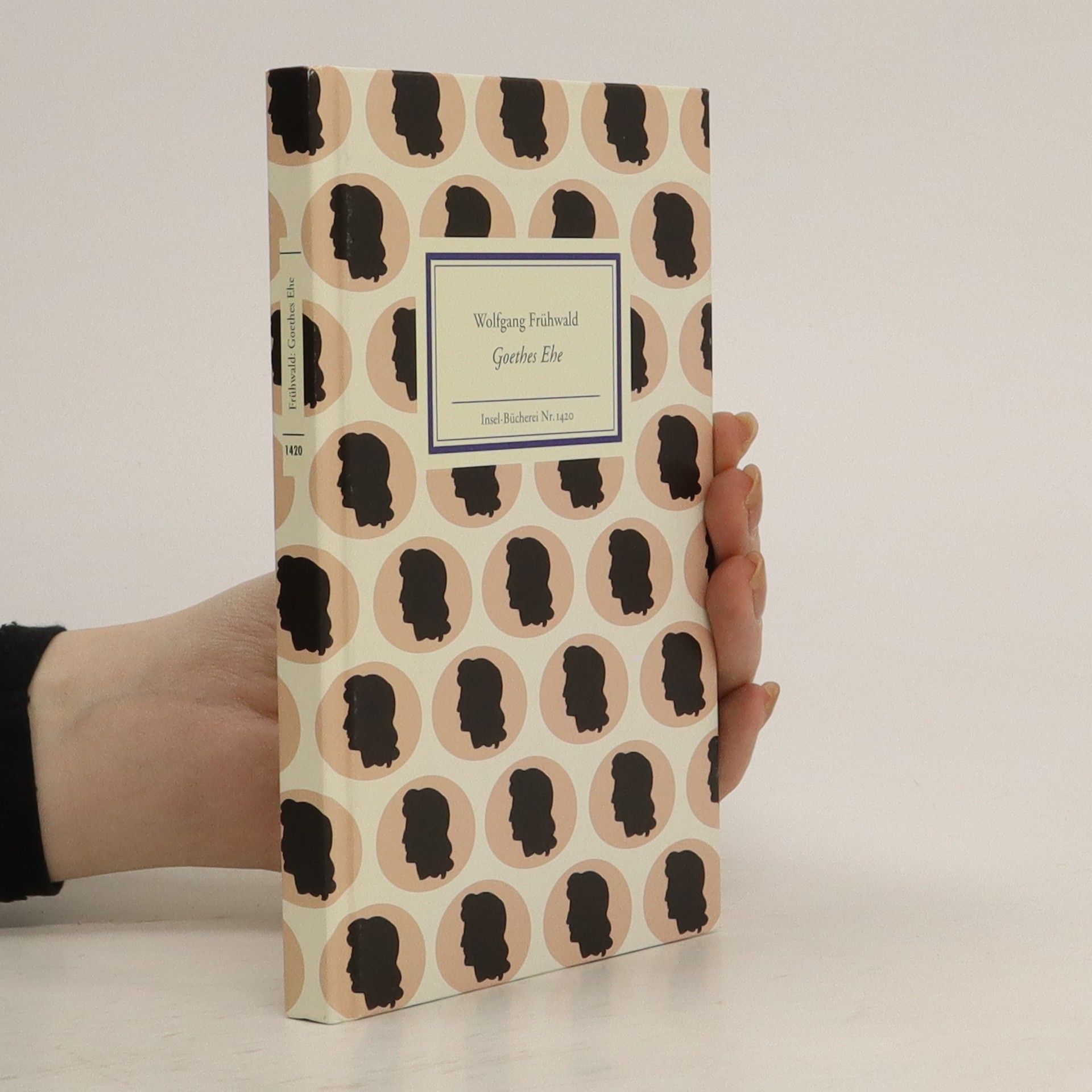
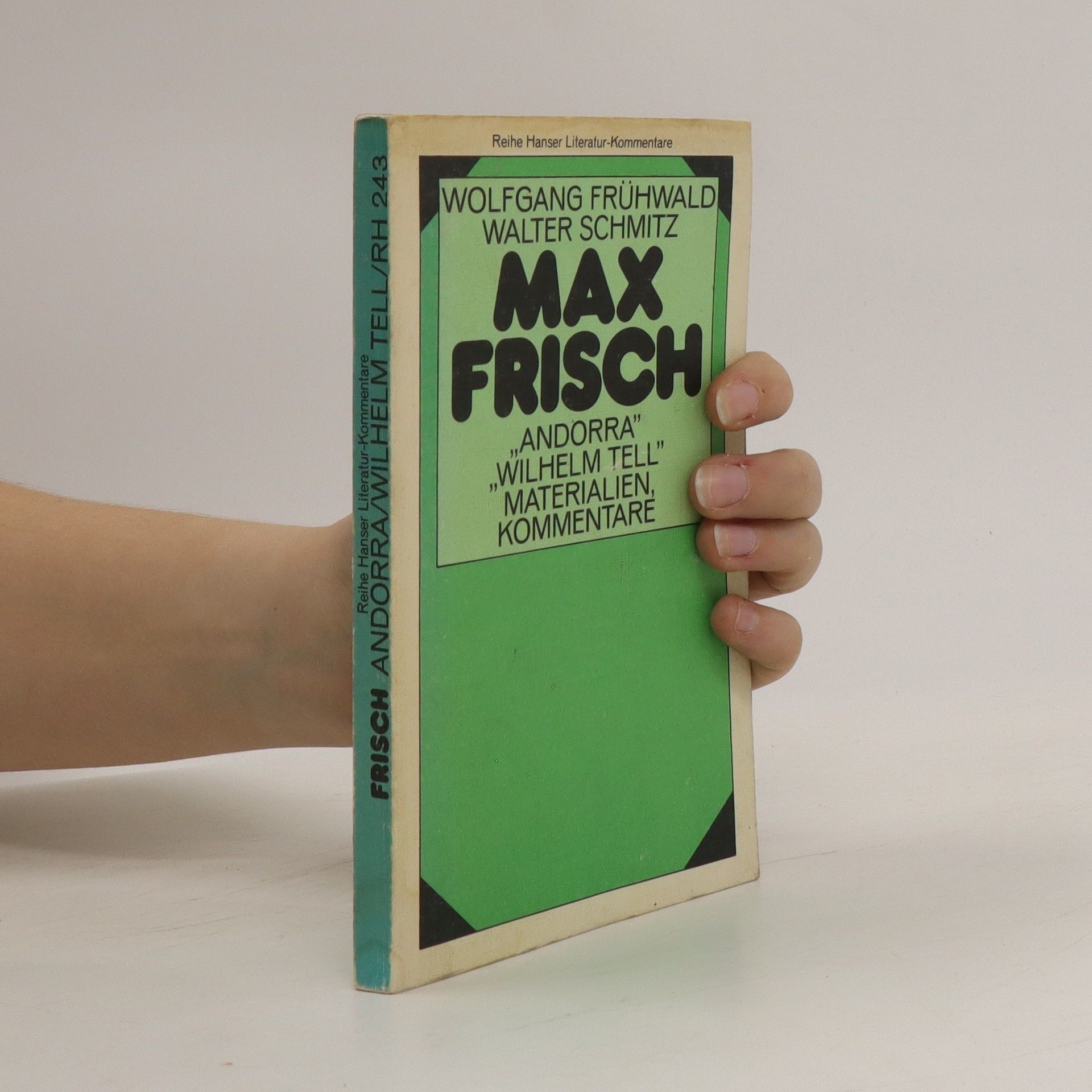



Dass der Mensch ein »Sprachtier« sei und an einer Kette mit seinen tierischen Vorfahren hänge, sich aber durch die Sprache von ihnen unterscheide, hat schon Aristoteles gewusst. Doch wie wirkt diese Sprache, wodurch wird sie konstituiert, wie viel an Sprache brauchen wir, um die komplizierte moderne Welt zu benennen, wenn diese durch Graphik und Bilder uns doch scheinbar näherrückt als durch die distanzierende Sprache? Wenn nur sieben Prozent der Informationen eines Gespräches über Inhalt und Bedeutung transportiert werden, dagegen mehr als 35 Prozent über die Sprachmelodie und mehr als 50 Prozent über Gestik und Mimik, ist die Sprachkultur, die auch eine Lesekultur ist, dann tatsächlich so entscheidend, wie es der Aufwand besagt, den wir damit treiben? Solchen und anderen Fragen gehen die Studien dieses Bandes zur Sprache nach, zu ihrer humanisierenden Wirkung oder zum Abenteuer des Lesens. Sie berichten von einem Phänomen, das den Menschen erst zum Menschen macht. Als der sozialistische Publizist Carl von Ossietzky, Friedensnobelpreisträger des Jahres 1935 gefragt wurde, welche Strafe er sich für seine nationalsozialistischen Peiniger ersinnen könnte, soll er geantwortet haben: »Deutsch müssten sie lernen«.
Scheiden tut weh, singt das Kinderlied, und fügt hinzu: Aber dein Scheiden macht, dass jetzt mein Herze lacht. Dieses Buch ist ein wertvoller Begleiter, dessen Texte tief in eine Leidenschaft eintauchen, die wir verloren glaubten. Sie erzählen von Verzweiflung, Hoffnung und der Möglichkeit, zu bestehen. Abschied und Trennung sind schmerzhafte Aspekte des Lebens, doch es gibt auch ein Glück in den Abschieden, nicht nur beim Wiedersehen. Diese Erfahrungen gehören zu den Urszenen des menschlichen Lebens, besonders in der Moderne. Poeten, Maler und Musiker haben den Abschied in ihren Werken thematisiert, da die Trennung von Geliebten, Heimat und Freunden sowie der Abschied vom Leben Teil unserer Bestimmung ist. Leidenschaftliche Briefe und Wahnsinnstaten sind nicht mehr Ausdruck des Willkommens, sondern gehören dem Ende, der Krise und dem Gehen an. Die größten Dichter und Sänger haben zeitlose Abschiedsszenen geschaffen, die unzähligen Menschen seit Jahrhunderten ihre Lebensrealität spiegeln. So wird der Abschied von Romeo und Julia nach der Liebesnacht zur Kernszene einer der großen Geschichten der Literatur. Rilkes Sonette an Orpheus erinnern uns: Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter dir, wie der Winter, der eben geht.
Über die »Entschleierung der Wahrheit« in einer Zeit des universitären Wandels. Wolfgang Frühwald nutzt in seiner Göttinger Universitätsrede den historischen Vergleich mit dem 19. Jahrhundert, um zu verdeutlichen, was zur Substanz und was zu den Akzidenzien einer Universität gehört. Mit der letzten großen Reform der deutschen Universität im Jahr 1810 erhob Wilhelm von Humboldt die »Autorität des Zweifels« zum leitenden Postulat. Aus Freiheit und Zweifel, Freiheit zum Zweifel und Freiheit im Zweifel sollten Charakter und Persönlichkeit junger Menschen gebildet werden. Damit rückten neben der Forschung die Lehre und ihre Qualität als Kerngedanke der Humboldt' schen Reformidee in den Mittelpunkt universitären Handelns. Für Wolfgang Frühwald können diese Gründungsgedanken nahtlos in eine neu zu denkende Universität übernommen werden: »Diese Universität wird und muss dem Prinzip der Verantwortung folgen, in erster Linie der Verantwortung für die Studierenden, für deren Einführung in die Wissenschaft und Beteiligung an der Wissenschaft. Denken und Erkennen müssen zur lebensleitenden Erfahrung werden«.
Das Gedächtnis der Frömmigkeit
- 378 Seiten
- 14 Lesestunden
Seit Martin Luther die deutsche Sprache durch seine Bibelübersetzung auf das Niveau der heiligen Sprachen hob, sind Spiritualität und Sprache im Deutschen eng miteinander verbunden. Die Frömmigkeit bildet die Grundlage deutscher Literatur und Sprache, und ihr in Literatur bewahrtes Gedächtnis reicht weit über die Aufklärung und deren sprachliche Säkularisation hinaus in die Moderne. In fünfzehn Kapiteln wird der Entwicklungsweg deutscher Literatur anhand verschiedener Stationen der Frömmigkeit nachgezeichnet. Diese umfassen Friedrich Spee von Langenfeld, den Beichtvater der Hexen, die Empfindsamkeit von Sophie von La Roche, die „Hausfrömmigkeit“ von Matthias Claudius und die „Weltfrömmigkeit“ Goethes. Der Weg der sprachlichen Säkularisation in der Romantik zeigt, wie Ästhetik an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert religiöse Funktionen übernahm. Von der Romantik führt der Weg zu modernen Frömmigkeitsformen: zur Gotteserfahrung im Schmerz bei Adalbert Stifter, dem religiösen Sozialismus Alfred Döblins, Elisabeth Langgässers Versuch, Mythos und Frömmigkeit zu verbinden, und Reinhold Schneiders Gebetshoffnung, die ihm Kraft im Widerstand gegen die nationalsozialistische Barbarei gab. Schließlich wird die Gestaltung menschlicher Passionen bei Horst Bienek, Peter Huchel und Tankred Dorst sowie die Neuformulierung der Psalmensprache bei Arnold Stadler betrachtet.
Goethes Hochzeit
- 78 Seiten
- 3 Lesestunden
Als Goethe am 19. Oktober 1806 zum Entsetzen der Weimarer Gesellschaft die Mutter seines fast erwachsenen Sohnes heiratete, lag eine krisenhaft zugespitzte Folge traumatischer Ereignisse hinter ihm: Schillers Tod am 9. Mai 1805, Nierenkoliken, die ihm das Leben zur Hölle machten, schließlich am 14. Oktober 1806 der Sieg von Napoleons Truppen bei Jena und Auerstedt: Weimar war freigegeben zur Plünderung, der Tod allgegenwärtig. Nie stand das mögliche Ende Goethe so nah vor Augen, und er wollte, so wird gesagt, Frau und Sohn im Falle seines Todes versorgt wissen. Doch ist das als Erklärung für seine späte Heirat hinreichend? Wolfgang Frühwald zeigt, daß es wirklich Liebe war, die Goethe zu diesem Schritt bewog – eine Liebe, die sich nicht mehr um die feinsinnige Trennung von Sexualität und Freundschaft, bürgerlicher Ehe und Triebbefriedigung scherte. Der Nachweis gelingt Frühwald in einer packenden Synopse des Schicksalsjahres 1806 sowie in der Betrachtung von poetischen Texten, in denen Goethe »Barrieren gegen den Tod« errichtete.
Die Reichweite biotechnischer Eingriffe in das menschliche Leben wirft grundlegende ethische Fragen auf. Die Moderne gestaltet den Menschen nicht nur äußerlich, sondern verändert ihn von innen. Der Streit um Menschenzüchtung und Therapie zieht Philosophen, Theologen, Neurowissenschaftler und Dichter in seinen Bann. Ein zentrales Anliegen ist die Befürchtung, dass der Mensch sich nicht mehr nach dem Bild seines Schöpfers, sondern nach seinem eigenen Bild formt. Welche Selbstwahrnehmung entwickelt der Mensch, um das Design künftiger Generationen zu gestalten? Die Vorstellung, dass in naher Zukunft Menschen aus im Labor gezüchteten Stammzell-Linien hervorgehen, ist keine Science-Fiction, sondern ein reales Thema der wissenschaftlichen Diskussion. Die großen Erzählungen unserer Zeit werden bereits in neuartiger Weise formuliert. Die Texte entstanden im Rahmen einer Vorlesungsreihe an der Universität Mainz und bieten Perspektiven von verschiedenen Autoren, die sich mit diesen drängenden Fragen auseinandersetzen.
Gedichte der Romantik
- 532 Seiten
- 19 Lesestunden
Dieser Band, herausgegeben von Wolfgang Frühwald, Romantik-Kenner par excellence, eröffnet einen einzigartigen Zugang zur romantischen Lyrik in ihrer ganzen Vielfalt. Präsentiert werden die wichtigsten Autoren, Themen und Formen. Wo immer möglich, folgen die Texte den Erstausgaben. Ein umfangreicher Anhang mit Erläuterungen, Registern zu Themen, Leit- und Bildworten und eine ausführliche Einleitung erschließen die lyrischen Meisterwerke einer Epoche. „Es ist ein Band, der sich durch seinen Umfang wie auch in seinem Anhang auf das sorgfältigste und findigste auszeichnet.“ (Karl Krolow) - „Der Band ist richtungweisend, höchst brauchbar und empfehlenswert“ (Colloquia germanica) - „Unvergleichlich“ (Wulf Segebrecht, Germanistik) - „Ein Musterexemplar. der Anhang kann mit weit über hundert Seiten seinesgleichen in anderen Verlagen wohl suchen“ (Die Presse, Wien) - „Vorbildlich in der Anlage. Grundlage für intensive Studien. reizvolles Lesebuch“ (HR)
[Furhmann, Horst] Frühwald, Wolfgang. Zeit der Wissenschaft - Forschungskultur an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Köln, DuMont, 1997. 8°. 304 Seiten. Softcover / Kartoniert. Sehr guter Zustand. Mit handschriftlicher Widmung von Wolfgang Frühwald an den Historiker Horst Fuer Horst Fuhrmann - den Freund der DFG - Bonn 26.9.97 - Wolfgang Frühwald.