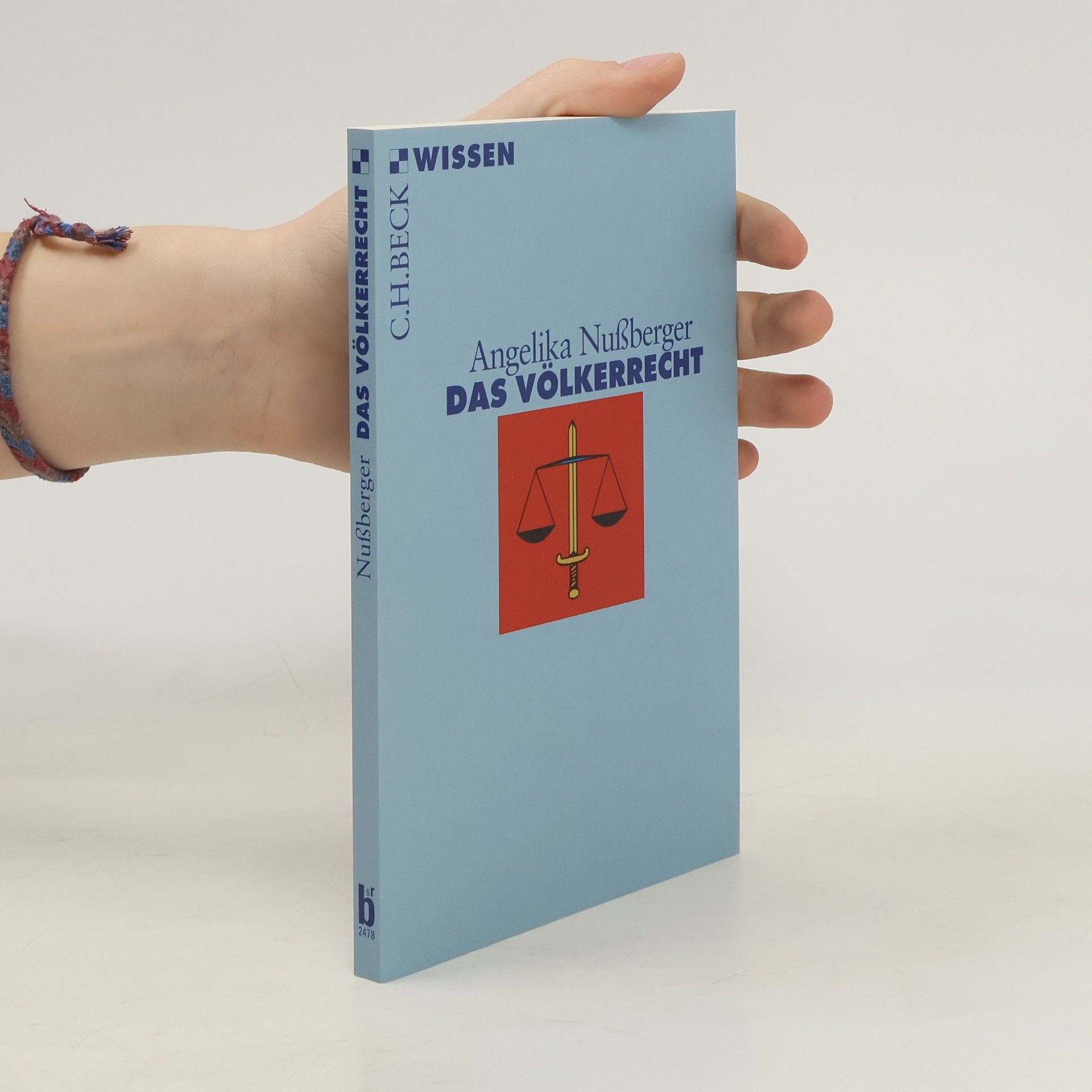Europa darf man beim Wort nehmen. Es hat versprochen, aus den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begangenen Fehlern zu lernen und – nach unendlichem Leid – den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen ohne den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu vergessen. Es hat versprochen, einen gerechten Ausgleich zu schaffen zwischen den Rechten des Einzelnen und dem, was in einer demokratischen Gesellschaft Not tut. Siebzig Jahre später ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Was wurde erreicht, wo hat Europa versagt? Hat es vermocht, die Geisel des Krieges zu bannen, Macht einzuhegen, Sorgen und Nöte ernst zu nehmen? Die Zweifel an Europa sind laut; viele fragen, ob es wirklich guten Willens ist. Die Erzählung der fast siebzigjährigen Geschichte des Europäischen Gerichtshofs als richterliche Instanz zum Schutz der Menschenrechte kann Antworten geben. Man sieht Wohl und Wehe, Beeindruckendes und Enttäuschendes, das Ineinandergreifen von Politik und Recht. Die Geschichte lässt nicht gleichgültig. Europa hat zugleich mehr erreicht, als man vielleicht zu hoffen gewagt hat und läuft doch Gefahr, an seinem Erfolg zu scheitern.
Angelika Nussberger Bücher


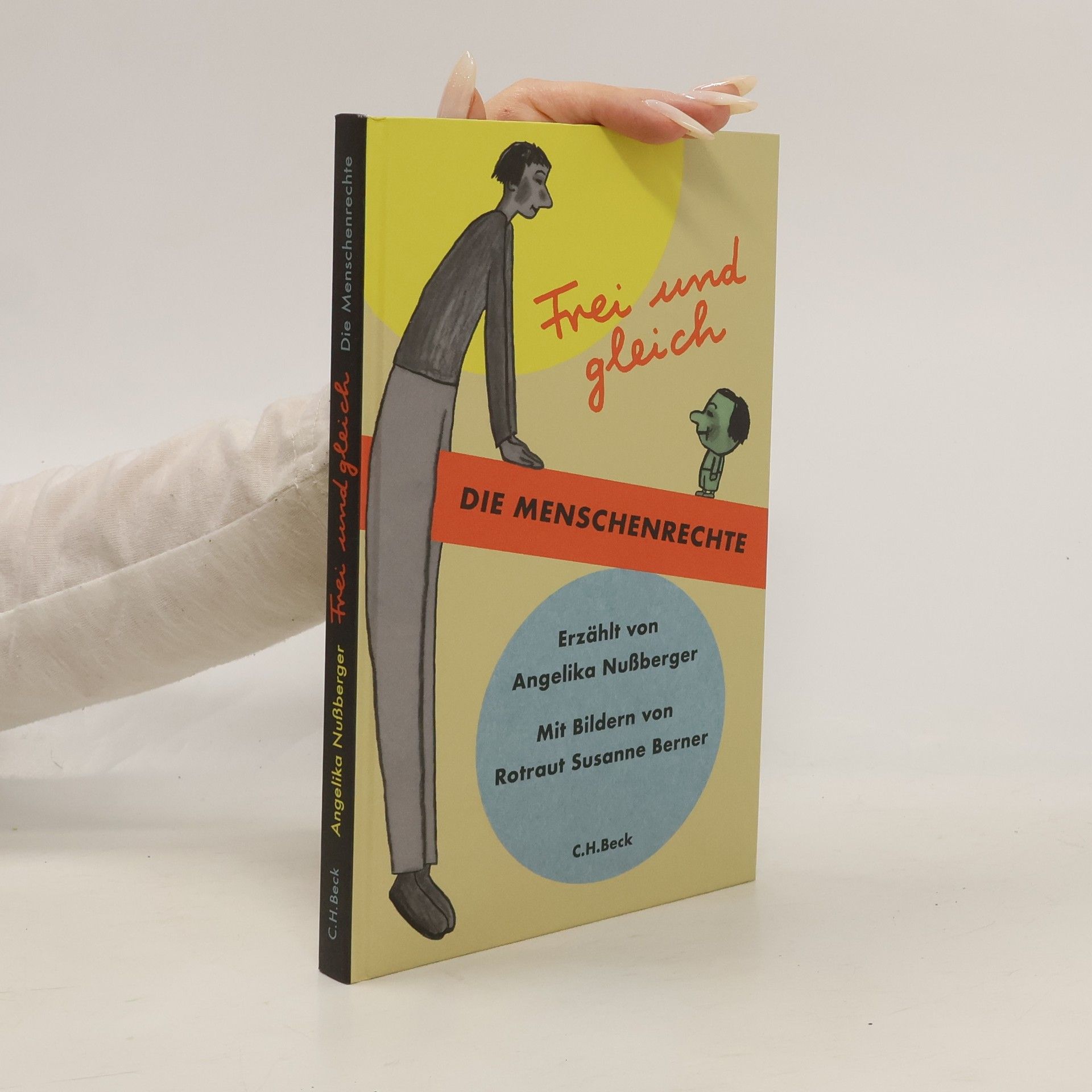



Die Menschenrechte
Geschichte, Philosophie, Konflikte
"ALLE MENSCHEN SIND FREI UND GLEICH AN WÜRDE UND RECHTEN GEBOREN" - ARTIKEL I DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE Was in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 so selbstverständlich klingt, ist bis heute für unzählige Menschen keine Wirklichkeit. Angelika Nußberger beschreibt anschaulich die Geschichte der Menschenrechte, ihre philosophischen Grundlagen sowie die aktuellen Debatten: Gibt es ein Menschenrecht auf Frieden und Umweltschutz? Wie universal gelten die Rechte? Und in welchem Maße dürfen Gerichtshöfe für Menschenrechte die Gesetzgebung einzelner Staaten bestimmen? Doch bei allen Fragen steht fest: In einer vernetzten Welt wird die Bedeutung der Menschenrechte weiter zunehmen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
- 200 Seiten
- 7 Lesestunden
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) spielt eine zunehmend bedeutende Rolle im Grundrechtsschutz in Deutschland. Das Buch bietet eine umfassende Analyse der Organisation, internen Strukturen und Verfahrensweisen des EGMR sowie seiner Urteile und deren Auswirkungen. Es beleuchtet die Geschichte des EGMR, dessen zukünftiges Potenzial und die Interaktion mit nationalen und internationalen Rechtssystemen. Praktische Erfahrungen werden wissenschaftlich fundiert zusammengetragen und in sechs Kapitel gegliedert, die eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen.
In „Eine Richterin erklärt die Menschenrechte“ erläutert Angelika Nußberger anhand wahrer Geschichten die Bedeutung von Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit. Illustriert von Rotraut Susanne Berner, wird komplexe Thematik greifbar. Ein ansprechendes Buch für alle ab 12, das zum Nachdenken und Engagement für Menschenrechte anregt.
Blickwechsel
Aus einem Tagebuch von März bis Oktober 2020 – Texte und Gouachen
Die Zukunft schien lange planbar. Sie ist es nicht mehr - wie COVID-19 das Selbstverständliche am Leben entgleiten ließ.Eine Juristin, Völkerrechtlerin und ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ein bildender Künstler blicken aus wechselnden Perspektiven auf die Eindrücke der allumfassenden, uns alle betreffenden Ereignisse seit Mitte März 2020. Das Buch verbindet den analytischen und fragenden Blick der Wissenschaftlerin mit der künstlerischen Alltagswahrnehmung. Gedanken und Gefühle, die sich aus beiden Blickrichtungen ergeben, treten in eine Wechselbeziehung, in der man sich betrachtend und lesend wiederfindet.
Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg
Besichtigung einer Epoche
Erinnert sich noch jemand an das »gemeinsame europäische Haus«? An Gorbatschows Traum von einem Europa, das von Lissabon bis nach Wladiwostok reicht? Der Graben, der heute, dreißig Jahre nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, Russland von seinen westlichen Nachbarn trennt, ist tiefer als je zuvor. In der Ukraine herrscht Krieg, in Belarus Staatsterror. Innerhalb der EU werden Bruchlinien entlang der alten Grenze sichtbar. Verfassungsänderungen bedrohen in Polen und Ungarn die erst jüngst erkämpfte Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Vieles spricht dafür, dass wir an einer Epochenschwelle stehen. Wie konnte es dazu kommen? Gut dreißig Jahre nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in Osteuropa werfen die Autoren einen kritischen Blick zurück – in einer gemeinsamen Anstrengung, von Erfahrung und Anschauung gesättigt und entsprechend erkenntnisreich.
The Fritz Thyssen Foundation continues its tradition with the “Thyssen Lectures,” initiated in Germany in 1979 and expanded to various universities in the Czech Republic, Israel, Russia, and Turkey. In Greece, the series will unfold over four years under Prof. Vassilios Skouris, former President of the European Court of Justice and current Director of the Centre of International and European Economic Law (CIELL). The focus is on “the EU as a community of European law and values.” The principle of democracy, while serving as the foundation for state power globally, faces significant threats. Authoritarian regimes like Russia, China, and Turkey exhibit increasing power concentration, while even established democracies encounter serious challenges. The internationalization of decision-making, once seen as progress, is now criticized as “undemocratic.” Additionally, reliance on expert knowledge raises concerns, and countering populist trends proves difficult. These issues prompt a critical examination of what new principles may be necessary for democratic governance in the 21st century.
Unsere Welt wächst zusammen und braucht mehr denn je internationale Regeln für militärische Konflikte sowie den Kampf gegen Terror und Menschenrechtsverletzungen. Angelika Nußberger schildert Geschichte und zentrale Konzepte des Völkerrechts, geht auf neueste Entwicklungen wie die internationale Strafgerichtsbarkeit und das Umweltvölkerrecht ein und stellt die Frage nach der Einheit des Völkerrechts in einer kulturell heterogenen Welt.
The European Court of Human Rights
- 256 Seiten
- 9 Lesestunden
Nussberger traces the history of the European Court of Human Rights from its political context in the 1940s to the present day, answering pressing questions about its origins and workings. This first book in the Elements of International Law series, provides a fresh, objective, and non-argumentative approach to the European Court of Human Rights.