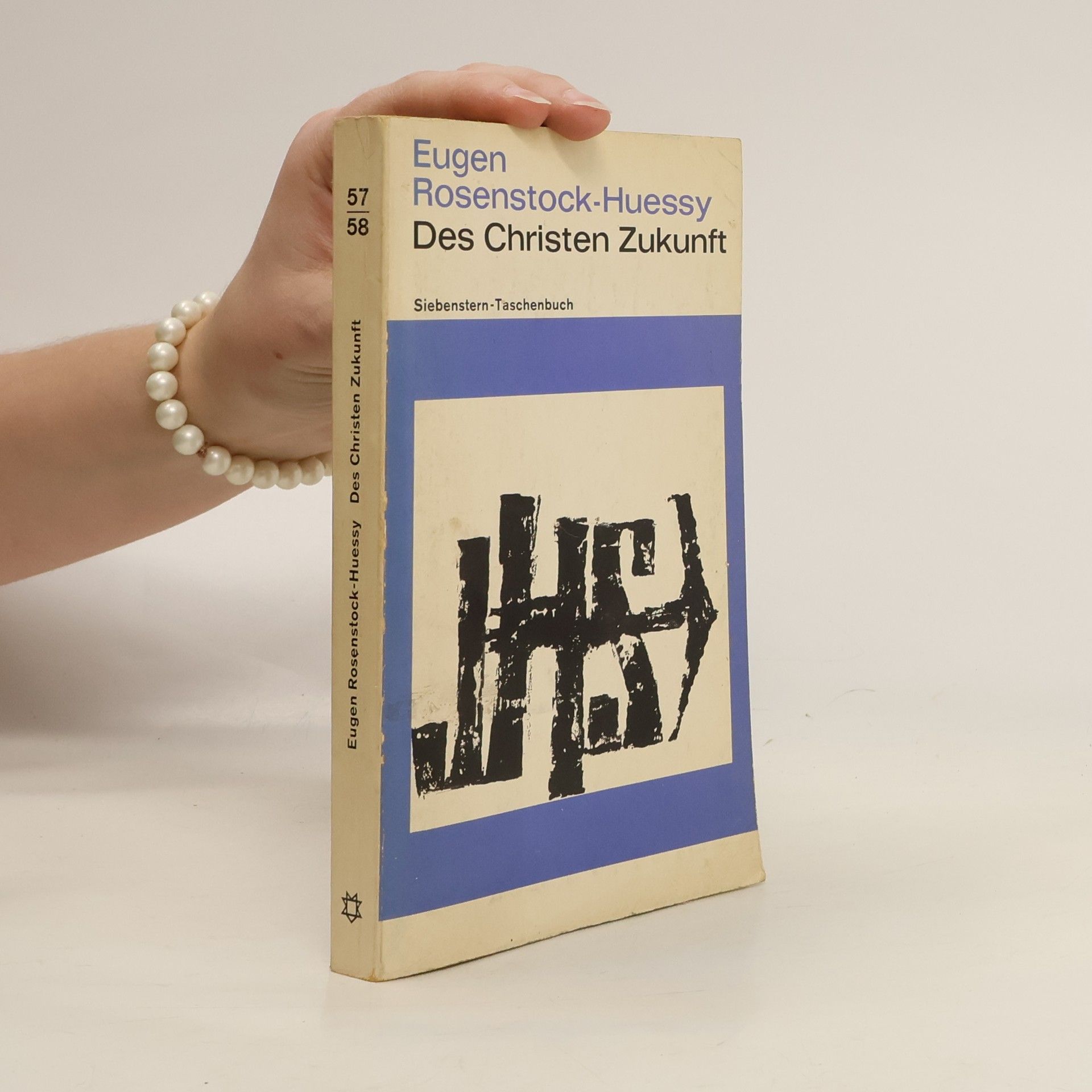In this first English translation of Eugen Rosenstock-Huessy's Soziologie, the author critiques the dominance of abstract, spatially-based categories in social philosophy, advocating instead for a focus on temporal processes that shape social organization. He contends that this shift in perspective is crucial for understanding the dynamics of society. The book offers a fresh lens on sociological thought, encouraging readers to reconsider how they conceptualize social structures and their evolution over time.
Eugen Rosenstock-Huessy Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
Eugen Rosenstock-Hüssy war ein Historiker und Sozialphilosoph, dessen Denken Geschichte, Theologie, Soziologie und Linguistik umfasste. Seine Arbeit konzentrierte sich darauf, wie Sprache und Rede den menschlichen Charakter und die Fähigkeiten in sozialen Kontexten prägen. Als Denker, der das postnietzscheanische religiöse Denken wiederbelebte, untersuchte Rosenstock-Hüssy die Grundlagen der westlichen Kultur und ihrer liberalen Fundamente, insbesondere nach seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Seine Schriften, beeinflusst durch seine persönliche Hinwendung zum Christentum, beschäftigten sich oft mit Interpretationen dieses Glaubens. Er lehrte an Universitäten in den Vereinigten Staaten, und sein Werk beeinflusste die moderne Begegnung von Judentum und Christentum.
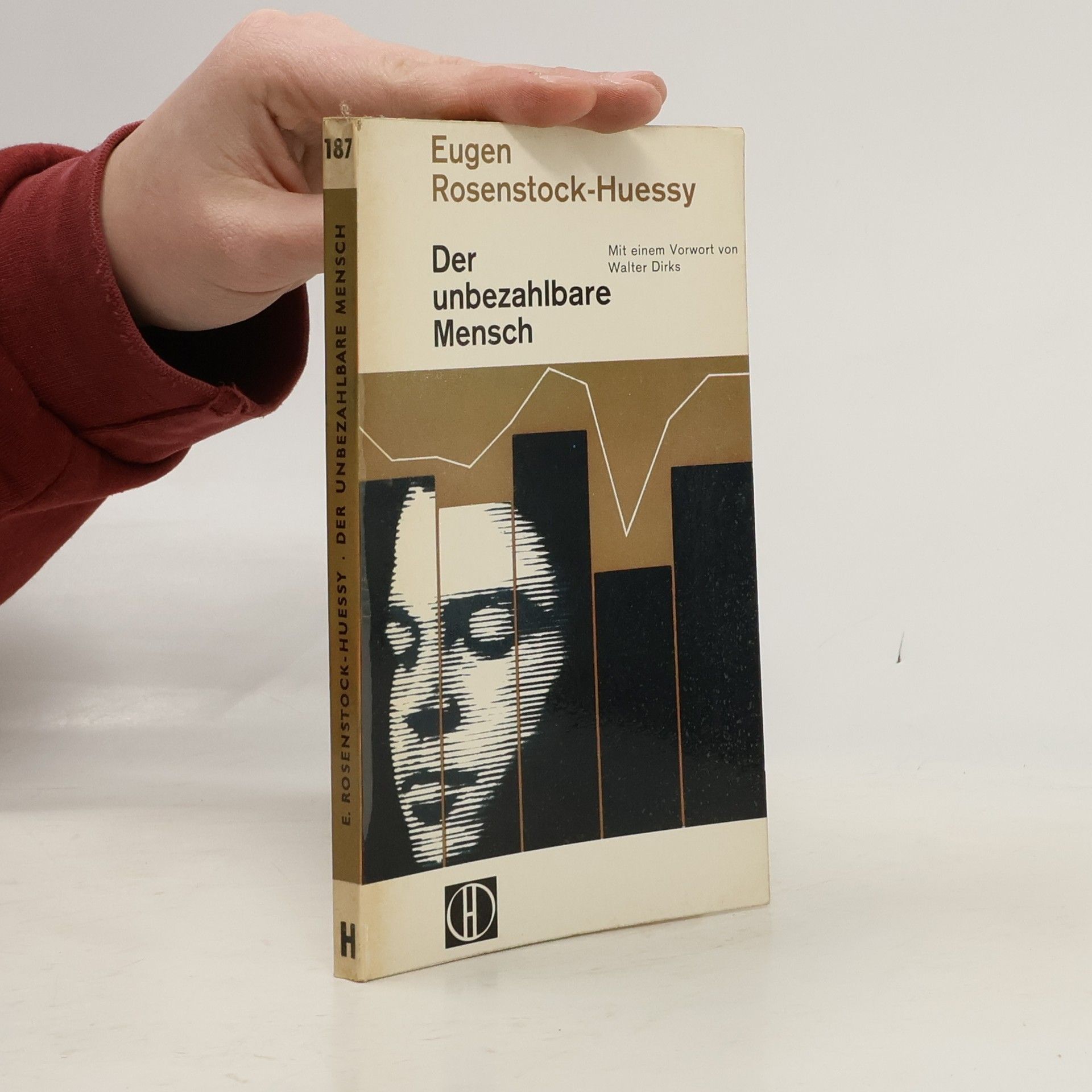
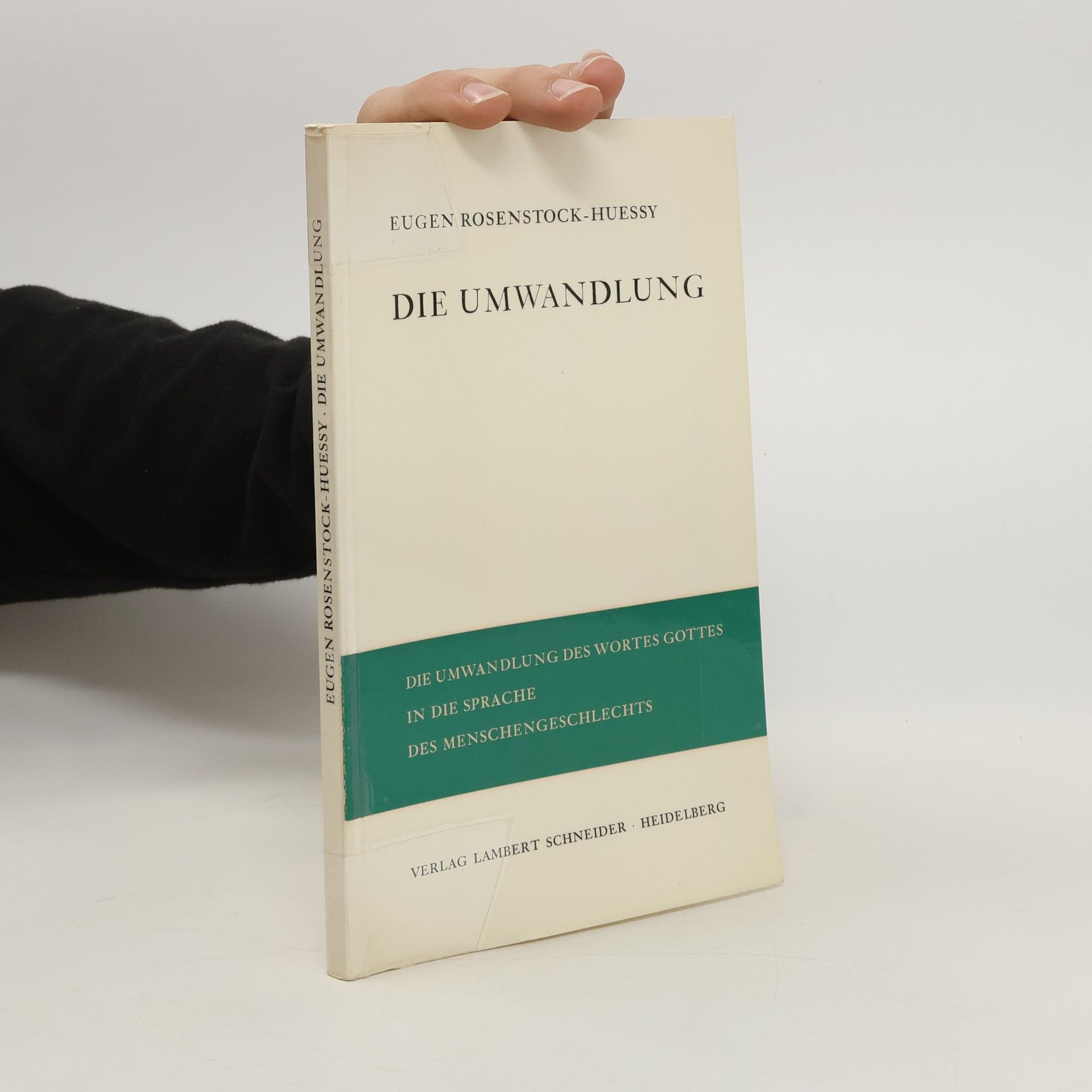

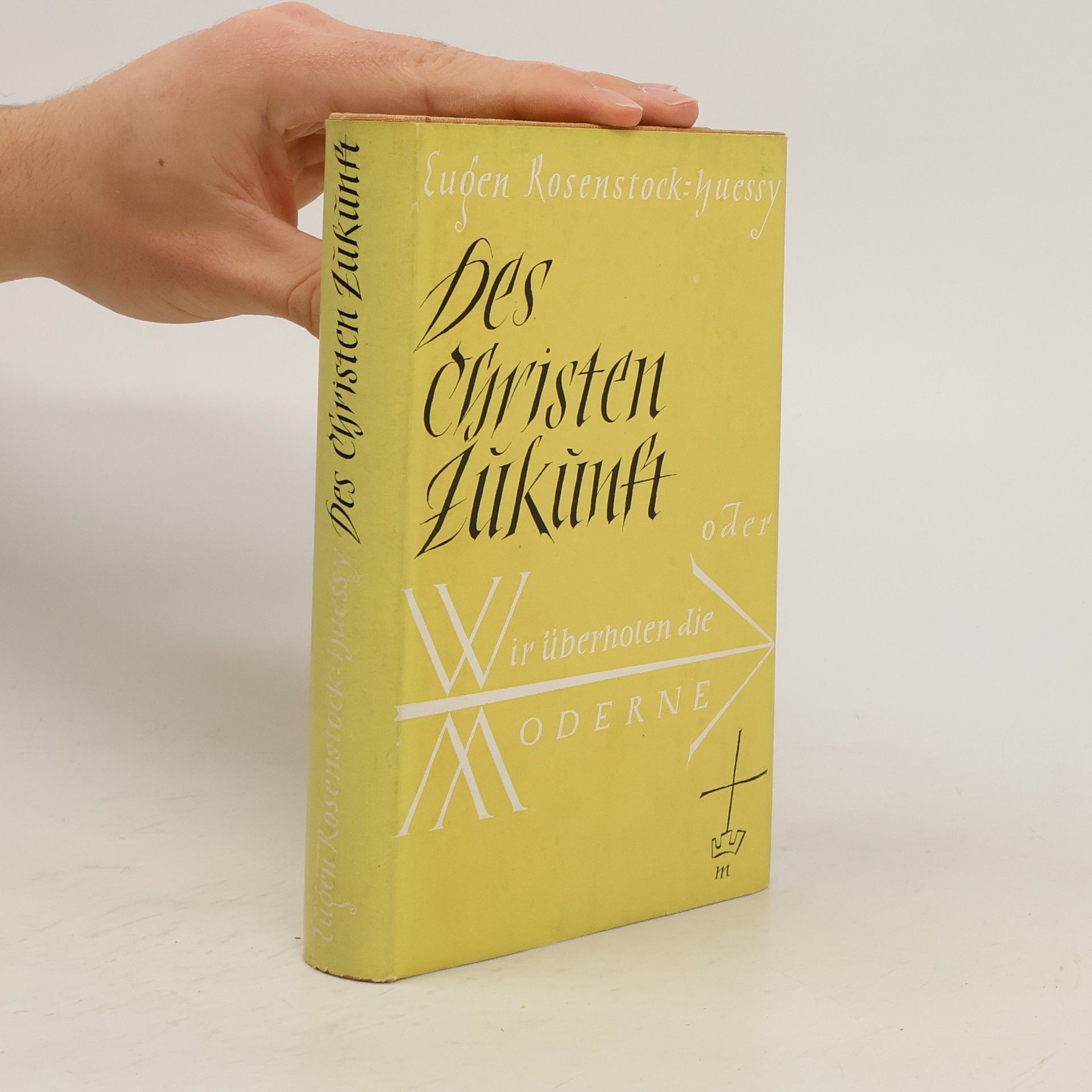
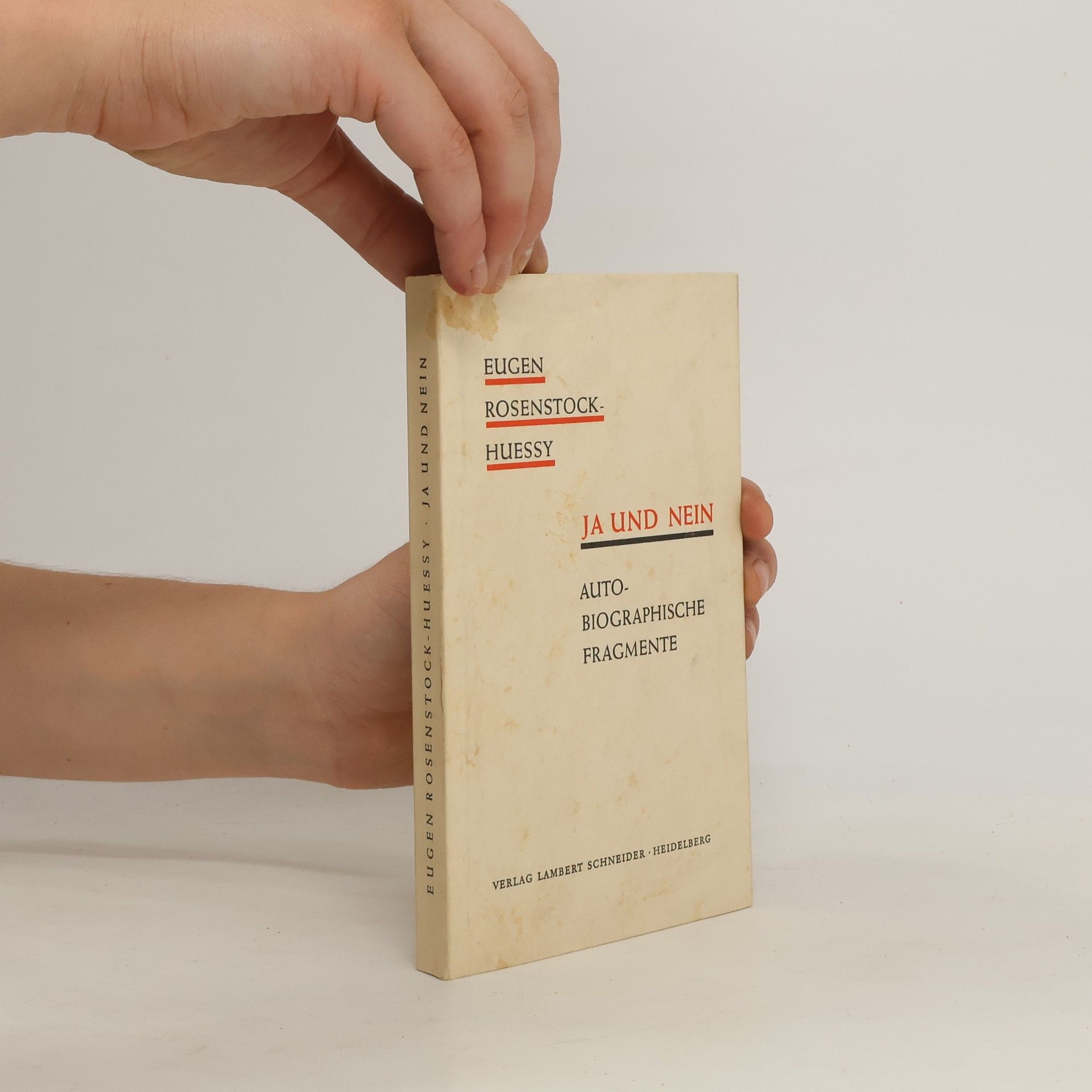
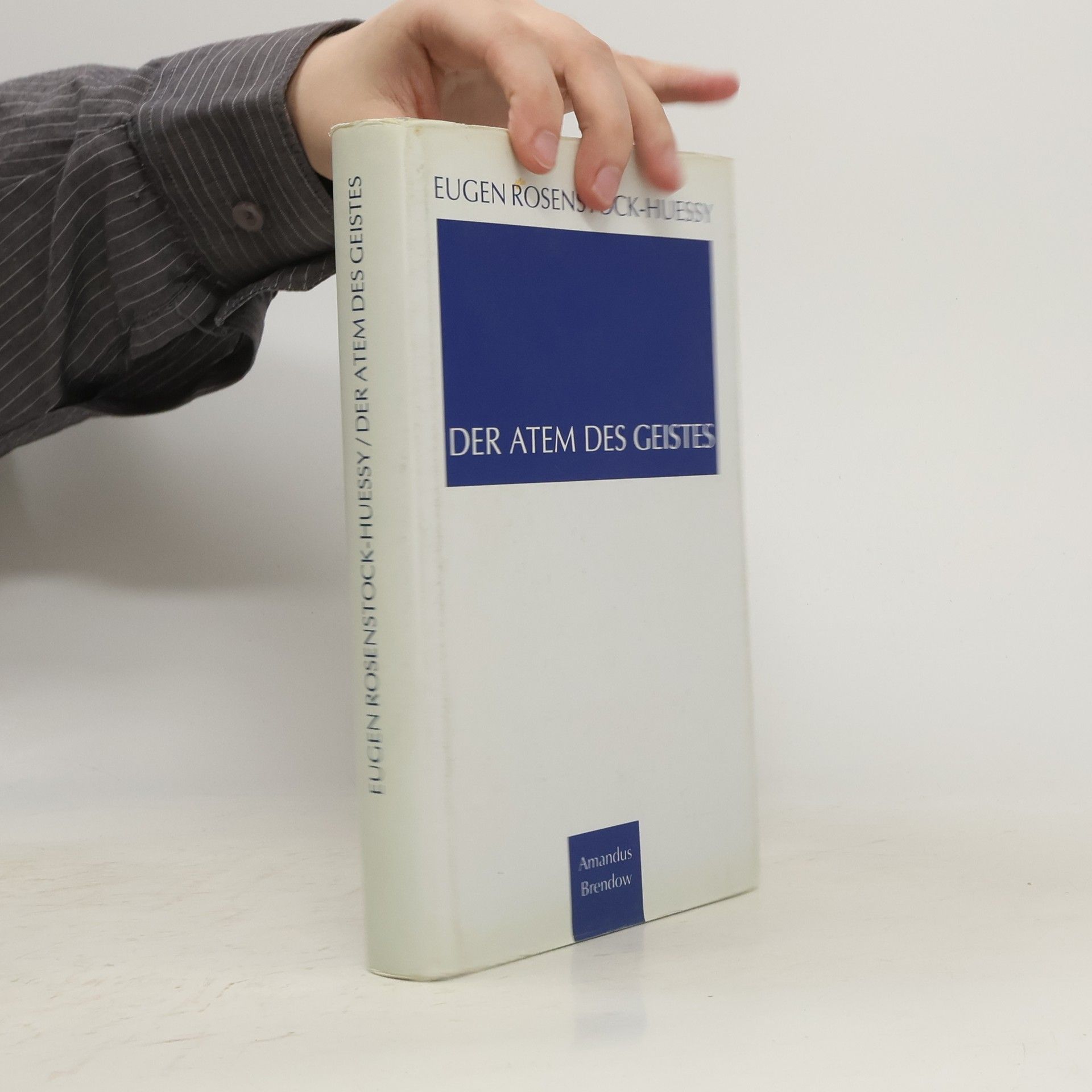
Der Band präsentiert Texte von Eugen Rosenstock-Huessy, die weitgehend in Vergessenheit geraten sind: „Die Kopernikanische Wendung der Grammatik“ (1944) kann als Schlüsseltext gelten, wie ein Umdenken in der Sprachphilosophie vollzogen werden kann. Das „Liturgische Denken“ (1949) wirft unter anderem einen kritischen, aber nicht abwertenden Blick auf die Naturalisierung des Menschen durch die Wissenschaften und ist von daher nicht nur grundlegend, sondern auch aktuell. Der Text „Im Prägstock eines Menschenschlags oder der tägliche Ursprung der Sprache“ (1964) kann als die Summe des sprachphilosophischen, vielleicht sogar des gesamten Denkens von Eugen Rosenstock-Huessey gesehen werden. Der Aufsatz „Angewandte Seelenkunde“ (1916/1923) schließlich, der hier verkürzt wiedergegeben wird, kann als Gründungsdokument des dialogischen oder grammatischen Denkens bezeichnet werden.
Der Atem des Geistes
- 294 Seiten
- 11 Lesestunden
Ja und nein
autobiographische Fragmente