Das Werk bietet eine grundlegende Einführung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft und stellt damit für jeden Studierenden einen unentbehrlichen Begleiter in dieser Disziplin dar. Auch die Neuauflage vermittelt den Lehrstoff in der bewährt didaktisch aufbereiteten Weise mit zahlreichen Abbildungen, Tabellen, Schemata sowie Kontrollfragen und setzt damit den Studierenden in die Lage, sich im selbständigen Studium einzelne Bereiche dieses komplexen Wissensgebietes bereits vor der jeweiligen Lehrveranstaltung anzueignen. Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen, Fachhochschulen und Akademien
Klaus-Dirk Henke Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
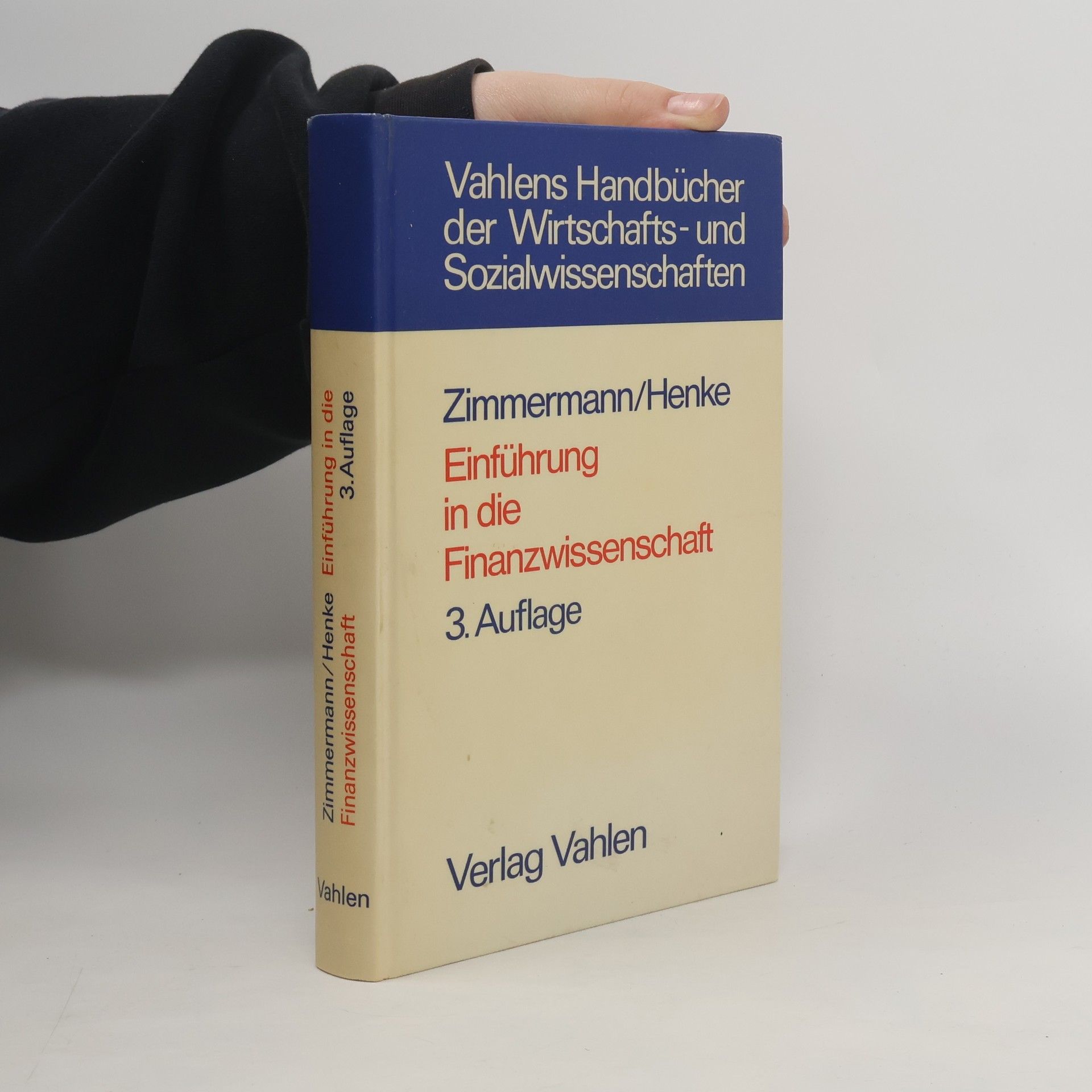
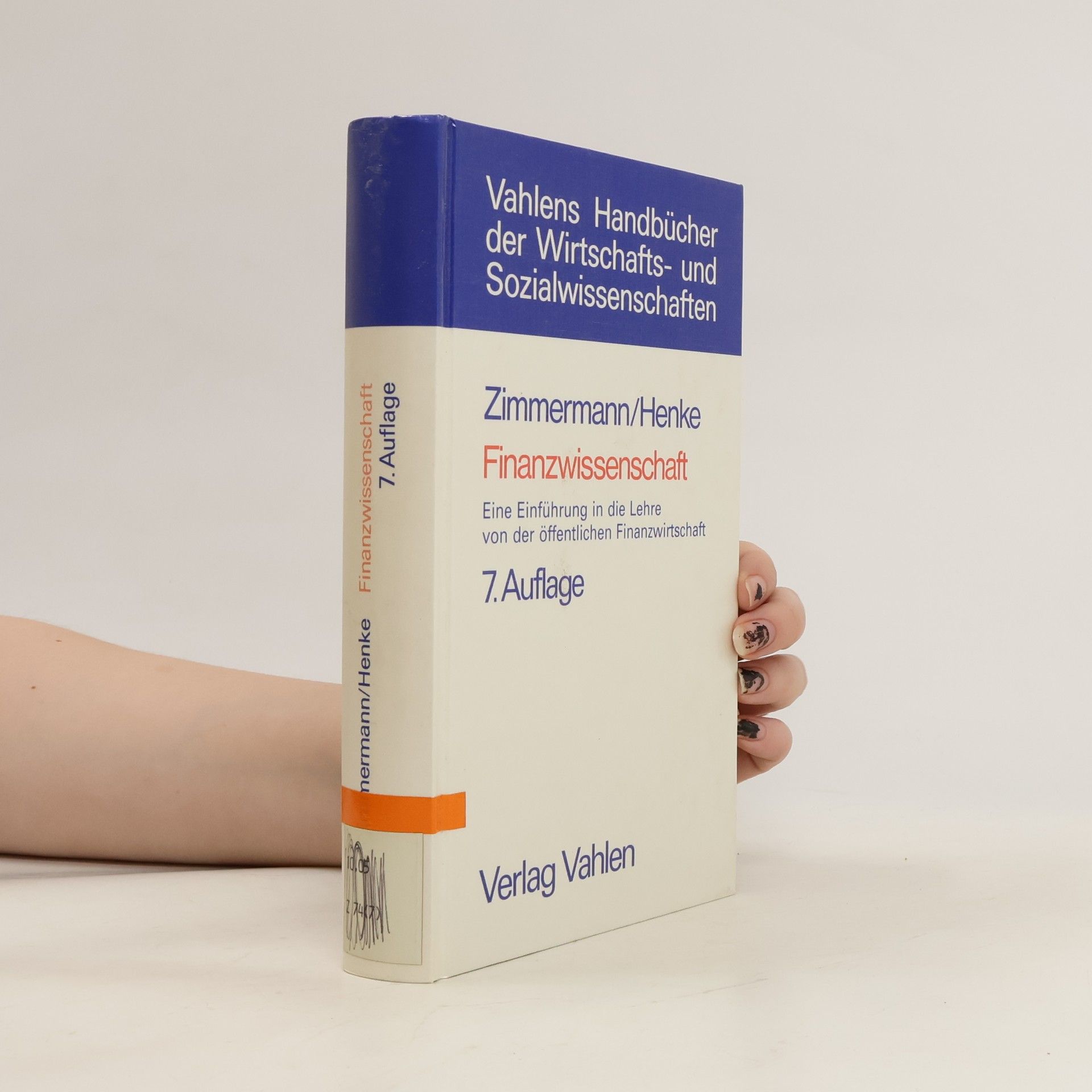
Finanzwissenschaft
Eine Einführung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft - 3. Auflage
- 401 Seiten
- 15 Lesestunden