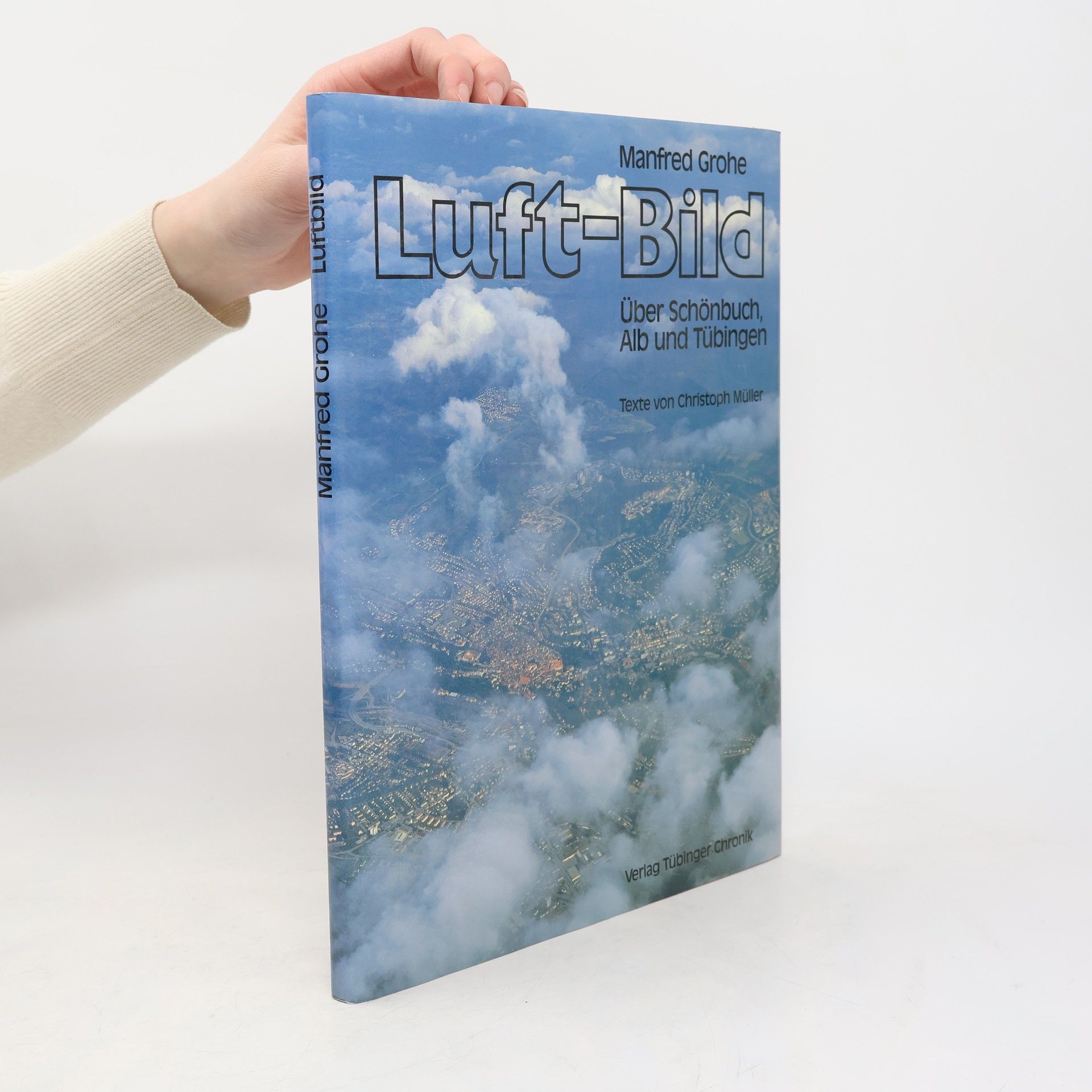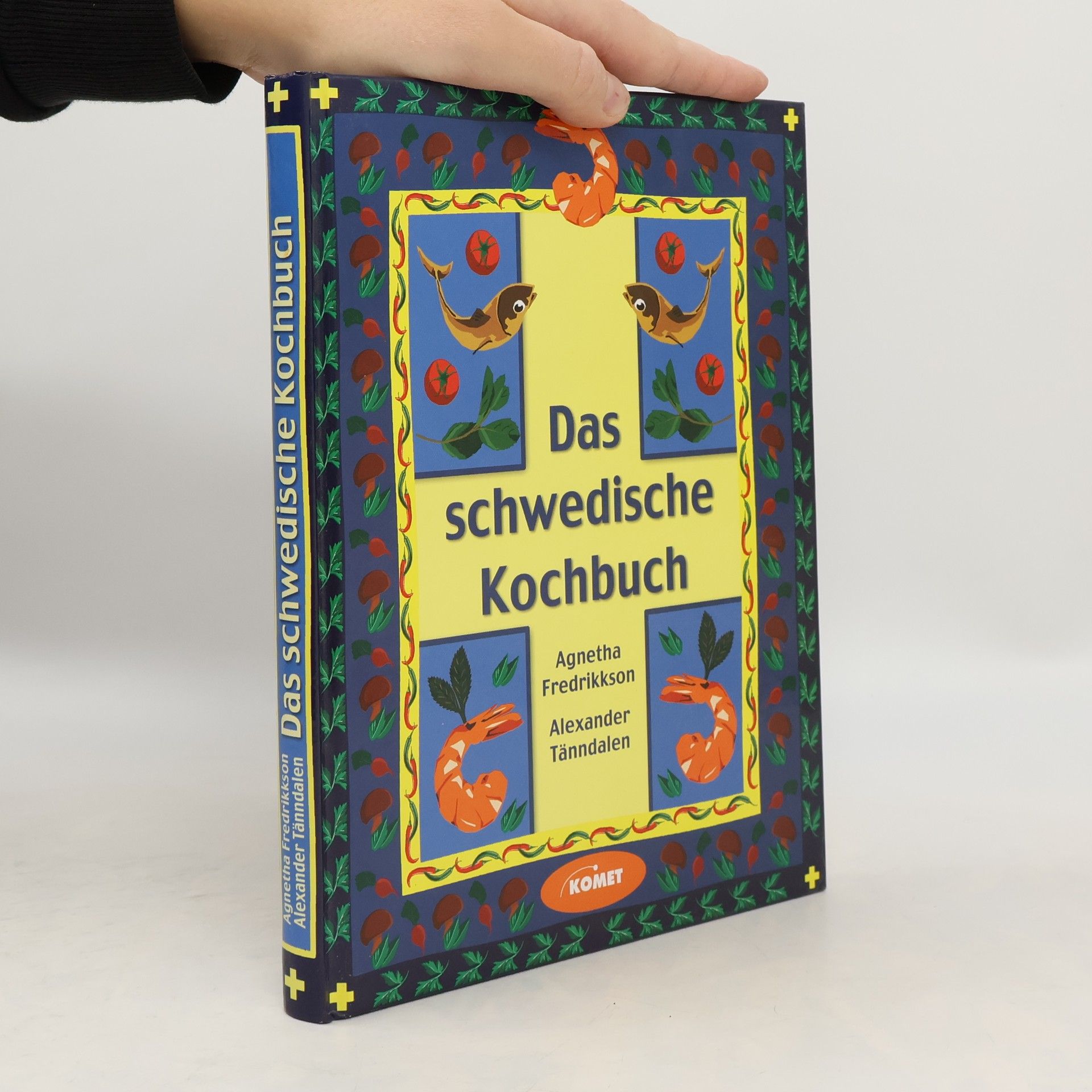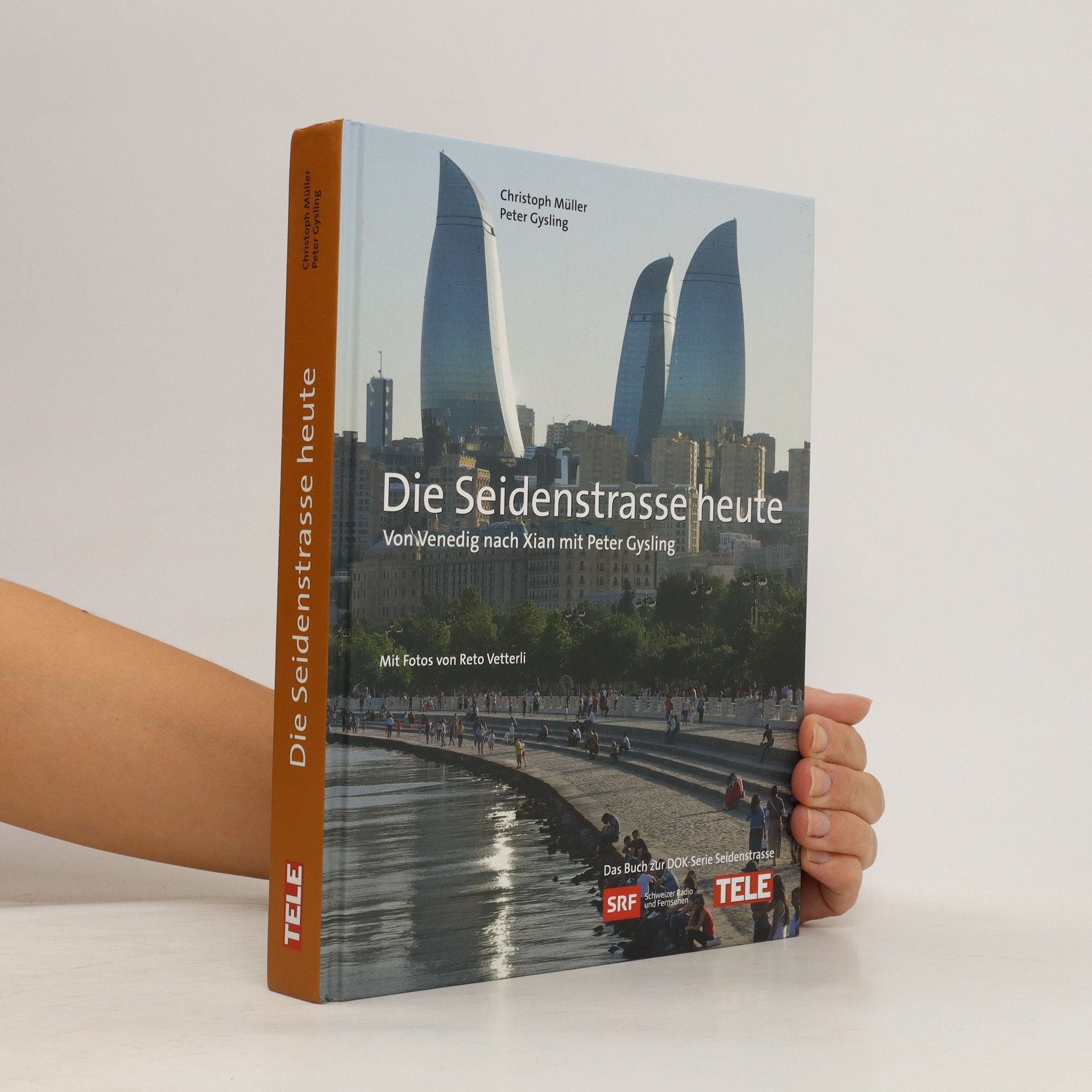Tibet-Teppiche aus Kathmandu, Pokhara und Chialsa
Paradigmenwechsel in der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit mit Nepal – oder wie aus tibetischen Nomaden erfolgreiche Unternehmer wurden
Bis Mitte der 1990er Jahre erlebte Nepals Teppichindustrie eine nie dagewesene Blütezeit mit von Hand geknüpften Teppichen als wichtigem Exportgut. Warum aber war es ausgerechnet der Tibet-Teppich, der den Ausschlag zu dieser Entwicklung gab? Der Zürcher Ethnologe Christoph Müller verfolgt in seiner Monographie die Entwicklung der Teppichproduktionszentren von Kathmandu, Pokhara und Chialsa. Dort gelang es der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in den 1960er Jahren mit dem Programm SATA Handicraft Centers , den seit 1959 ankommenden tibetischen Flüchtlingen ein wirtschaftliches Auskommen zu bieten. Mittels auf den Export ausgerichteter Maßnahmen legte man auch die Grundlagen für den Aufschwung der Teppichindustrie Nepals. Auf diese Weise entstand ein bedeutender Paradigmenwechsel in der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit und bewirkte die Transformation von der individuellen Auftragsarbeit zur kommerziell organisierten Produktion. Was einst kulturell eingebettete anspruchsvolle Handwerkskunst war, in der das Können einzelner und dessen Weitergabe wichtig waren, wandelte sich zur anonymen Fabrikation, die sich den Bedürfnissen eines internationalen Marktes anpasste. Diese Weiterentwicklung der Teppichproduktionszentren hatte wiederum vielfältige Auswirkungen auf die zunächst noch traditionelle Gesellschaft in den tibetischen Siedlungen.