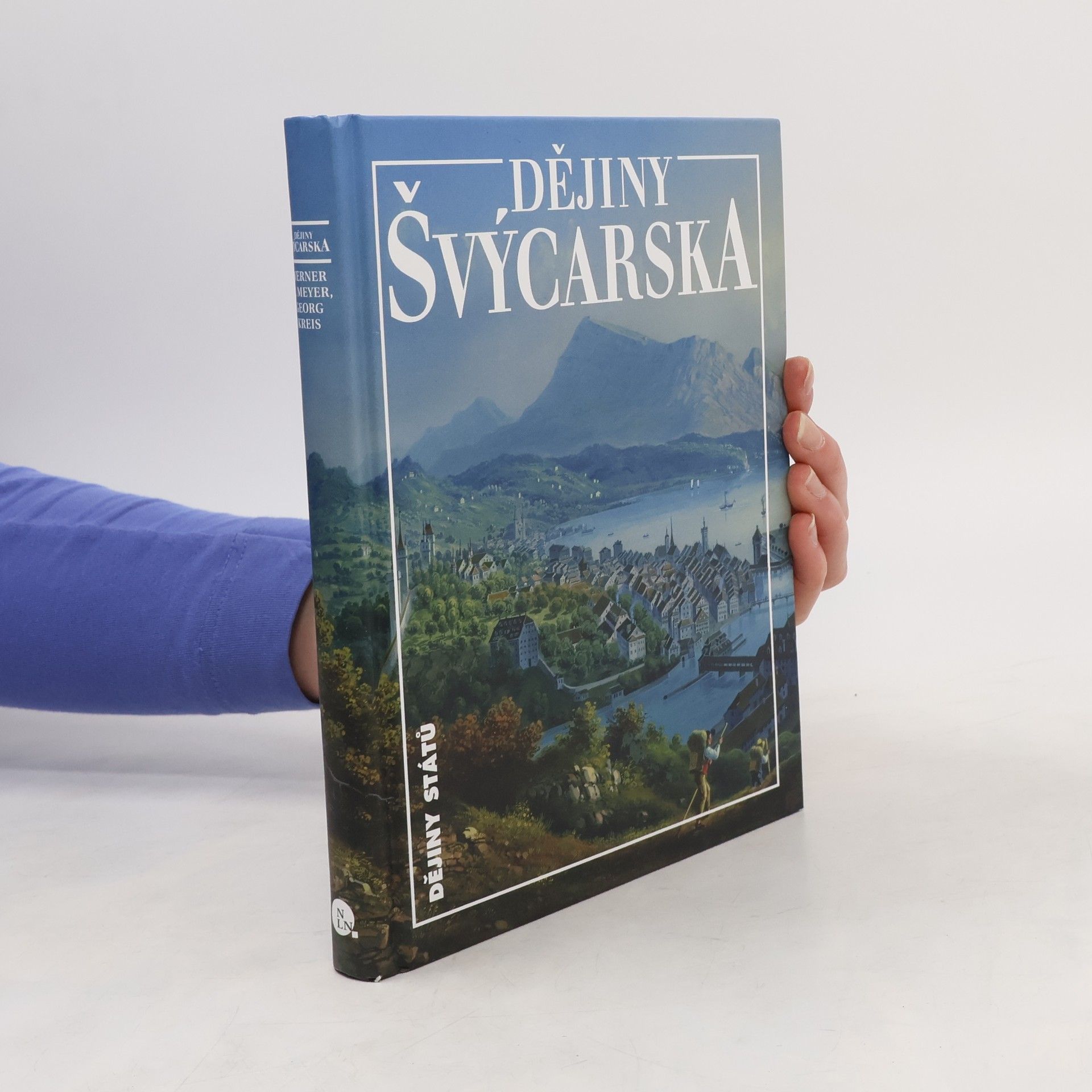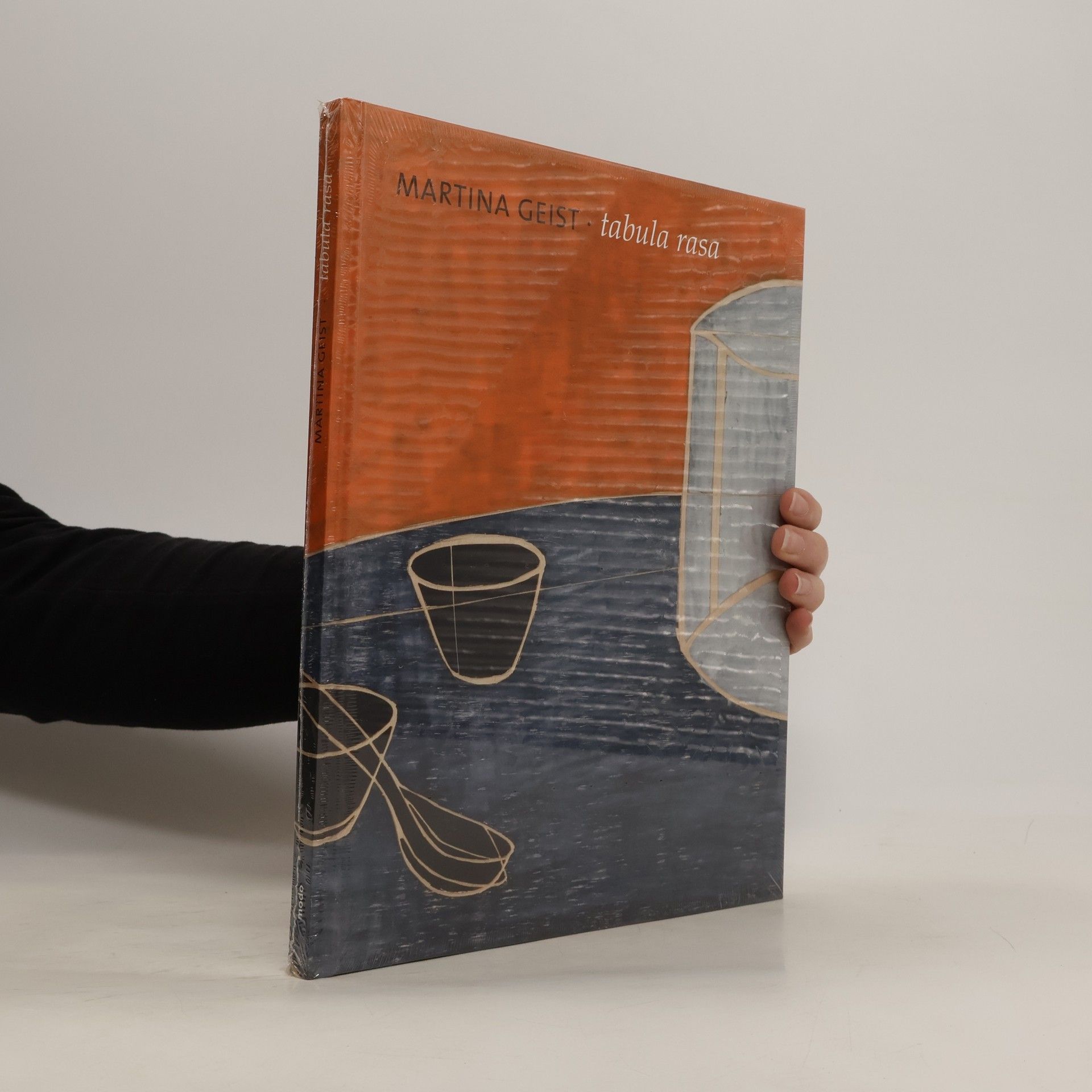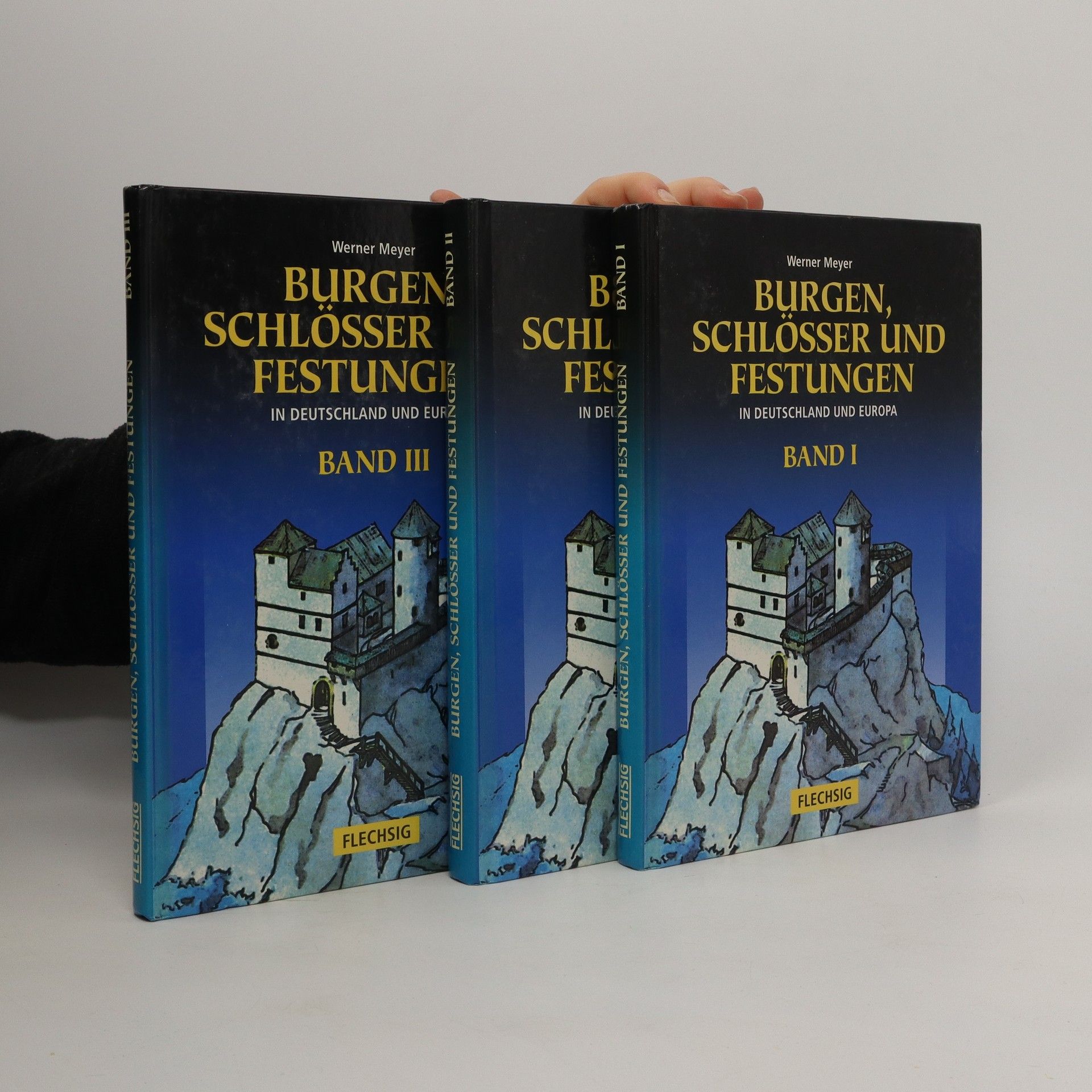Ein Krieg in Bildern und Versen
Der Schwaben- oder Schweizerkrieg von 1499, geschildert von einem Zeitgenossen
- 160 Seiten
- 6 Lesestunden
Die Reimchronik von Niclas Schradin bietet eine fast zeitgenössische Schilderung des Schwabenkriegs von 1499, ergänzt durch 27 Holzschnitte. Anders als bei vielen historischen Berichten wird hier der Konflikt unmittelbar nach dessen Beendigung dokumentiert, was wertvolle Einblicke in die politischen und kulturellen Auswirkungen des Krieges ermöglicht. Werner Meyer ergänzt die Neuausgabe mit einem Kommentar, der nicht nur Schradins Leben und Werk beleuchtet, sondern auch die größeren machtpolitischen Zusammenhänge der Zeit thematisiert. Ein faszinierendes und informatives Sachbuch!


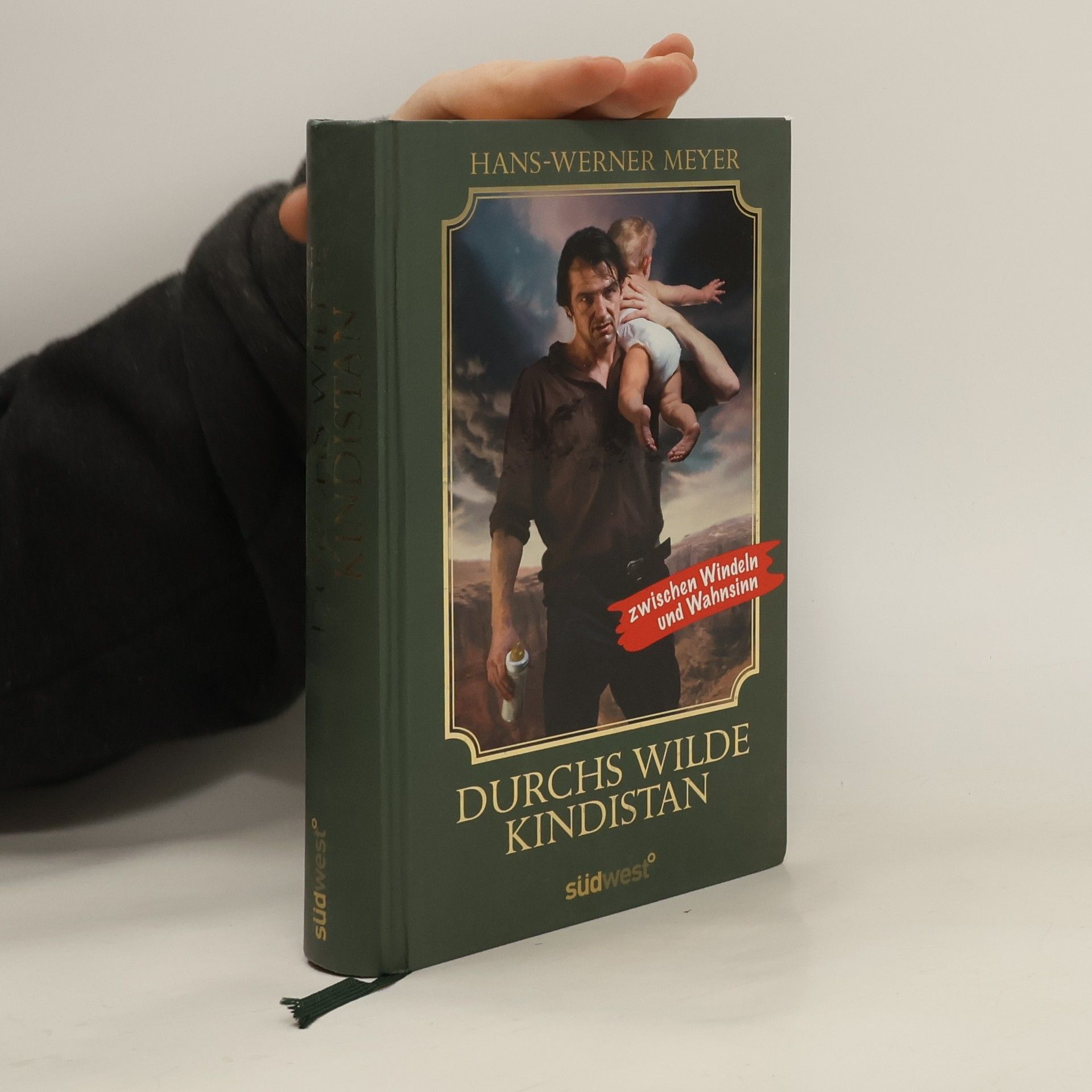
![Der Orwell-Staat 1984 [neunzehnhundertvierundachtzig]](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/75191724.jpg)