Wie lässt sich der Schulalltag für alle Schülerinnen und Schüler im Sinne einer inklusiven Schule gestalten? Wie können Schulen sich zu einer inklusiven Schule weiterentwickeln? Wie kann Kooperation hierbei sinnvoll genutzt werden? Wie können sich Pädagoginnen und Pädagogen professionalisieren, um den Anforderungen einer inklusiven Schule gerecht zu werden? Der Band 'Gemeinsam unterwegs zur inklusiven Schule' möchte Pädagoginnen und Pädagogen ermutigen, aufzubrechen bzw. den vielleicht schon eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Inklusive Schule entwickelt sich in der konstruktiven Auseinandersetzung und in kleinen Schritten. Erkenntnisse aus der Forschung und Erfahrungen aus der Praxis bzw. der Aus- und Fortbildung können dabei helfen, offene Fragen zu klären, Probleme zu benennen und Lösungen zu entdecken.
Susanne Peters-Schildgen Bücher
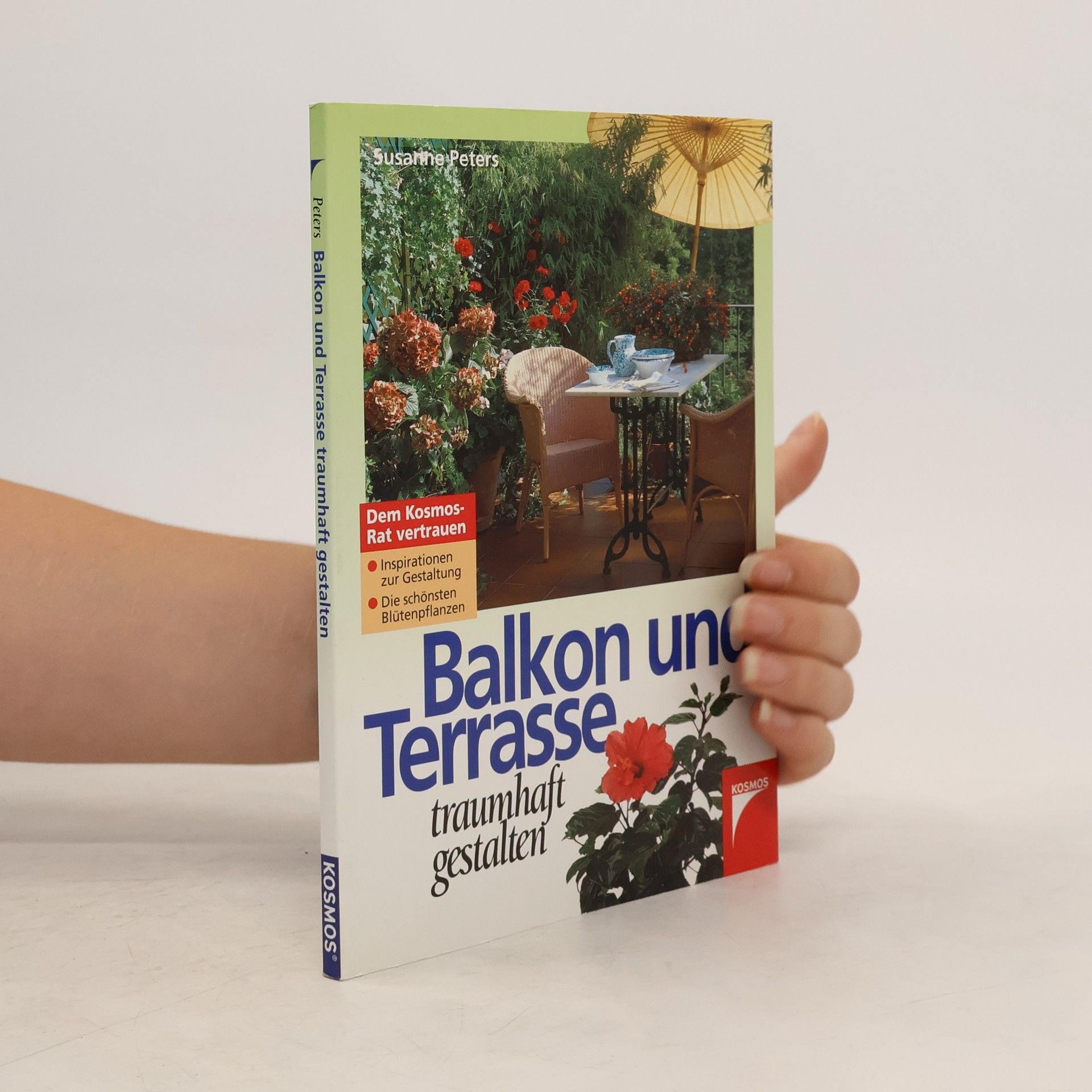
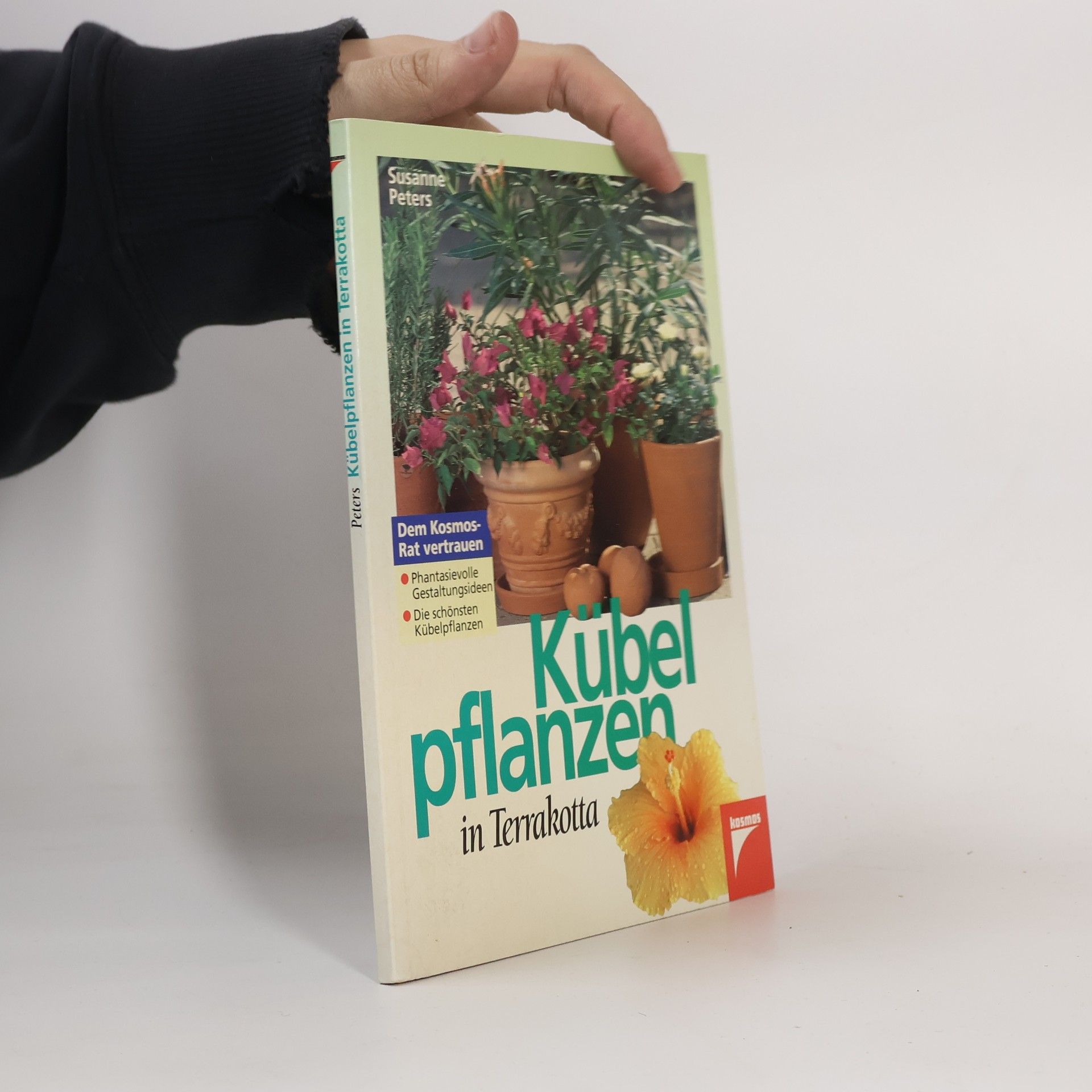
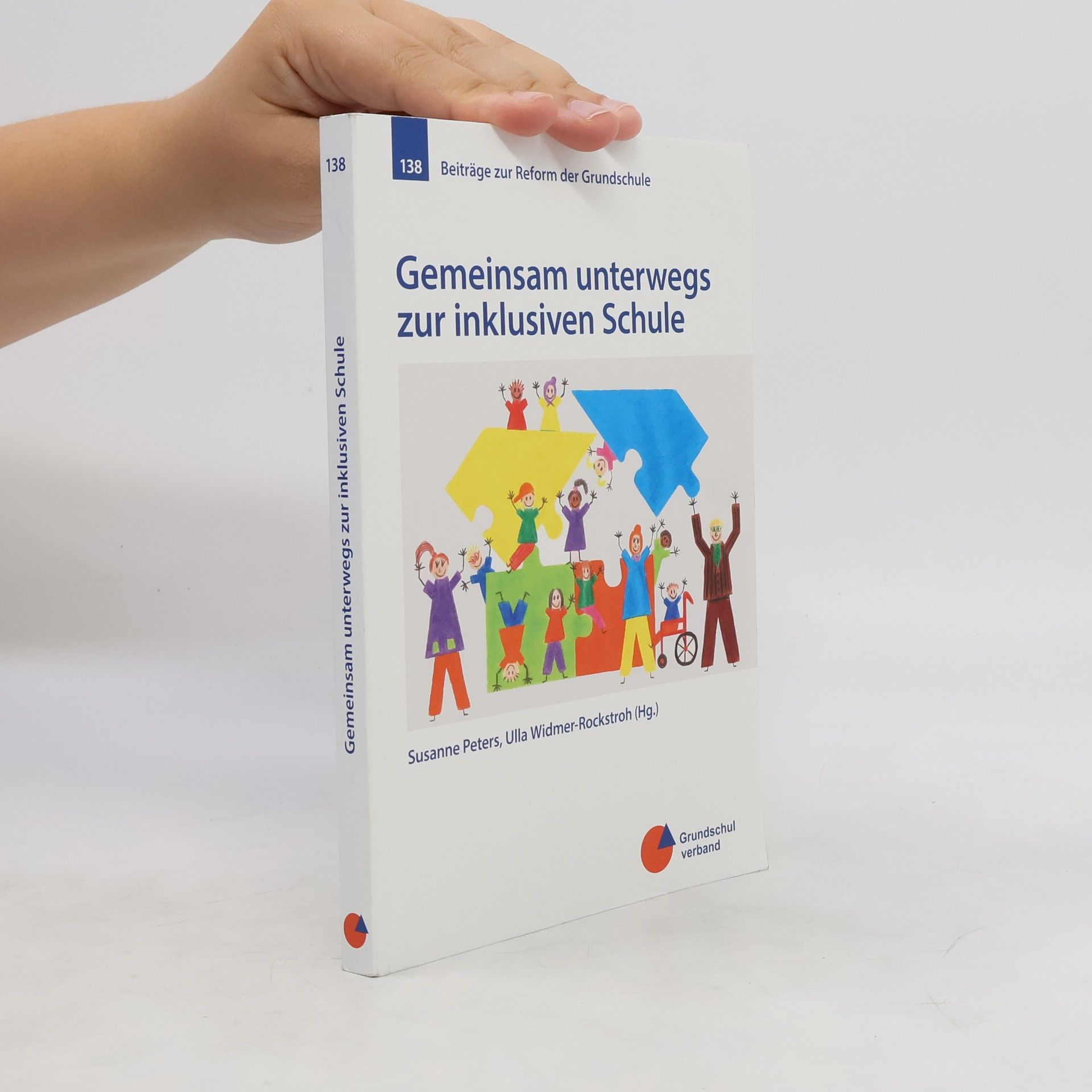
Kübelpflanzen in Terrakotta
- 64 Seiten
- 3 Lesestunden
Balkon und Terrasse traumhaft gestalten
- 62 Seiten
- 3 Lesestunden