Christliche Ethik in moderner Gesellschaft. Band 2, Lebensbereiche
- 445 Seiten
- 16 Lesestunden
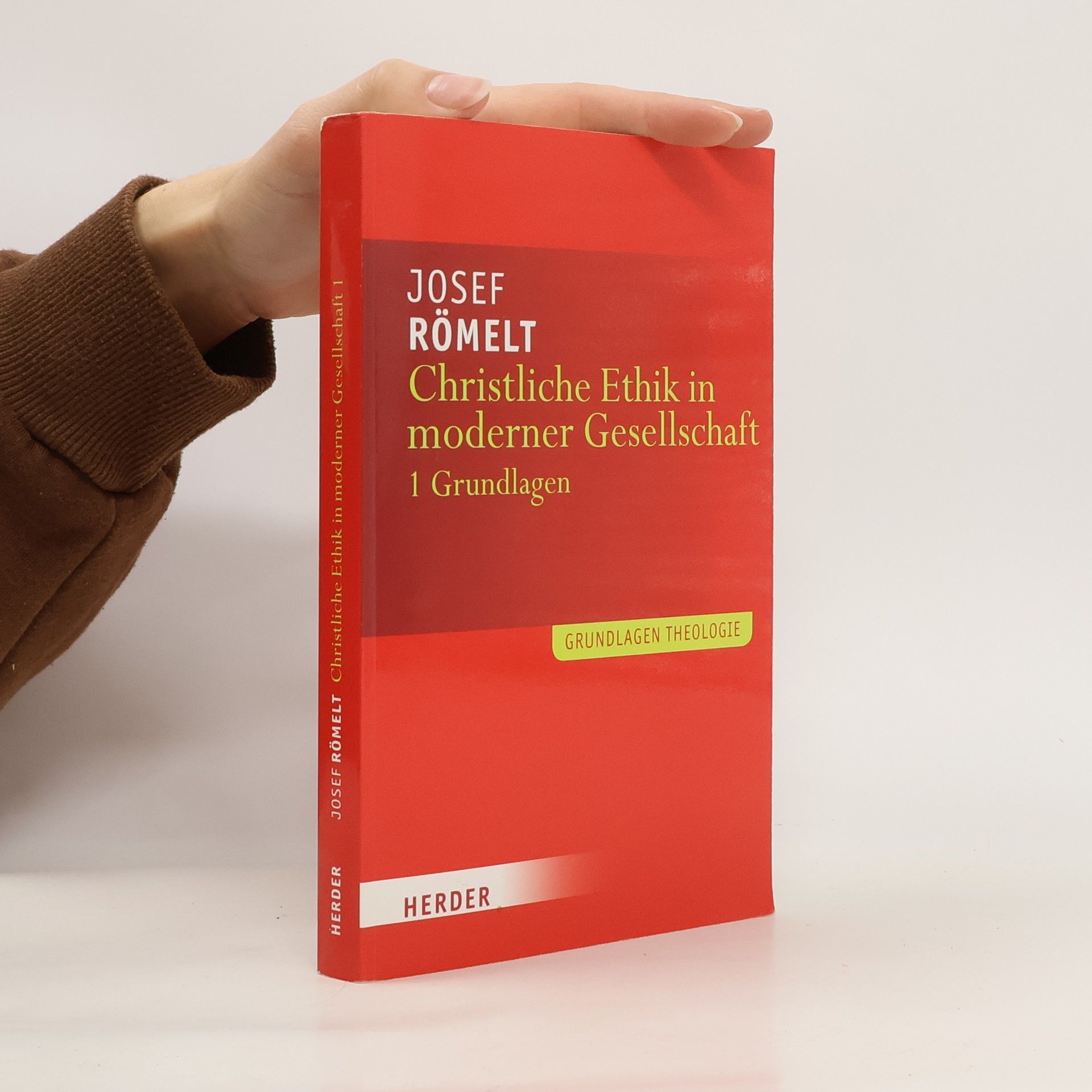
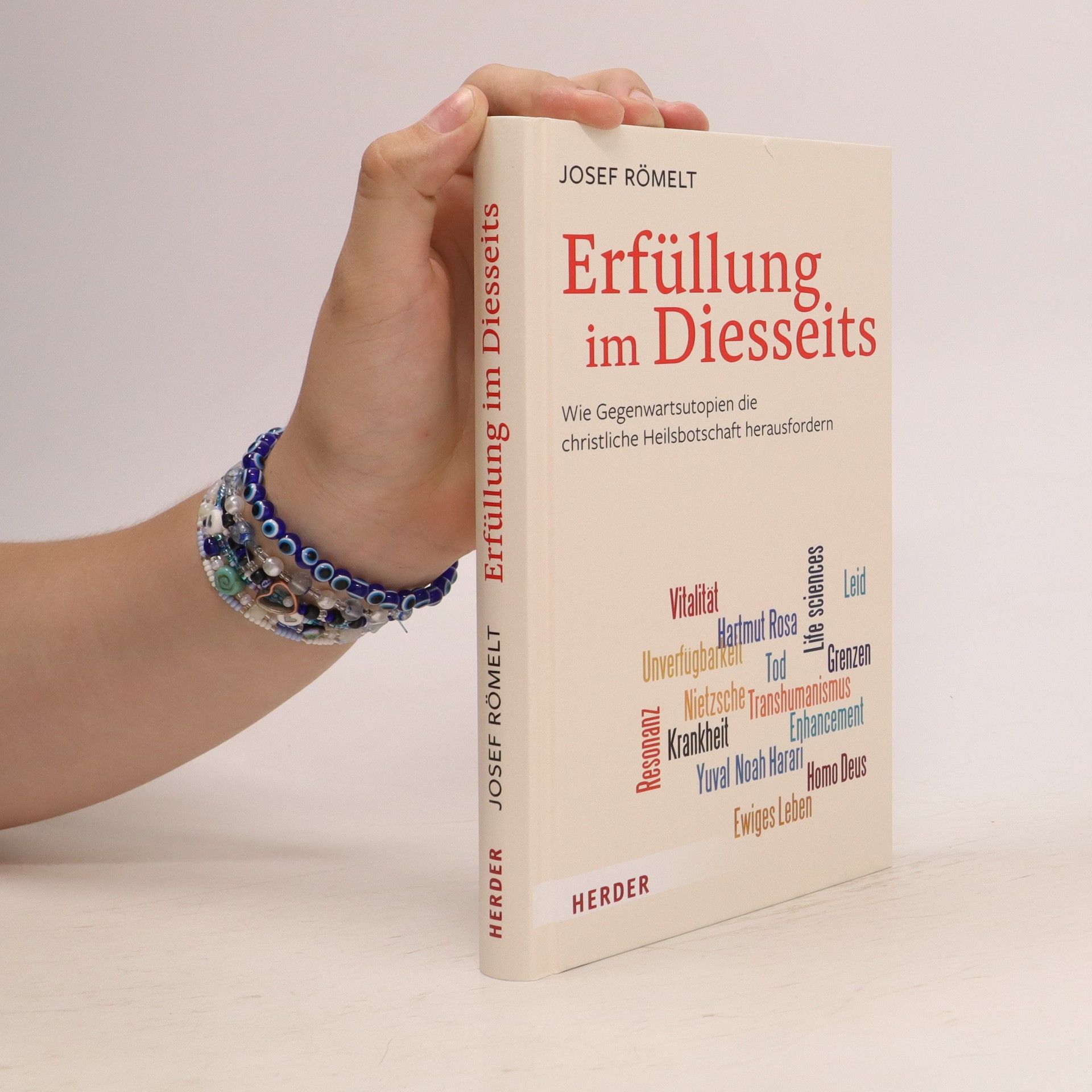


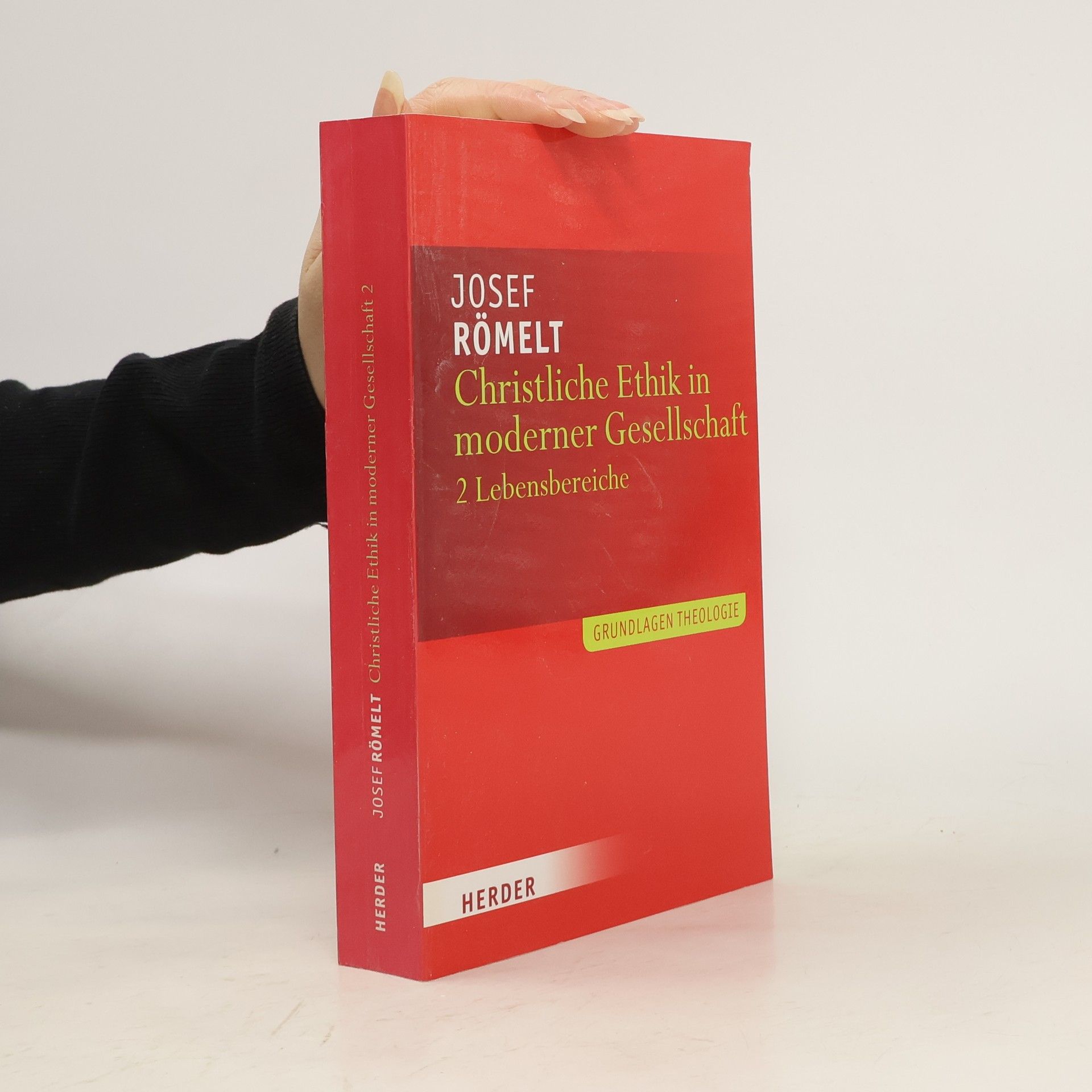
Für eine menschengerechte Gestaltung von Leben und Sterben im Horizont des christlichen Glaubens
Die Auseinandersetzung mit der Ambivalenz von Freiheit und Gebundenheit prägt die gegenwärtige Lebensrealität. Während der Bundesgerichtshof über die Liberalisierung des assistierten Suizids entscheidet, schränkt das Corona-Virus das öffentliche und private Leben erheblich ein. Diese Spannungen werfen grundlegende Fragen für die Theologische Ethik auf: Wie können herausfordernde Lebenssituationen so gestaltet werden, dass individuelle Entscheidungen und Handlungen an menschenwürdigen Werten ausgerichtet sind und Geborgenheit in Gemeinschaft und Nähe zu Gott erfahren wird?
Wie Gegenwartsutopien die christliche Heilsbotschaft herausfordern
Das religiose Sinnangebot einer letzten Verankerung in Gott, in einem Leben nach dem Tod, scheint heutzutage gegenuber der Faszination des Diesseits, dem Leben im Hier und Jetzt zu verblassen. Das Buch ergrundet diese geistige Atmosphare unserer Gegenwart und tritt dazu in einen Dialog mit den Denkern Yuval Noah Harari ('Homo Deus') und Hartmut Rosa ('Resonanz'), deren Utopien ein groaes Echo gefunden haben. Der Autor zeigt, wie der Glaube dabei eine neue Sprache finden kann: als Einladung an die menschliche Sehnsucht nach tiefer Vitalitat, Lebensfreude und Lebenszugewandtheit, sich selbst auch in den Grenzerfahrungen von Scheitern, Krankheit und Tod zu vertrauen.
Welche ethische Position ist in der Diskussion um die Genetik, die Stammzellen oder die Präimplantationsdiagnostik richtig? Warum sind viele Menschen heute häufig zu träge, um am demokratischen Gespräch zu diesen Fragen aktiv teilzunehmen? Wer in den heutigen ethischen Debatten mitreden will, muss etwas von der Sache verstehen. Er muss die grundlegenden Ansätze verstehen, von denen heutige Zeitgenossen her die Konflikte der pluralistischen und technischen Kultur zu lösen versuchen: die Diskursethik etwa oder den bioethischen Utilitarismus. Er muss aber auch, um den christlichen Standpunkt überzeugend vertreten zu können, die entscheidenden theologischen Voraussetzungen einer tragfähigen Ethik für heute kennen: die moralische Kompetenz des Gewissens, die Bedeutung und Grenzen ethischer Normen, die christliche Existentialethik, die Möglichkeiten, mit der Erfahrung der Schuld sinnvoll und befreiend umzugehen. Die theologische Ethik möchte aufgrund der christlichen Erlösungserfahrung Mut machen, in den gegenwärtigen Krisenerscheinungen moderner Gesellschaft moralische Verantwortung zu übernehmen, ohne die die Menschheit keine Zukunft hat.