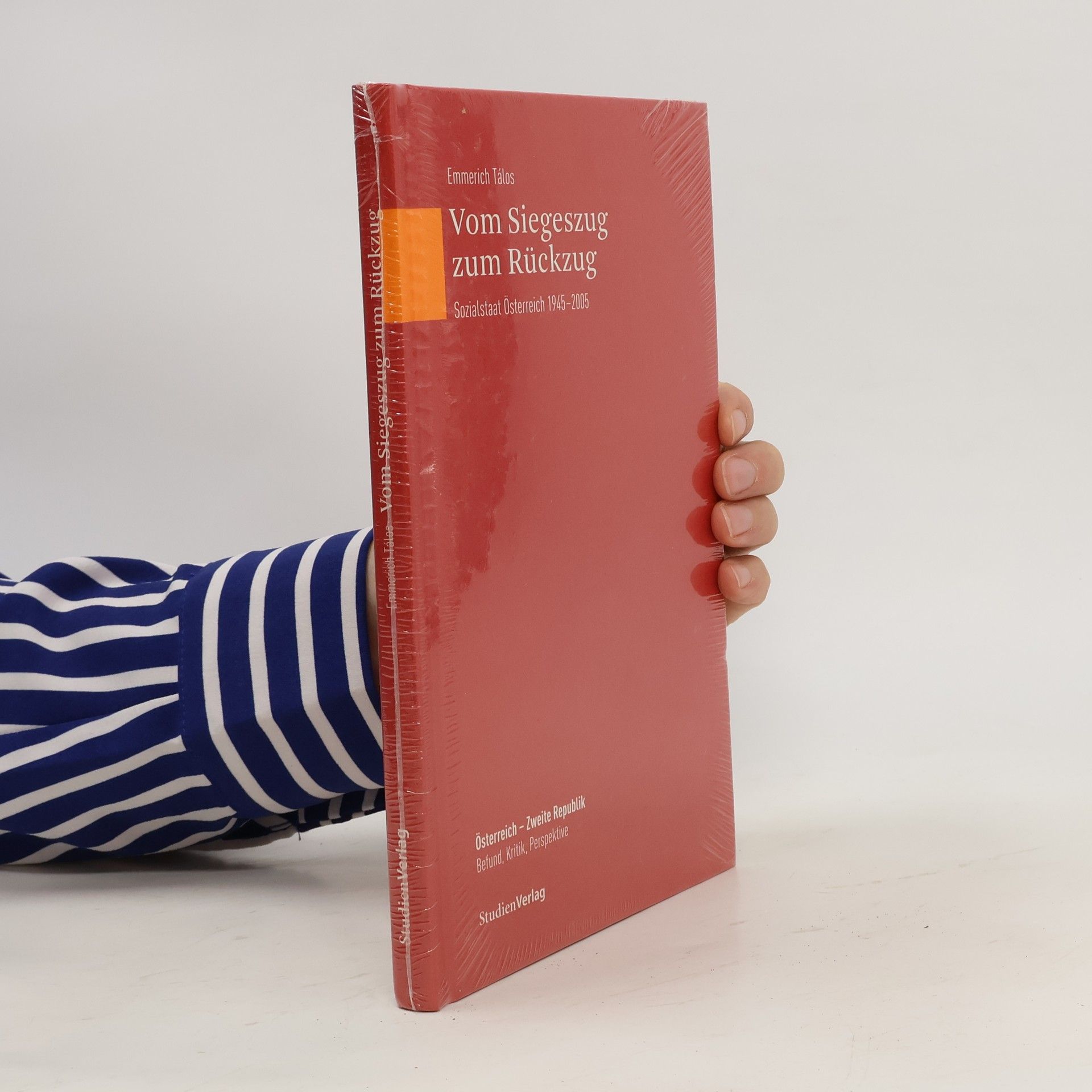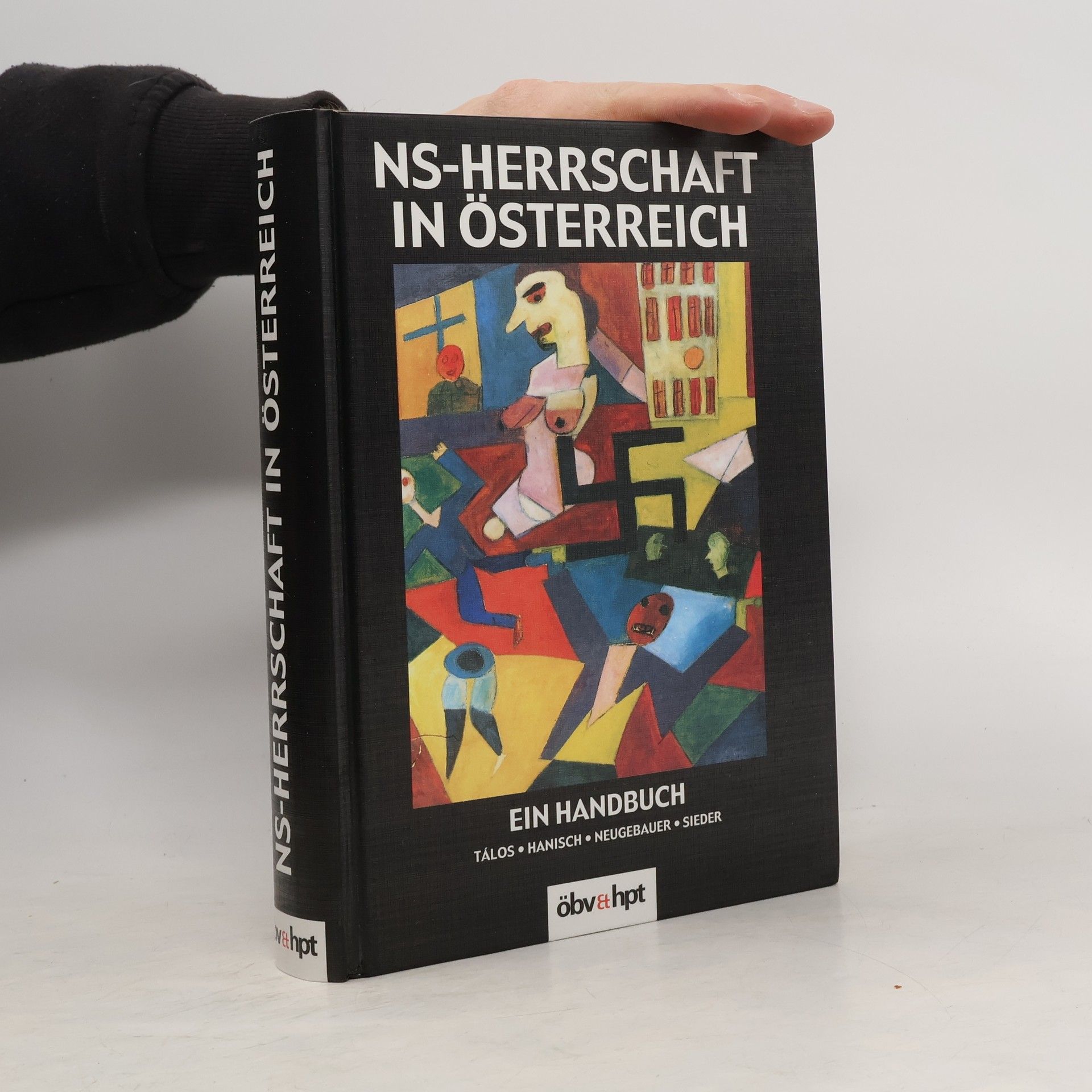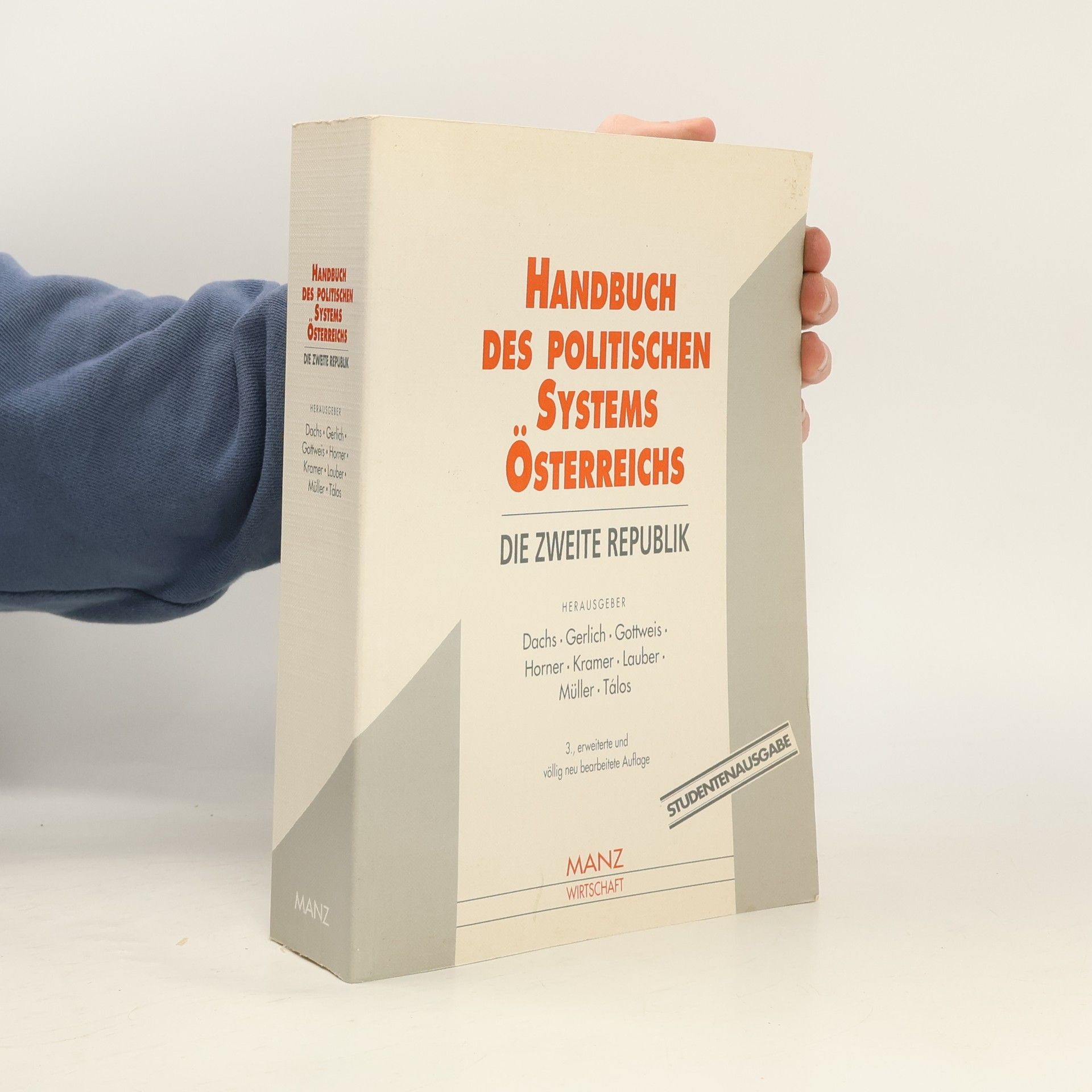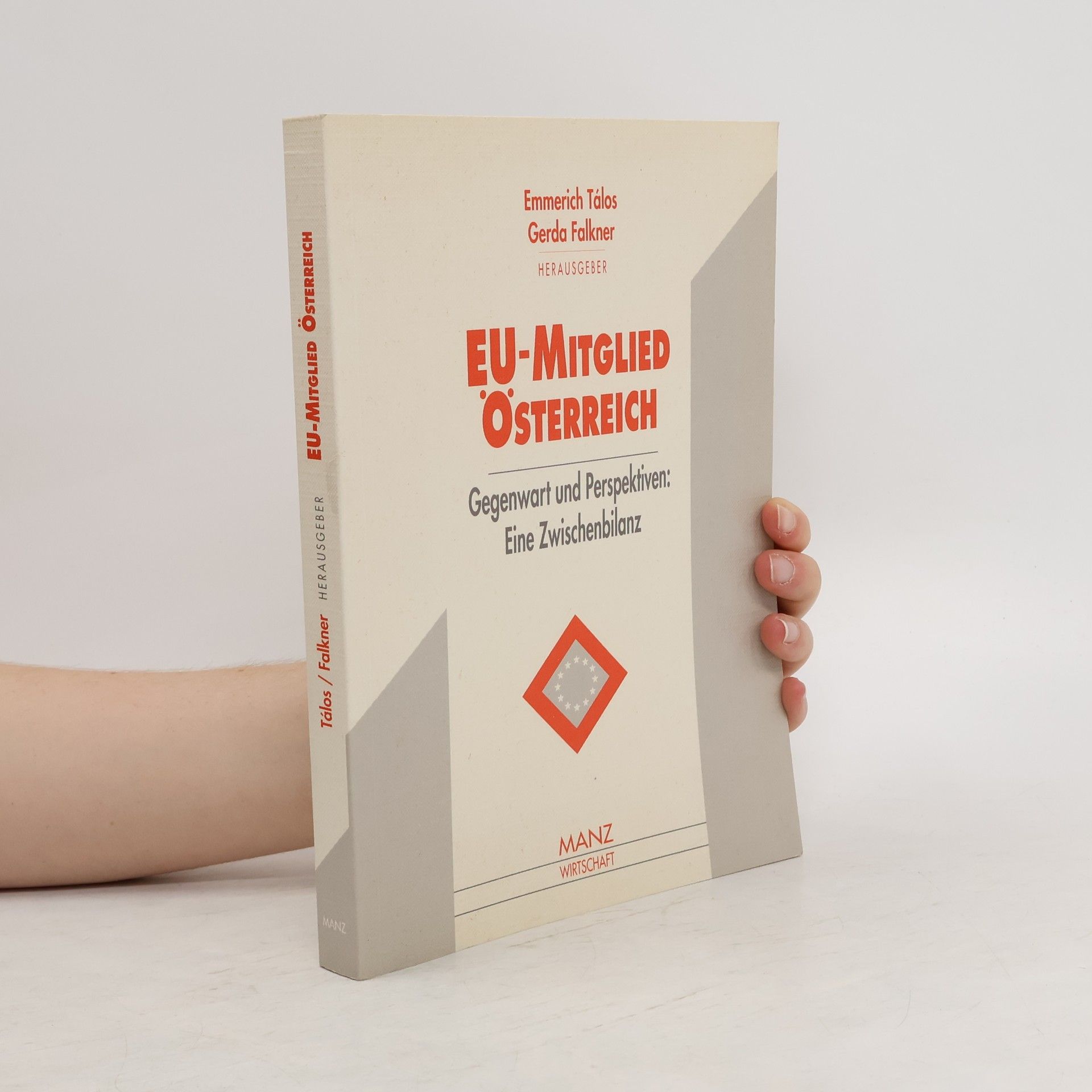Im Zentrum der Analysen stehen das subjektive Sicherheitsempfinden der Österreicherinnen und Österreicher in unterschiedlichen Bereichen, die Betroffenheit von der Corona-Pandemie samt ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie in diesem Kontext die Haltung zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Ergebnisse zeigen eine zunehmend verunsicherte Gesellschaft, die die Notwendigkeit der Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Sozialsystems erkennt, wobei die Haltung zu einem bedingungslosen Grundeinkommen ambivalent ist.
Emmerich Tálos Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

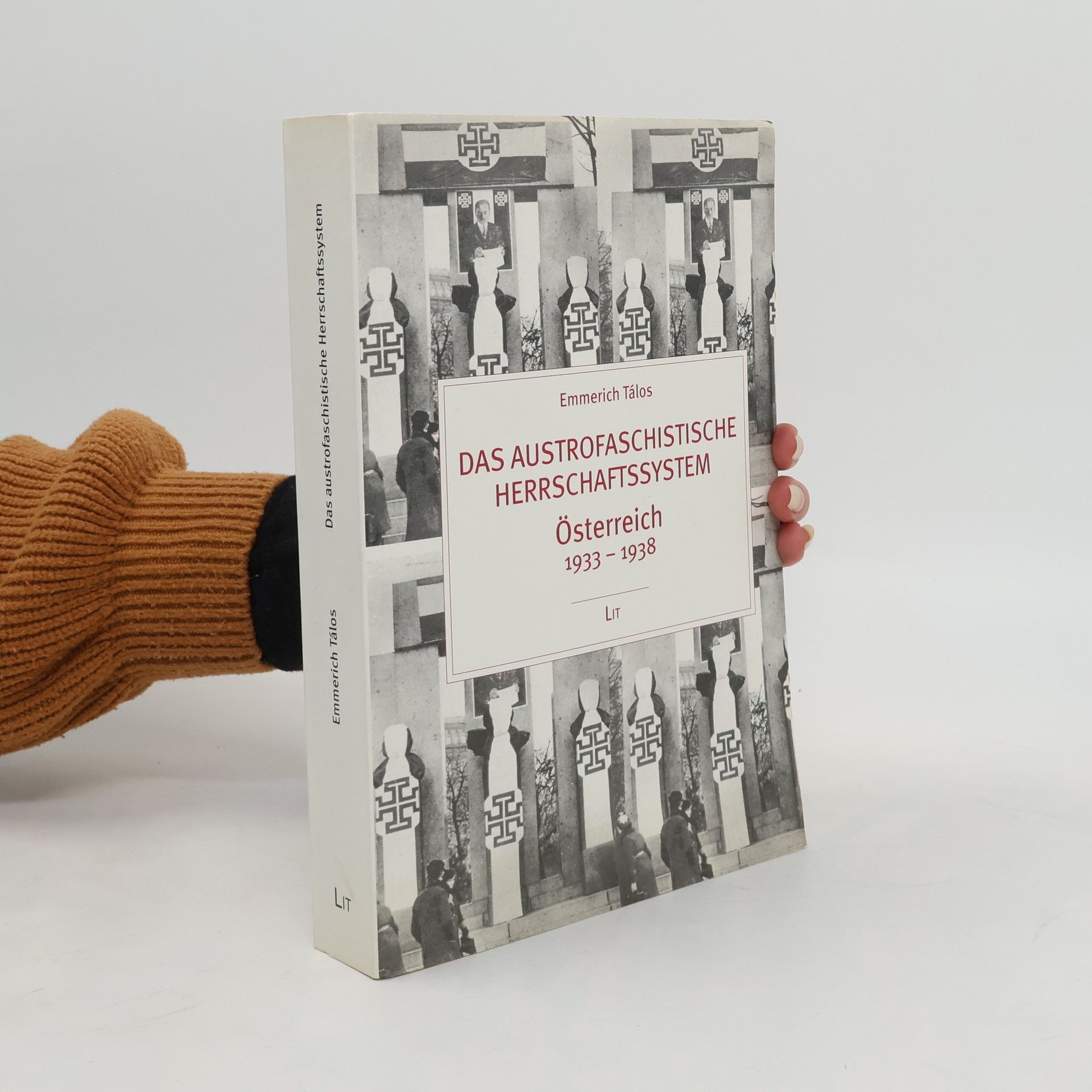
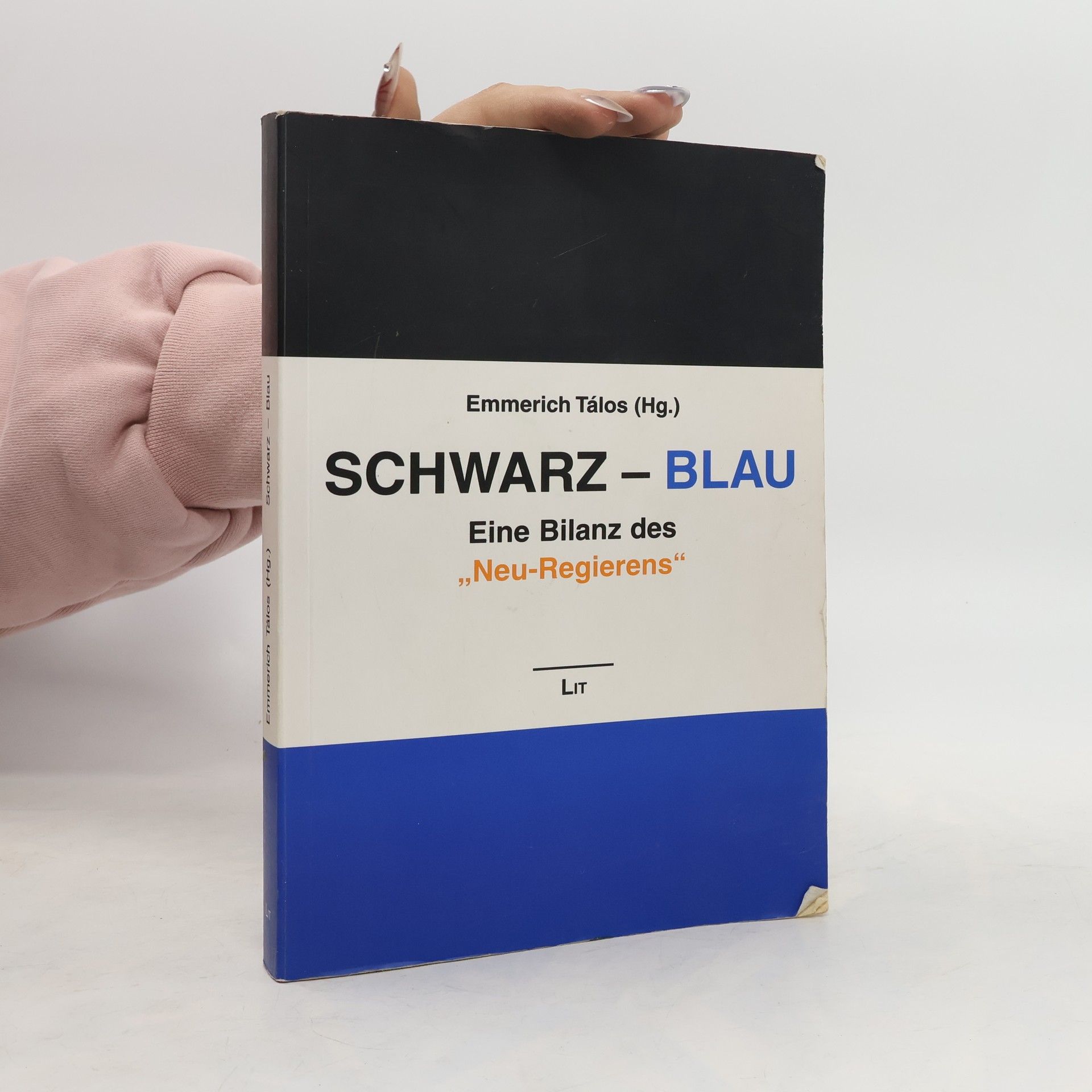

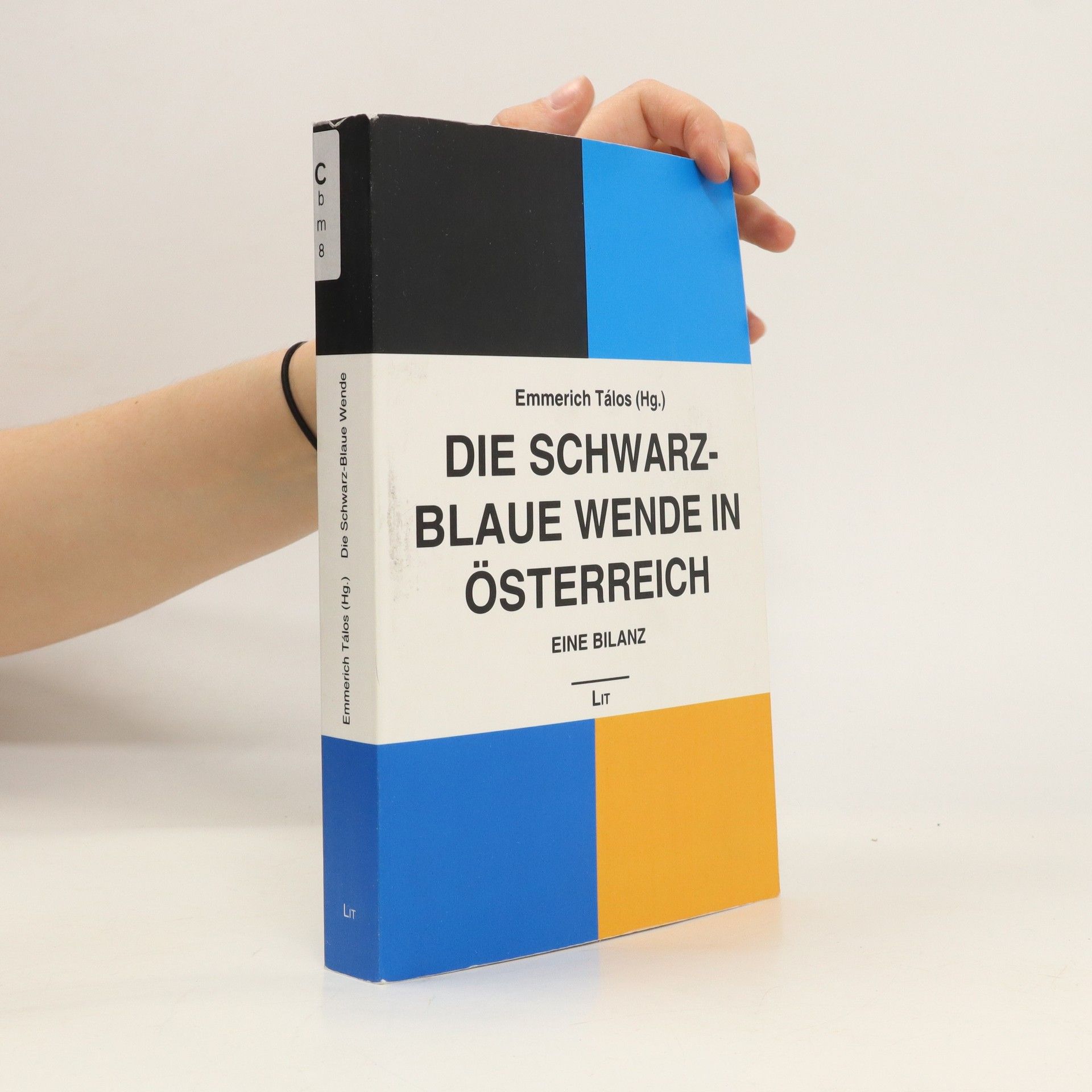
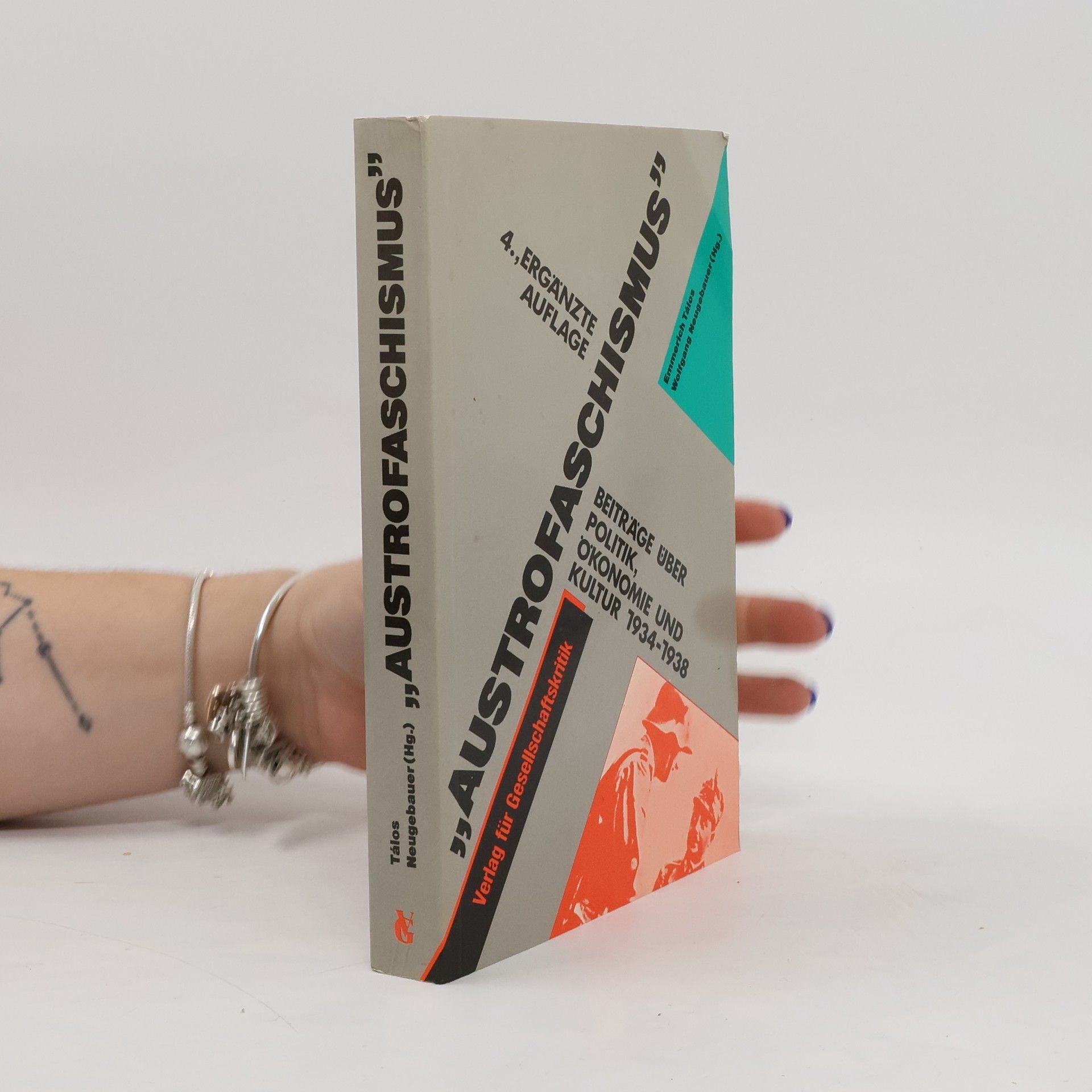
Die Schwarz-Blaue Wende in Österreich. Im Jahr 2000 wurde erstmals in der Zweiten Republik eine ÖVP/FPÖ-Koalitionsregier
Das austrofaschistische Österreich 1933-1938
- 189 Seiten
- 7 Lesestunden
Wirtschaftliche und soziale Probleme führten in Österreich zu Beginn der 1930er zu einer massiven Verschärfung der politischen Gegensätze. In weiterer Folge kam es zu tiefreichenden Veränderungen. An Stelle der demokratischen Republik wurde eine eigene Variante des Faschismus etabliert: der Austrofaschismus. Nach zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen legt der Autor unter Mitarbeit von Florian Wenninger eine Darstellung für einen breiteren Leserkreis vor: die Gesamtentwicklung bis zum Anschluss 1938, Akteure und Trägergruppen, interessengeleitete inhaltliche Um- und Neugestaltung wichtiger Politikbereiche bis hin zur Verankerung in der Bevölkerung und zu den bedeutsamen Beziehungen zum italienischen und deutschen Faschismus. Ferner wird die österreichische Entwicklung in den europäischen Kontext politischer Umbrüche eingebette, für die der italienische Faschismus vielfach Vorbild war.
In den 1930er Jahren vollzogen sich in Österreich, wie in anderen europäischen Ländern, einschneidende politische Veränderungen. Sie kummulierten in der Etablierung des Austrofaschismus. Dieses Herrschaftssystem wird von Emmerich Tálos, einem ausgewiesenen Kenner, erstmals einer umfassenden Untersuchung unterzogen. Analysiert werden: Konstituierungsprozess, ideologisches Selbstverständnis, die politischen Strukturen, zentrale Akteure, die Um- und Neugestaltung der wesentlichen Politikfelder, die politische Stimmungslage, die folgenreichen Beziehungen zu Italien und Deutschland. Der Austrofaschismus weist insbesondere Ähnlichkeit mit dem italienischen Faschismus auf. Eine angemessene Interpretation des "Anschlusses"" (im März '38) kann nur vor dem Hintergrund des Austrofaschismus erfolgen --
Schwarz-blau
Eine Bilanz des "Neu-Regierens"
Der Sozialbericht von 1999 zeigt, dass in Österreich 880.000 Personen armutsgefährdet sind, während 310.000 akute Armut erleben. Armut ist in reichen Ländern wie Österreich nicht unbedingt mit physischer Verelendung verbunden, bedeutet jedoch im Vergleich zu bestehenden materiellen und sozialen Standards eine erhebliche Unterversorgung und eingeschränkte Teilhabechancen. Selbst in einem gut ausgebauten Sozialstaat gibt es Lücken, wie die Existenz von working poor und workless poor belegt. Der erste Teil des Buches untersucht zentrale soziale Felder: Petra Wetzel analysiert Armutsrisiken in der Erwerbsarbeit, Katharina Wrohlich thematisiert die Familie, und Nikolaus Dimmel betrachtet Krankheitsprobleme. Zudem wird die Sozialhilfe auf ihre Lücken hin untersucht, die eigentlich der Armutsvermeidung dienen sollte. Peter Rosner reflektiert den Armutsbegriff. Diese Analysen führen zum zweiten Thema: der sozialen Grundsicherung als Antwort auf Verarmung. Emmerich Tálos bietet einen Überblick über die Debatte zur materiellen Grundsicherung und hebt die „bedarfsorientierte Grundsicherung“ hervor, die bestehende Systeme ergänzt. Tálos thematisiert Lücken und Herausforderungen bei der Umsetzung. Im dritten Teil diskutieren Tálos, Wrohlich und Dimmel die praktische Umsetzung dieser Grundsicherung und deren Auswirkungen auf den Sozialstaat. Rosner und Wrohlich präsentieren eine Kostenschätzung, die zeigt, dass die Umsetzung ökonomisch mach
Herrschaftsstrukturen, sozioökonomische Entwicklungen, die politische Einflußnahme auf Arbeit, Schule, Bildung, das "Freizeit"--Verhalten der Jugendlichen, die Gesundheitspolitik, die Informationsmedien, der Literaturbetrieb nach der NS-Machtübernahme in Österreich
Handbuch des politischen Systems Österreichs
Die zweite Republik - 3., erweiterte und völlig neu bearbeitete Auflage - Studentenausgabe