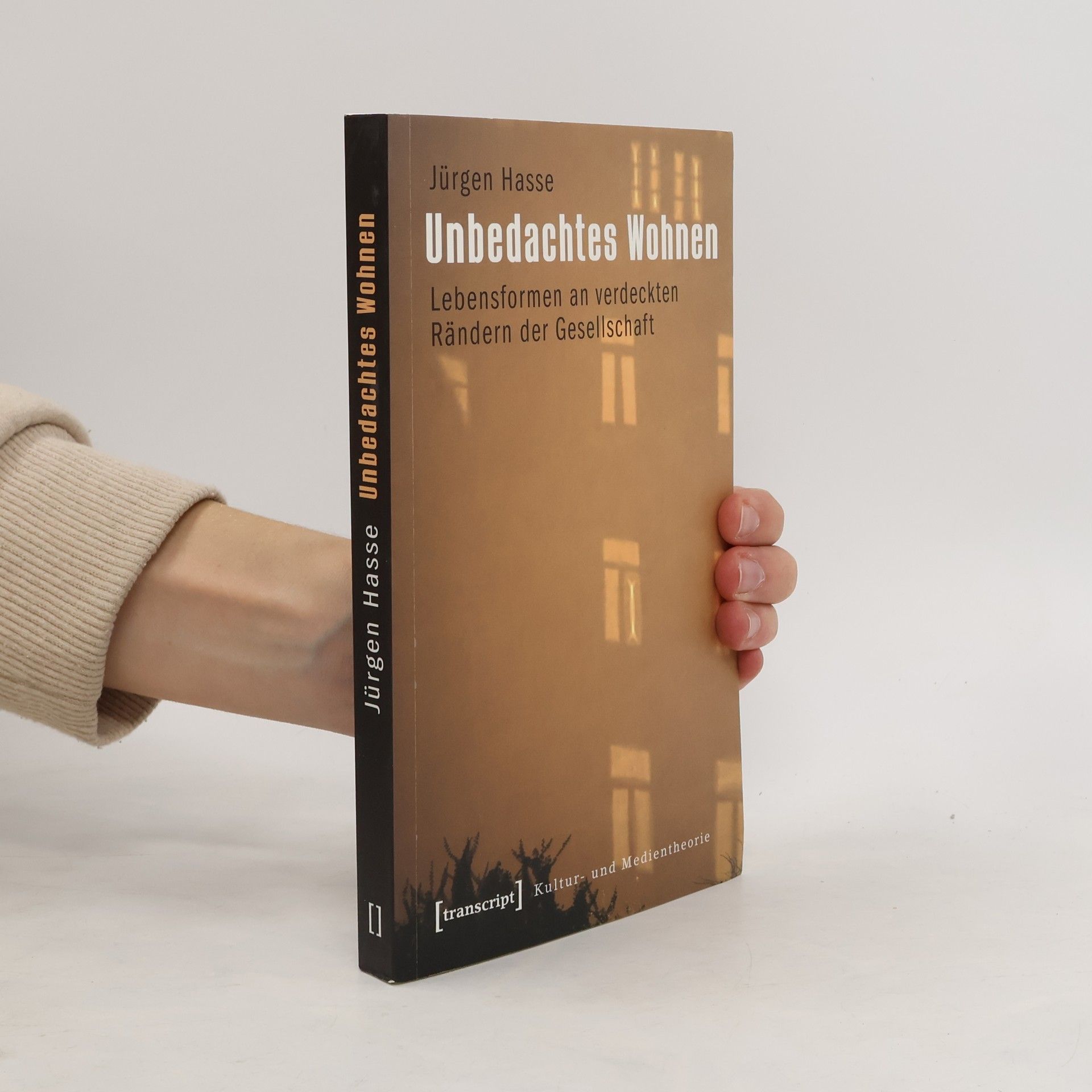The Cruel Sea
Der Tod und das Meer - historische und kunsthistorische Perspektiven
- 248 Seiten
- 9 Lesestunden
Seekriege wurden mit äußerster Brutalität geführt, und die Arbeit an Bord der Schiffe zählte zu den gefährlichsten Berufen. Unfälle, Meutereien und Überfälle traten häufig auf, begleitet von Mangelernährung und fehlender Hygiene, was zu Krankheiten führte. Auch an Land war man vor den Gefahren des Meeres nicht sicher; Sturmfluten bedrohten die Küstenbevölkerung. Heute ist der maritime Lebensraum durch Klimawandel und Verschmutzung gefährdet. Die Ambiguität zwischen Faszination und Schrecken, Abenteuer und Desaster im Verhältnis von Mensch und Meer spiegelt sich in der Literatur und bildenden Kunst wider. Dieses Buch dokumentiert die Ergebnisse einer internationalen und interdisziplinären Tagung, die das Wechselverhältnis in kultur-, wirtschafts- und sozialhistorischer Perspektive diskutierte. Zudem gewährt es Einblicke in eine gleichnamige Ausstellung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die See, aus der das Leben stammt, war und ist ein gefährlicher Ort, der unzählige Leben kostete. Stürme und Schiffbruch sind untrennbar mit der Schifffahrt verbunden. Dieses Werk beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Mensch und Meer, die von Faszination und Schrecken geprägt ist.