Gesellschaft gemeinsam gestalten
- 305 Seiten
- 11 Lesestunden


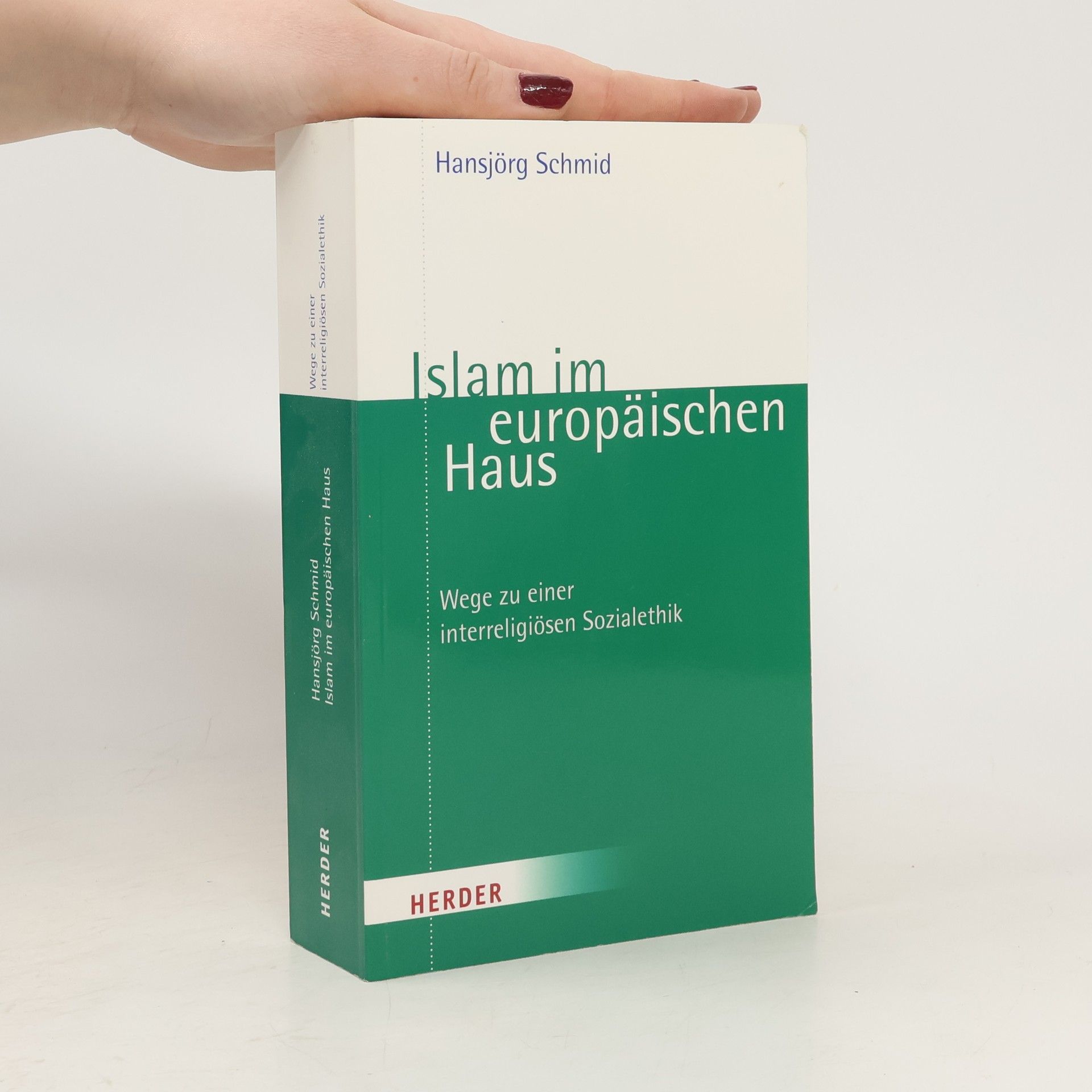

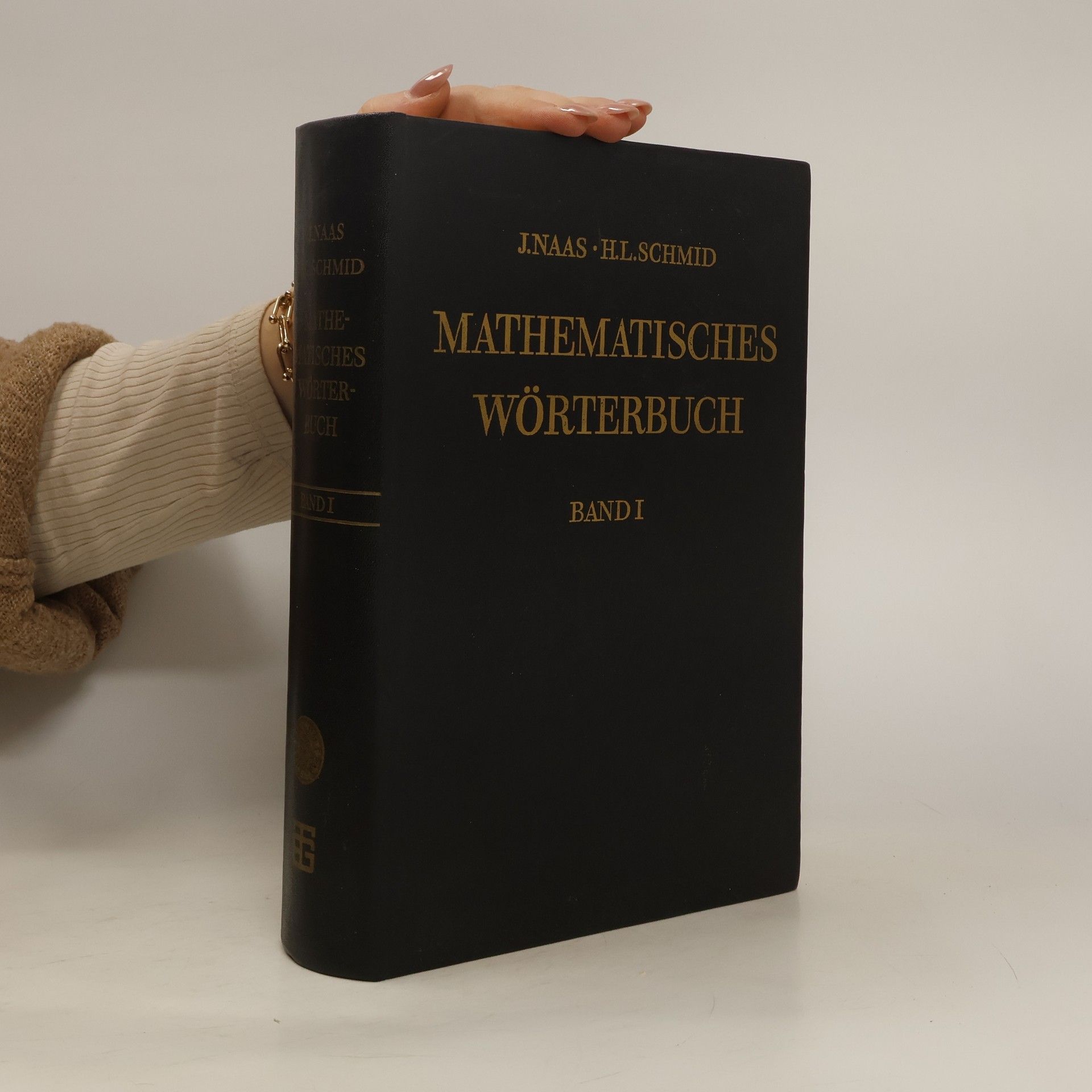
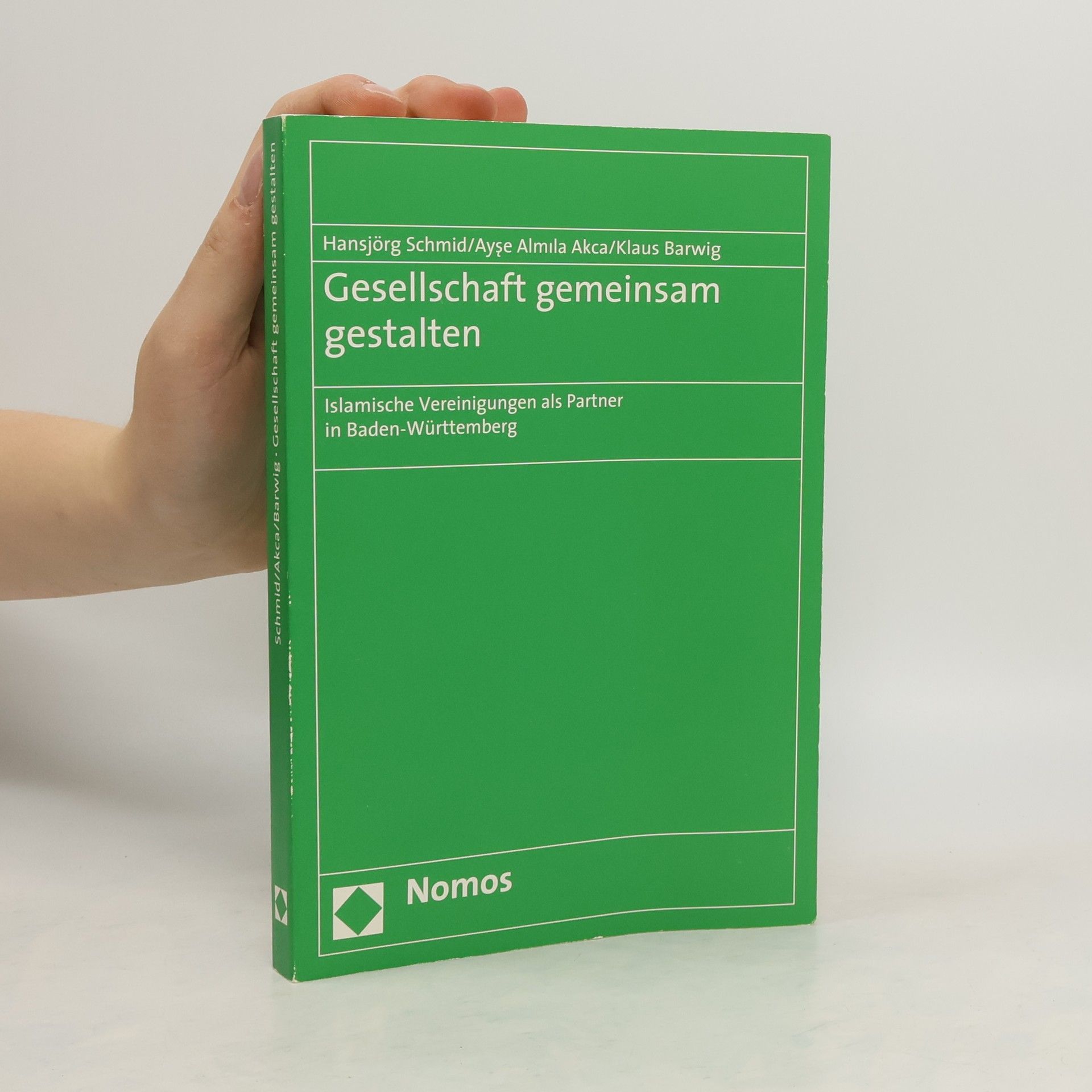
Potenziale aus sozialwissenschaftlicher, islamischer und christlicher Perspektive
Soziale Konflikte werden vielfach als bedrohlich wahrgenommen. Sie sind aber kein Störfall, sondern Normalität und tragen zur Entwicklung der Gesellschaft bei. Entscheidend ist, wie Konflikte ausgetragen werden. Insbesondere islambezogene Konflikte polarisieren die Gesellschaft derzeit stark - Moscheebau, Kopftuch, Imame.Die Autorinnen und der Autor des interdisziplinär erarbeiteten Bands veranschaulichen Konfliktdynamiken sowie islamische und christliche Ressourcen zur Konflikttransformation - und zeigen damit auf, welche Potenziale Konflikten innewohnen. Ein theologischer Ansatz, der sozialwissenschaftliche Erkenntnissen einbezieht mit dem Ziel, Befreiung und Versöhnung in gesellschaftliche Debatten einzubringen.
Bibel und Koran sind in einem kulturellen Umfeld entstanden, das heute vielen Menschen fremd ist. Gleichzeitig erheben beide den Anspruch, eine universal gültige Lebensorientierung zu bieten. Trotz des unterschiedlichen theologischen Stellenwerts von Koran und Bibel steht die Schriftauslegung der beiden Religionen vor vergleichbaren Aufgaben. Christliche und muslimische Wissenschaftler beschäftigen sich mit hermeneutischen Grundfragen, historischen Querverbindungen, feministischen Auslegungen und Deutungsmonopolen. Sie nehmen die Bibel als Verstehenshilfe des Korans und den Koran als eine Auslegung der Bibel in den Blick. In seiner Vielstimmigkeit steht der Band auch für die Pluralität der Schriftauslegung in beiden Religionen.
Die Verantwortung für das eigene wie für das fremde Leben gehört zu den Grundlagen von Christentum und Islam. Das Leben ist heute jedoch angesichts sozialer Brüche, technischer Entwicklungen und globaler Krisen in vielfältiger Weise gefährdet. Christliche und muslimische Wissenschaftler suchen gemeinsam nach Wegen, wie sie sich für den Wert des Lebens in Familie, Politik, Wirtschaft und Biomedizin einsetzen können. Sie vertreten eine kontextuelle, gesprächsfähige Ethik und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Aktualisierung religiöser Traditionen und zur Meinungsbildung in der pluralistischen Gesellschaft. Die Reihe „Theologisches Forum Christentum - Islam“ bietet eine neuartige Diskussionsplattform mit dem Ziel einer theologischen Verhältnisbestimmung von Christentum und Islam.
Das Verhältnis von Christentum und Islam war über Jahrhunderte von starker gegenseitiger Abgrenzung geprägt. Der Islam knüpft dafür an Aussagen des Korans an. Die christliche Abgrenzung entspringt der theologischen und sozialen AuseinanderSetzung mit einer konkurrierenden Religion, die den Offenbarungsanspruch des Christentums in Frage stellt. Gibt es Alternativen zu einer die Differenz betonenden Beziehung der Religionen? Inwieweit sind Abgrenzungen für die beiden Religionen konstitutiv, und wie können sie ohne Übergriffe auf die Identität des anderen vorgenommen werden? Solche Fragen sind nicht nur theologisch relevant, sondern auch von größtem gesellschaftlichen und politischen Interesse. Christentum und Islam im Dialog um die eigene Identität und ihre Beziehung zueinander. Ein Diskurs von größter gesellschaftlicher und politischer Relevanz.