Konkurrenz, Karriere, Kollaps
Männerforschung und der Abschied vom Mythos Mann
- 207 Seiten
- 8 Lesestunden
German
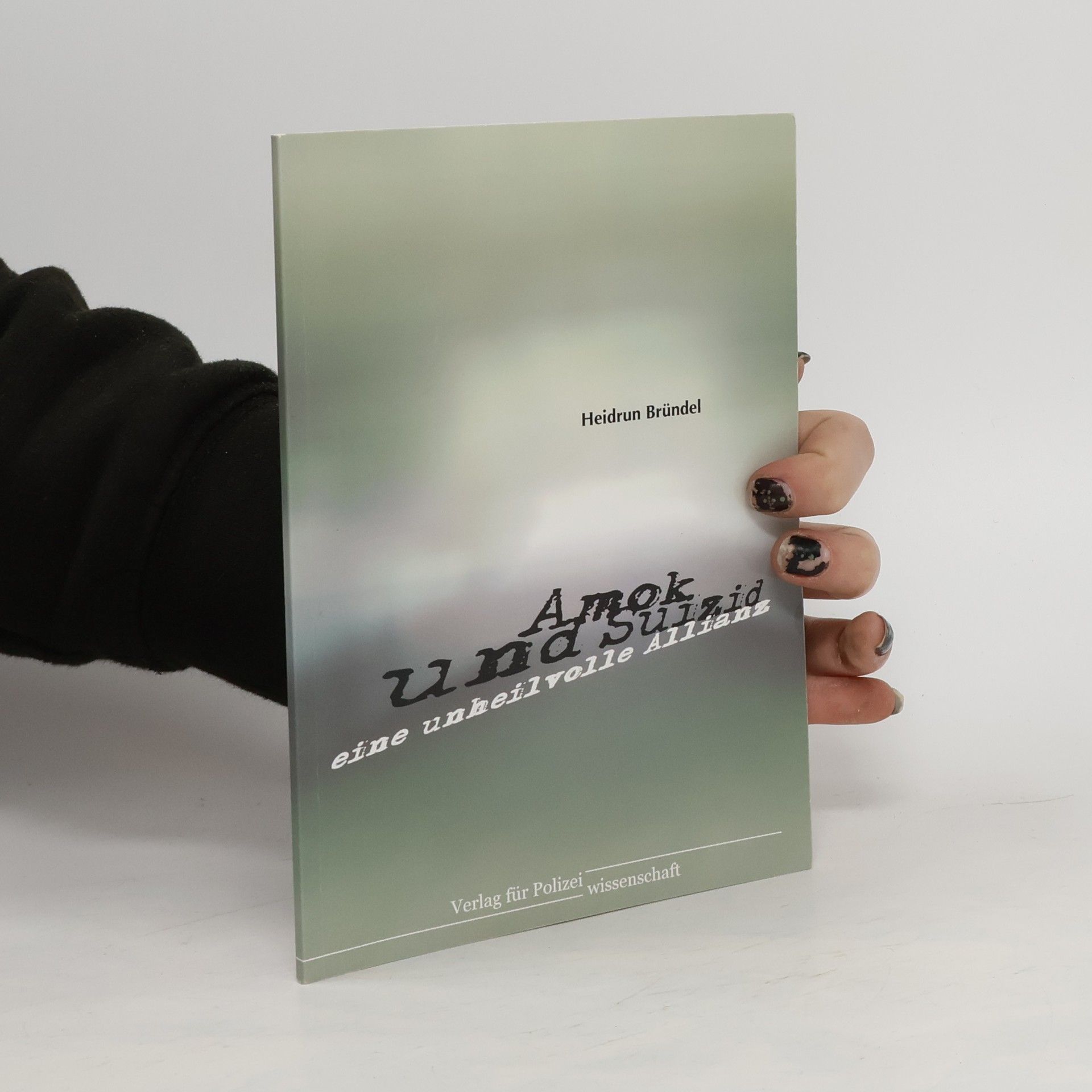
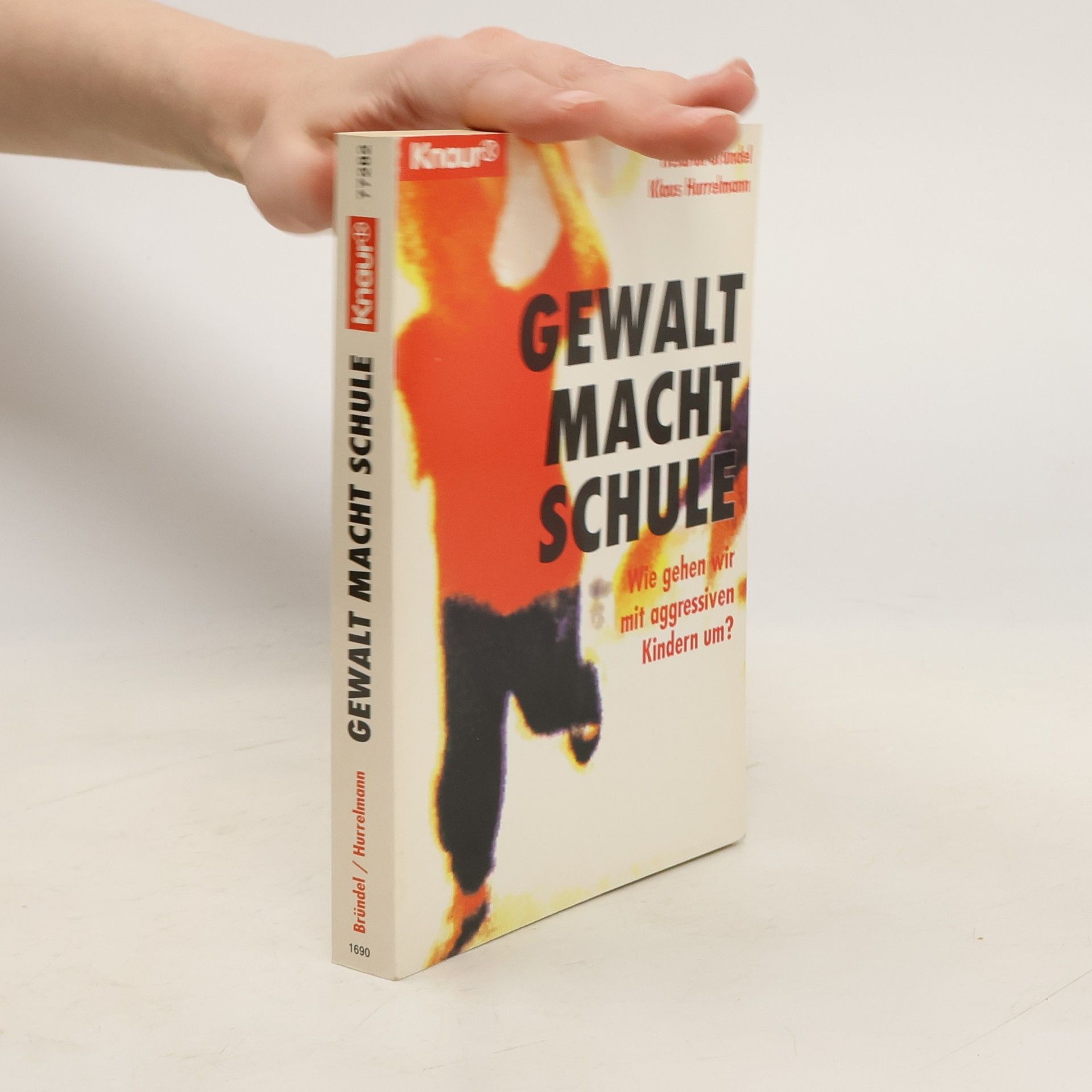
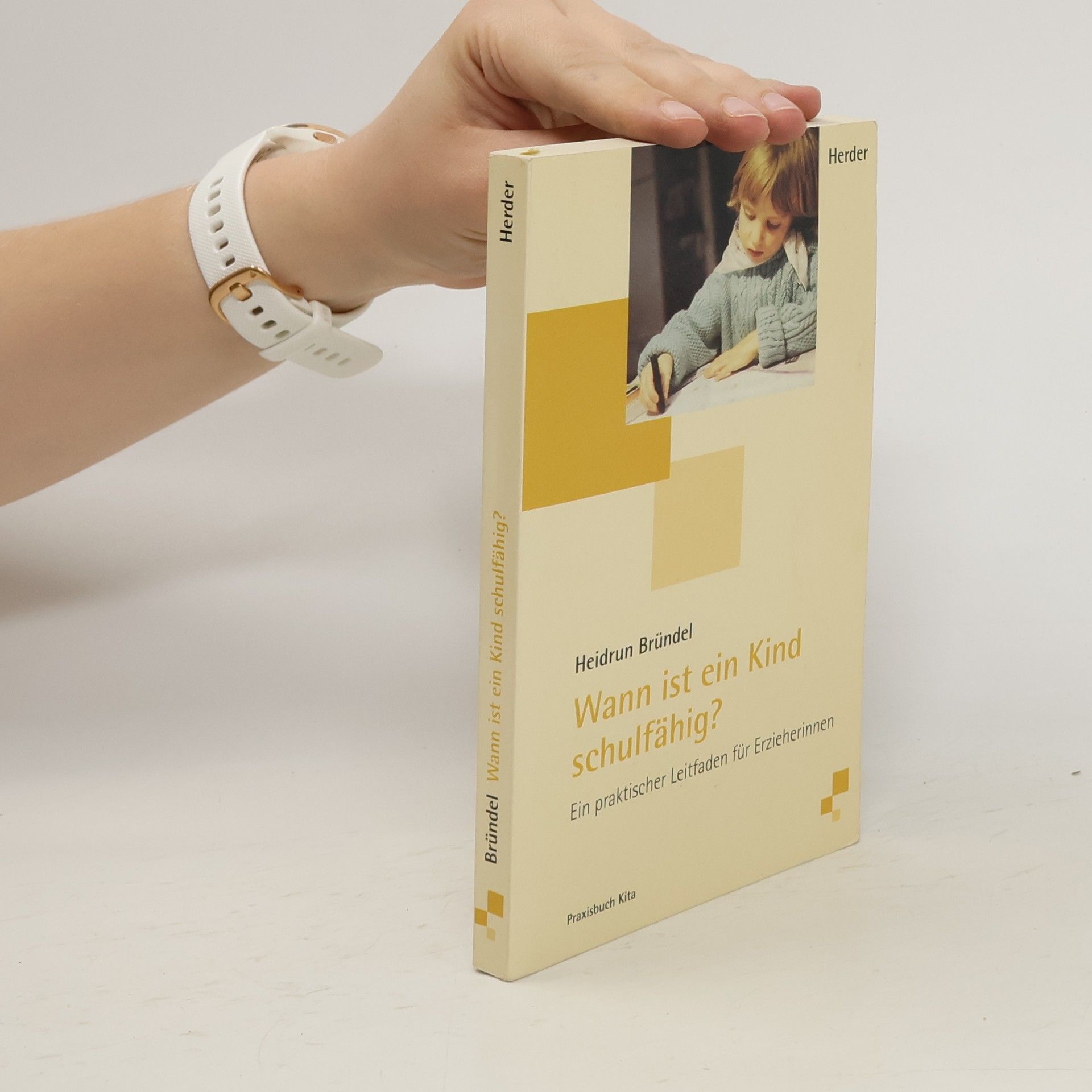

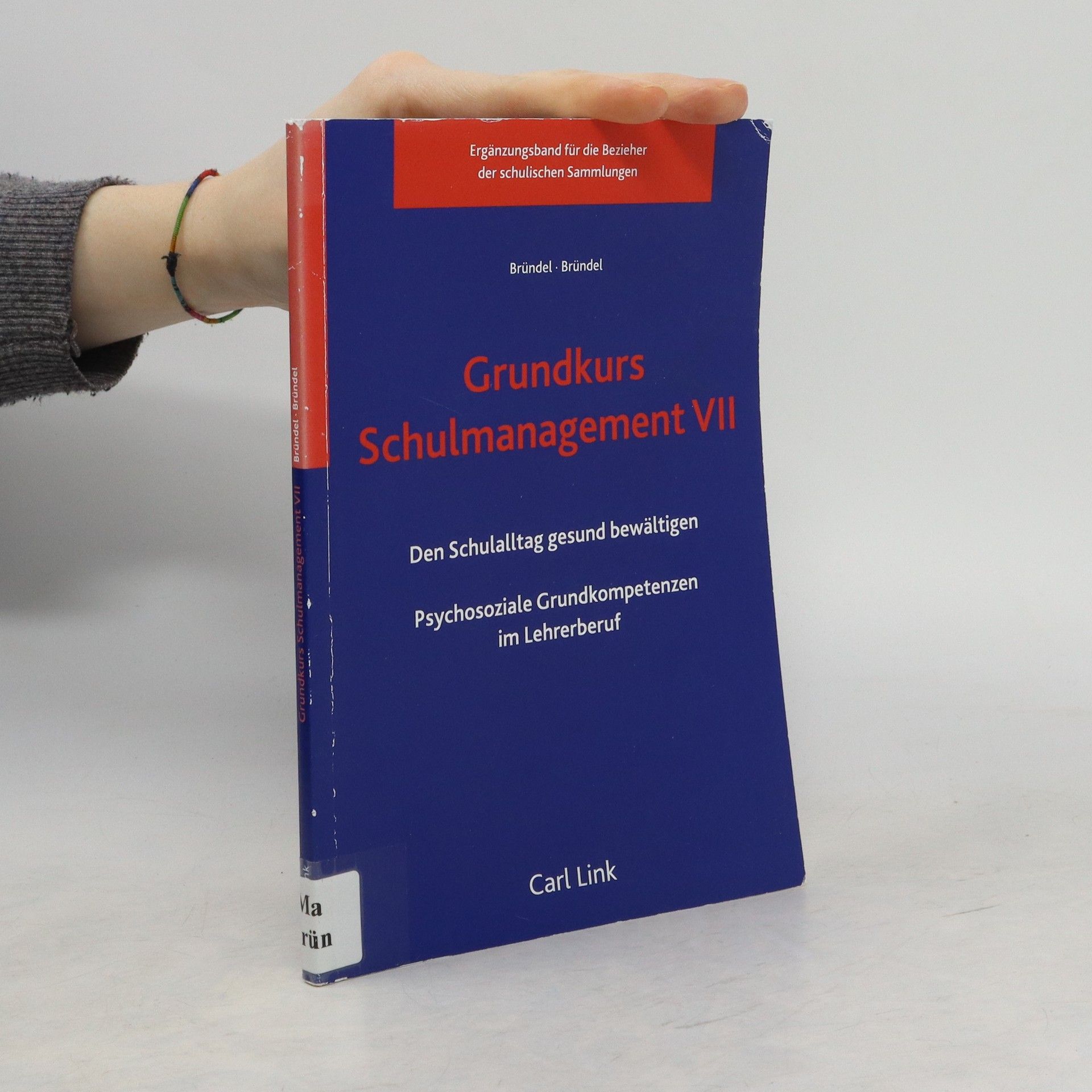

Männerforschung und der Abschied vom Mythos Mann
German
Auf dem Weg zur geschlechtersensiblen Persönlichkeitsentwicklung
Die Autoren gehen das Problem der Jugendgewalt sozialkritisch an und führen sie teilweise auf die Orientierungslosigkeit der heutigen Jugend zurück. Gewalt wird als "soziale Krankheit" bezeichnet und entspringt unerfüllten Wünschen und missverstandenen Bedürfnissen. (Quelle: Vontobel, J. Und bist du nicht willig ... [VIII C 5061]).
Amokläufe und Suizide von Lehrern, Schülern und Eltern sind die gefürchtetsten Gewalttaten in Schulen. Während Suizide selten in der Schule selbst geschehen, sind Amoktaten charakteristisch für Schulen und richten sich gezielt gegen Lehrer und Schüler. In den meisten Fällen enden Amokläufe mit dem Suizid der Täter, und zwischen beiden Handlungen bestehen hohe Übereinstimmungen. Risikofaktoren, psychische Erkrankungen, Vorbilder, Tatvorbereitung, Alarmsignale und das Internet spielen eine ähnliche, jedoch unterschiedliche Rolle. Das präsuizidale Syndrom findet seine Entsprechung im Amokläufer, dessen Wunsch zu sterben mit dem Willen, andere zu töten, einhergeht. Beide Entwicklungen zeigen eine soziale Eskalation. Ziel ist es, die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Amokläufen und suizidalen Taten aufzuzeigen, insbesondere in Bezug auf die Entwicklungsphasen der Täter und die psychische Dynamik. Zudem werden Präventionsansätze in Familie, Schule und Peer-Group beschrieben, die das Kohärenzgefühl stärken sollen. Das Dynamische Risiko-Analyse-System (DyRIAS) dient als Frühwarnsystem, um gefährdete Schüler rechtzeitig zu erkennen und ihnen Unterstützung zu bieten, um weitere tragische Vorfälle zu verhindern.
Ein immer wiederkehrendes Thema ist die Frage der Schulfähigkeit eines Kindes. Die neuüberarbeitete Ausgabe des Titels „Wann ist ein Kind schulfähig?“ berücksichtigt die veränderten Schuleingangsvoraussetzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso wie neue Beobachtungs- und Dokumentationsformen zur Bestimmung von Schulfähigkeit. Mit neuesten Erkenntnisse aus der Entwicklungsforschung zum Übergang vom Kindergarten- zum Schulkind
Das Buch untersucht die psychischen und sozialen Funktionen des Drogenkonsums, die Wechselwirkungen zwischen sozialen Belastungen und Drogenmissbrauch sowie Suchtprävention. Besonders nützlich sind die konkreten Handlungsstrategien, die die Autoren vorstellen.
Die Frage der Schulfähigkeit eines Kindes ist ein immer wiederkehrendes Thema. Die neu überarbeitete Ausgabe berücksichtigt die veränderte Einschulungspraxis und die rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso wie neueste Erkenntnisse aus Hirnforschung und Entwicklungspsychologie. Mit einem ausführlichen Kapitel zu Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung sowie zahlreichen Praxisbeispielen.