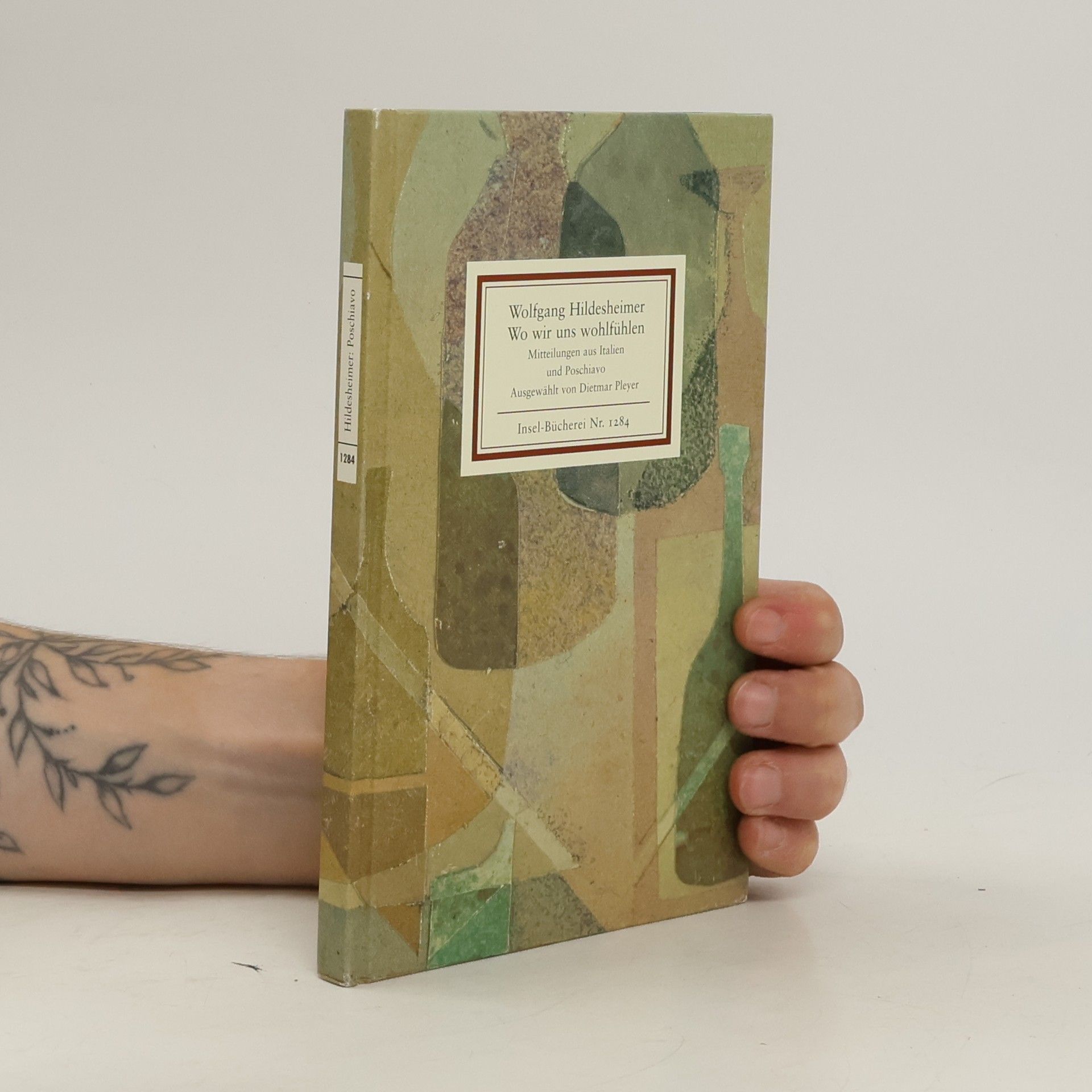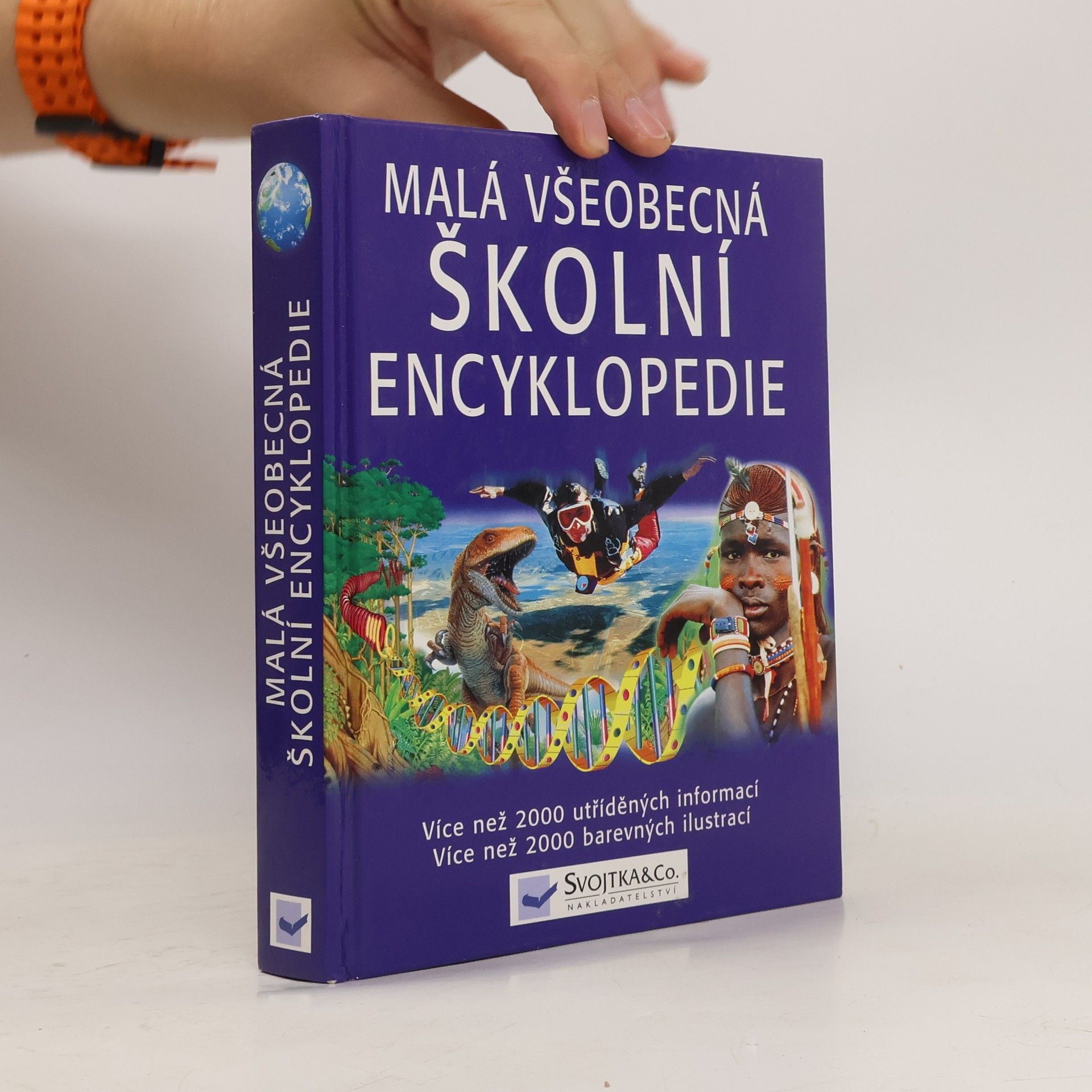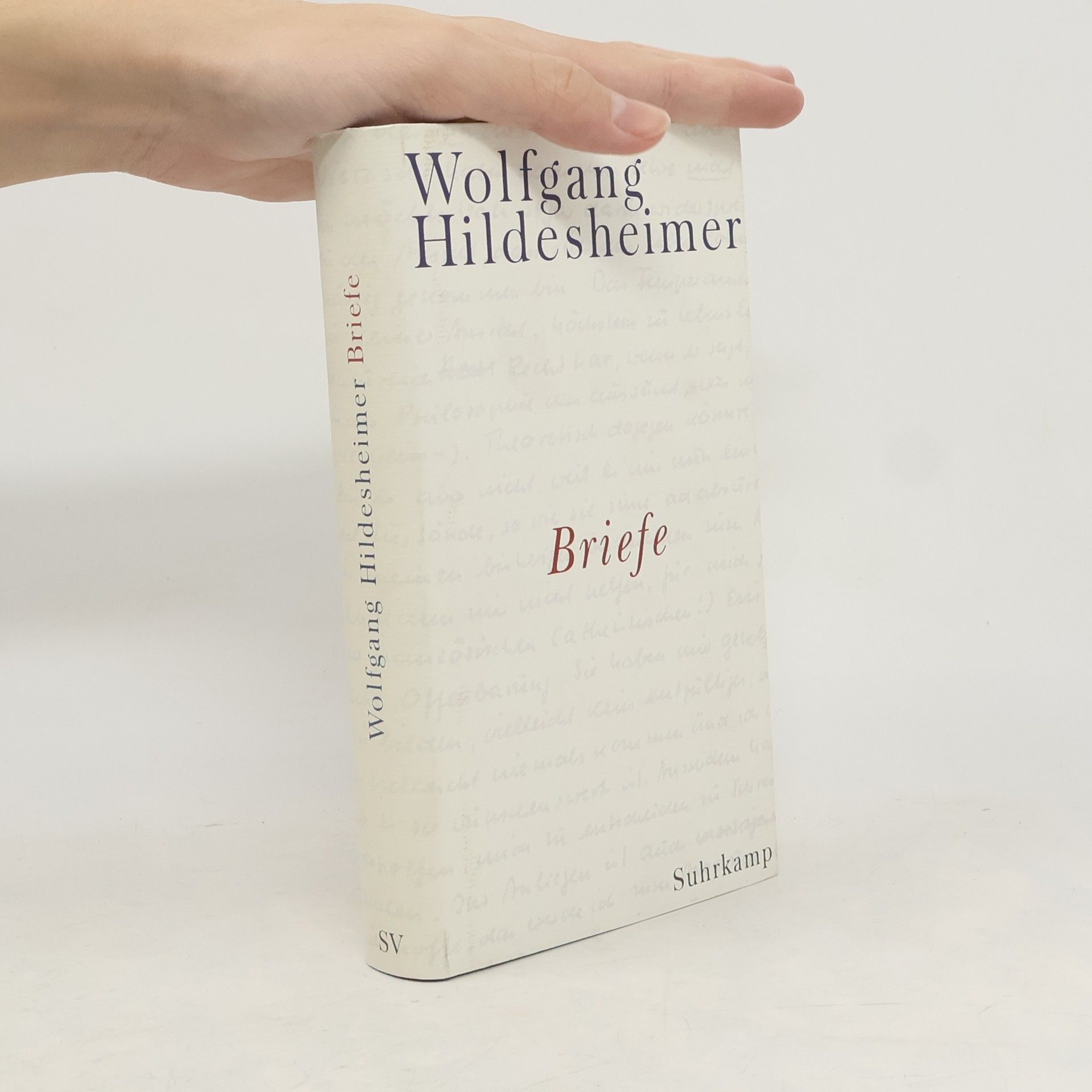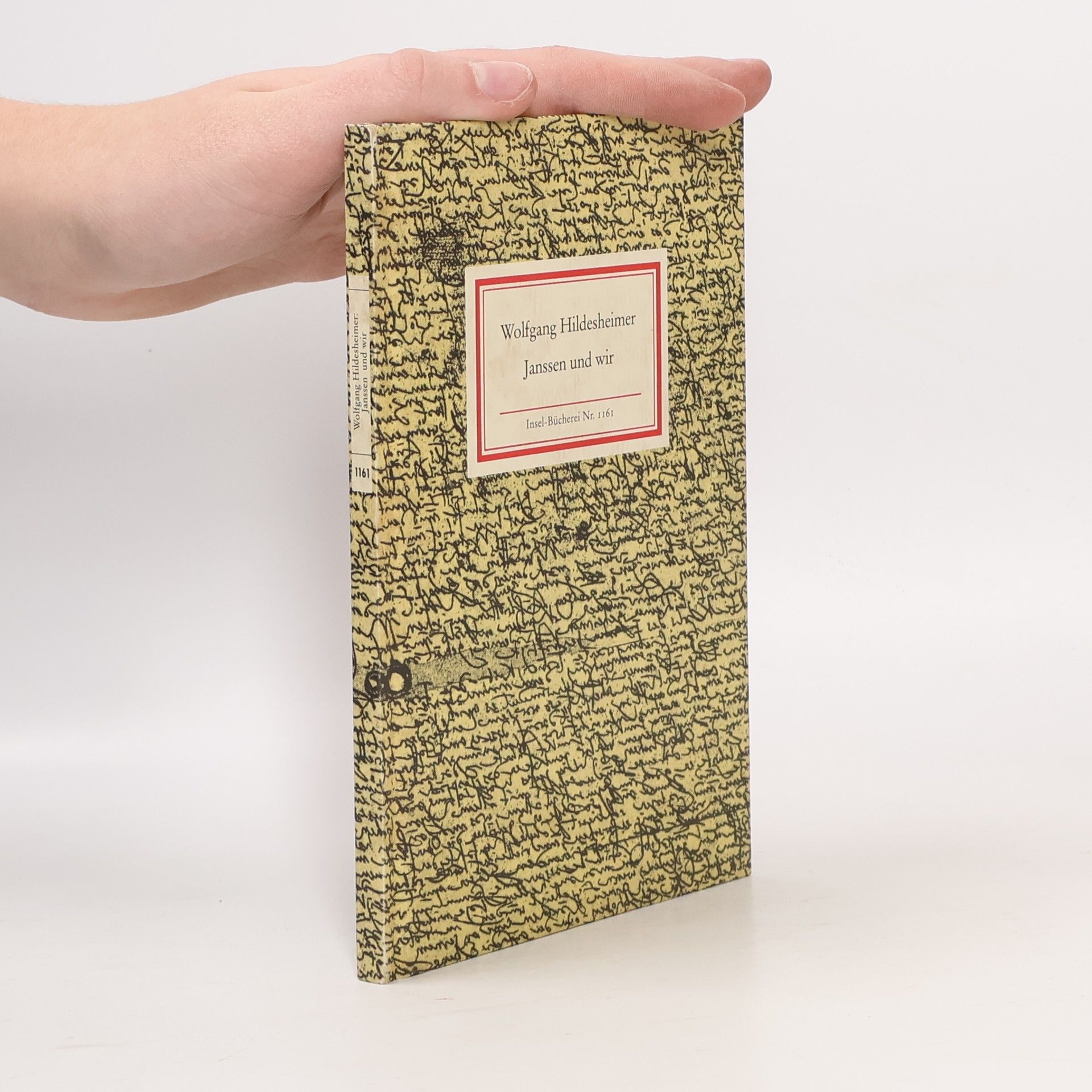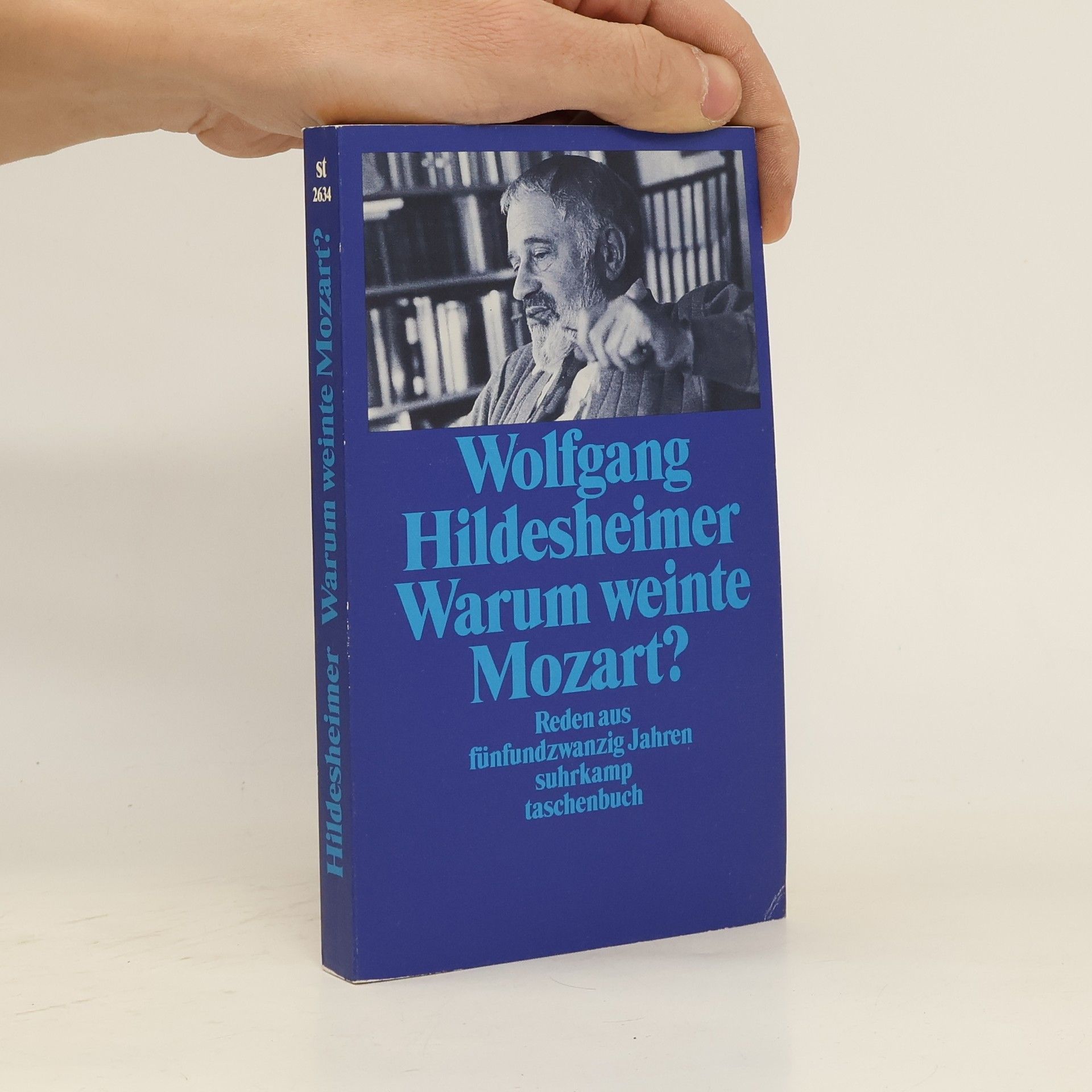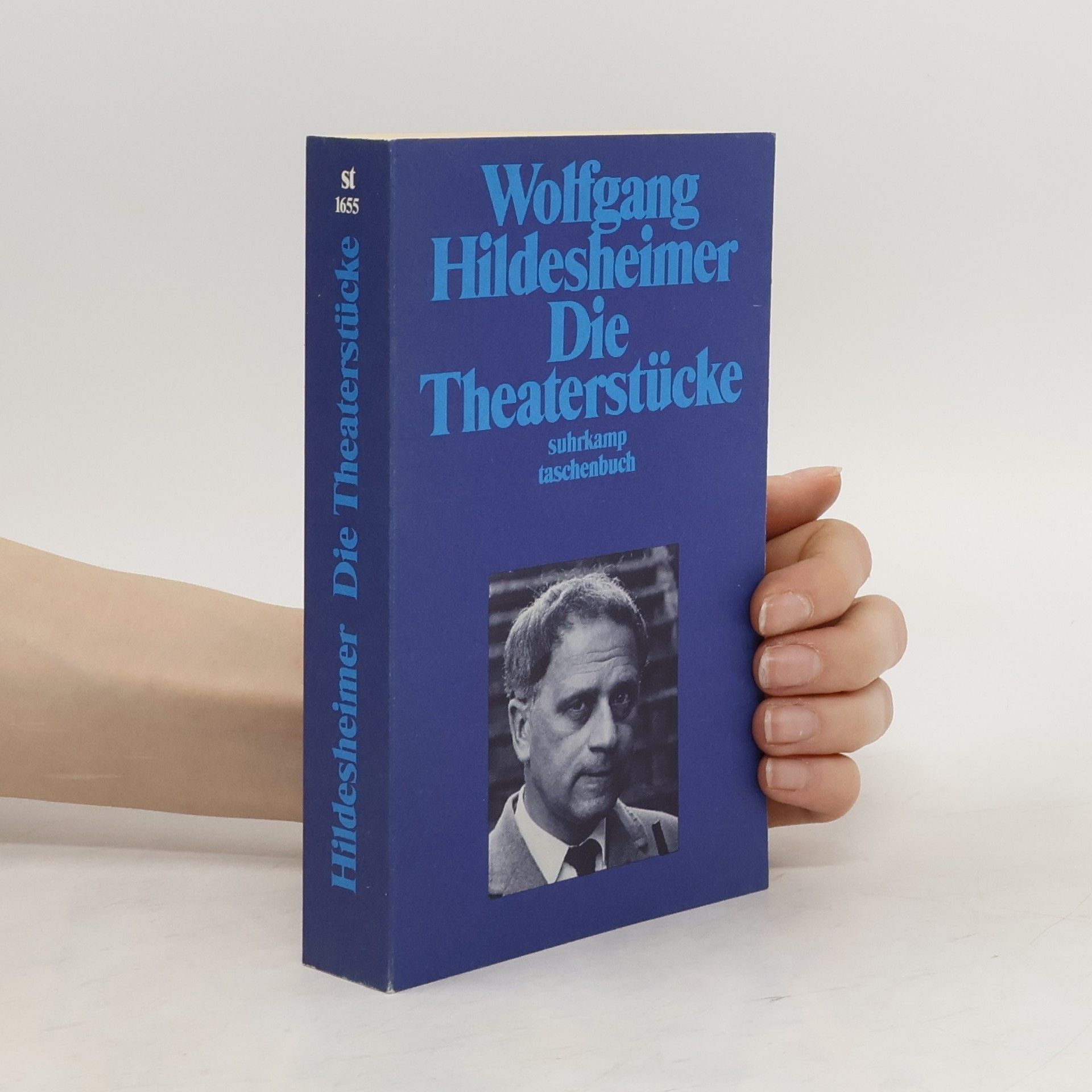Wolfgang Hildesheimers Erzählungen "Lieblose Legenden" (1952) sind Klassiker der deutschen Nachkriegsliteratur. Hildesheimers satirisches Talent bringt frischen Wind in die sozialkritischen und geschichtsphilosophischen Erzählungen der Zeit. Kritiker W.E. Süskind lobte die musische Heiterkeit und Grazie seiner Geschichten.
Wolfgang Hildesheimer Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)




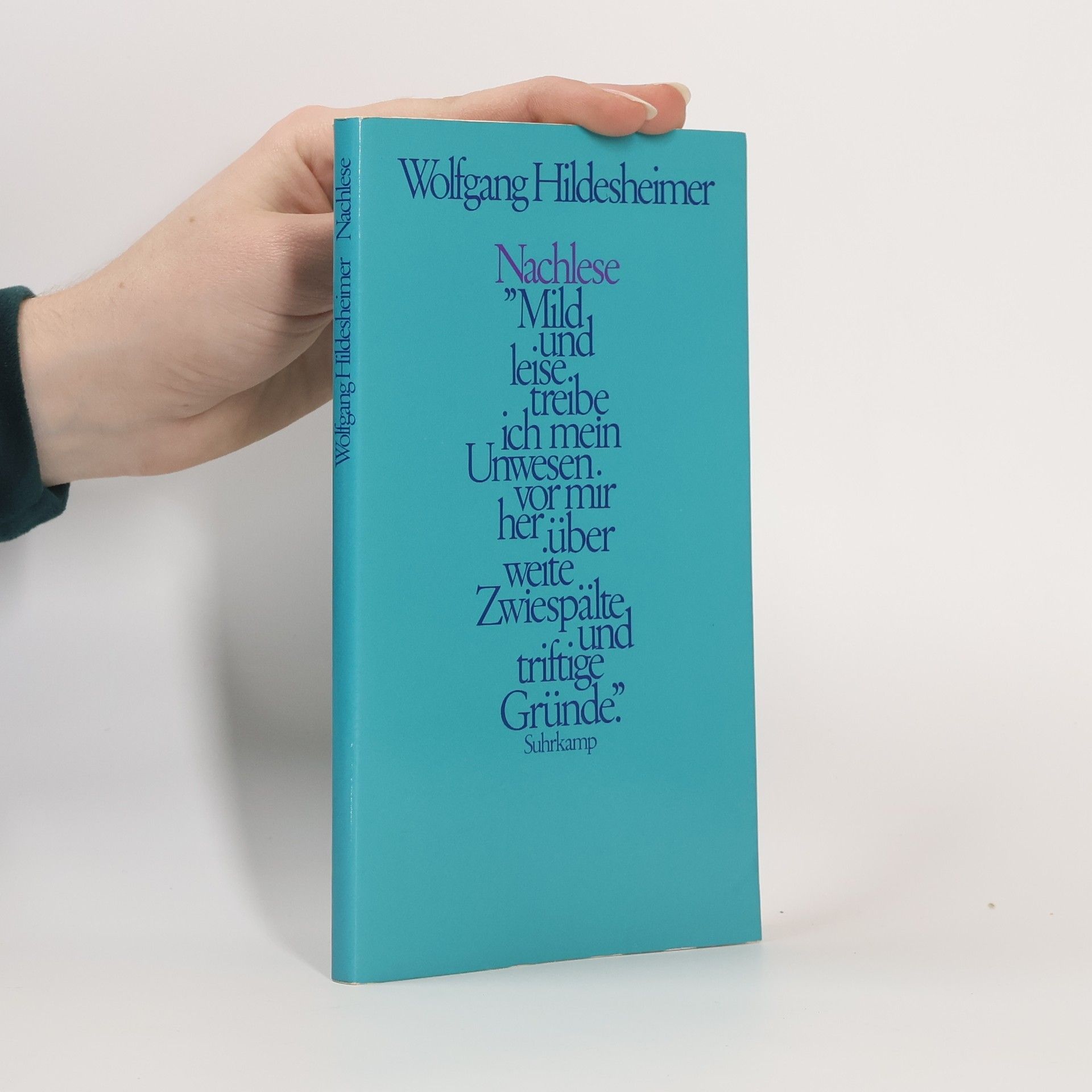

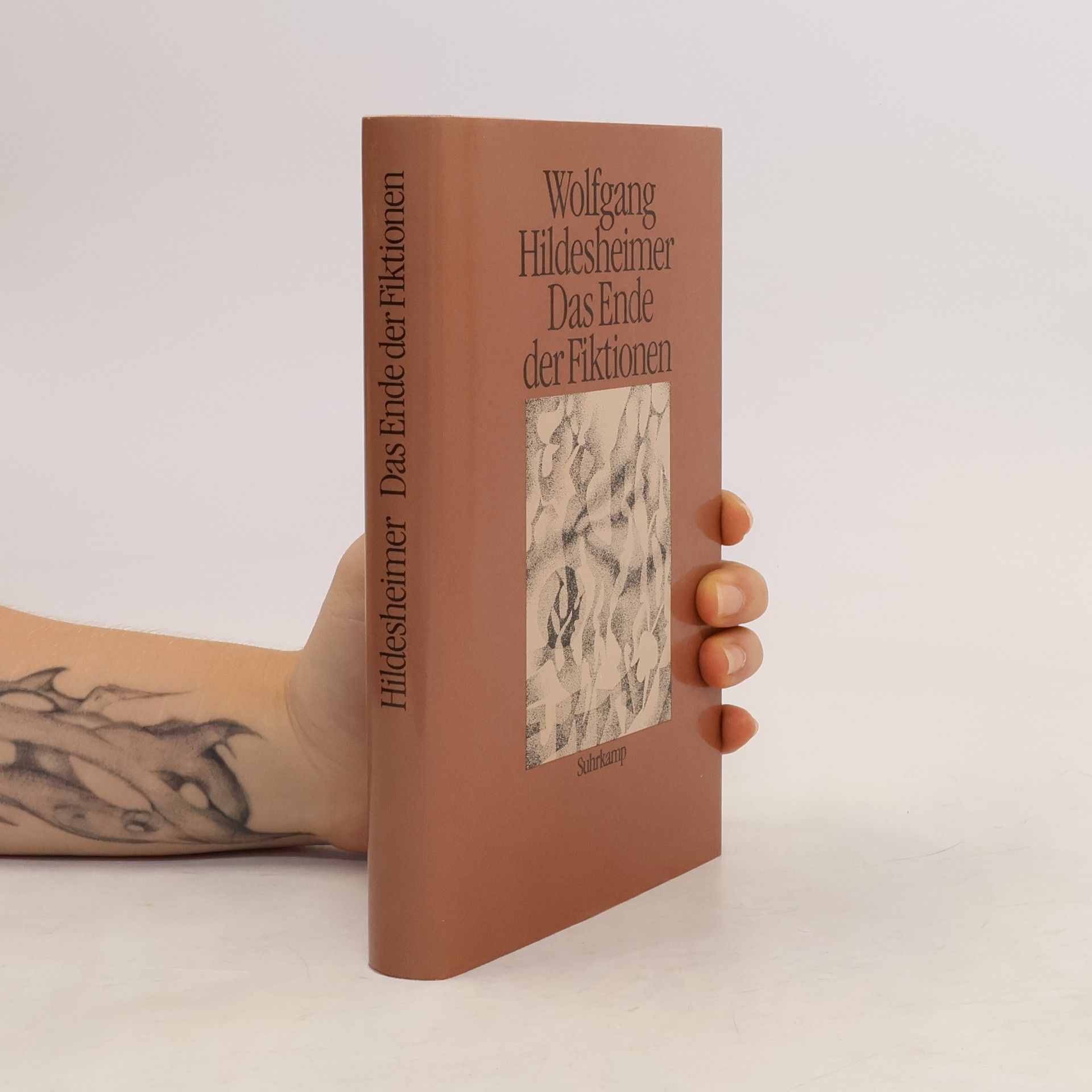
Eine Harfe ohne Saiten oder wie man Romane schreibt
- 64 Seiten
- 3 Lesestunden
R(onald) F(rederic) Melf ist einer der bedeutendsten Romanciers seiner Zeit. Im späten Herbst – genauer gesagt: am achtzehnten November jedes zweiten Jahres – beginnt Melf mit einem neuen Roman. Edward Gorey beschreibt und zeichnet in ›Eine Harfe ohne Saiten‹ die Mühsal des schöpferischen Prozesses und die Qualen, die ein Autor erleiden muss, bis aus einem Titel, für den noch kein Stoff existiert, ein Manuskript wird und sogar ein fertiges Buch; er erzählt von den Schwierigkeiten im Umgang mit solch weltlichen Institutionen wie Verlag und Buchhandel, von den postnatalen Depressionen ganz zu schweigen. ›Eine Harfe ohne Saiten‹ ist eine Art frühe Graphic Novel über einen Novellisten.
Für Italien, das Land, »dessen Nationalcharakteristica ihm am meisten liegen« und das er schon früh kennenlernte, hat Wolfgang Hildesheimer immer wieder Worte gefunden, die über Empathie und Herzlichkeit weit hinausgingen: Worte der Faszination, ja der Liebe. Zweimal werden Hildesheimer und seine Frau Silvia jenseits der Alpen seßhaft: in der Cal Masante di Sopra bei Urbino und im graubündischen Poschiavo, »das eigentlich geographisch zu Italien gehört«. Hier wird er so lange leben wie an keinem anderen Ort. Es ist ein guter, fruchtbarer Boden für Hildesheimers Schreiben und Malen, aber auch für den unmittelbaren Genuß des Lebens: der Begegnung mit den Menschen, ihrer Landschaft und, nicht zuletzt, ihrer Küche. Dietmar Pleyer läßt Hildesheimers Beziehung zu Italien und Poschiavo in diesem abwechslungsreich komponierten Buch anschaulich werden. Ausgewählte Textstellen aus Notaten, Schriften, Gesprächen und vielen unveröffentlichten Briefen sowie die zahlreichen bislang unpublizierten Abbildungen ergänzen sich zu einer liebenswerten Hommage Hildesheimers an Land, Sprache und Menschen, an »eine geradezu horazische Idylle, wie sie eigentlich nicht mehr erlaubt ist«.
Sir Andrew Marbot (1801–1830) byl anglický šlechtic, především však zřejmě první skutečný kritik výtvarného umění, který sám sice nebyl tvůrcem, ale malířství rozuměl jako senzitivní člověk. Dovedl se zamýšlet nad vztahem umělce a jeho díla a patrně jako první si položil otázku, která vlastně dodnes nebyla zodpovězena: „Umělec hraje na naši duši, kdo však hraje na duši umělcovu?“ Dva roky po jeho záhadné smrti byl vydán výbor z jeho celoživotních Zápisků, v nichž nesystematicky soustředil své názory na malířství a umění vůbec. Během svého života a cest do Paříže, Německa a zejména Itálie se setkal s celou řadou slavných současníků: s Goethem, Byronem, Berliozem, Blakem, Corotem, Delacroixem či Turnerem, na něž pohlížel obdivně i tvrdě kriticky, což se nebál vyslovit nahlas. Byl také milencem Goethovy snachy a Byronovy milenky.
Wolfgang Hildesheimer, geboren am 9. Dezember 1916 in Hamburg als Sohn jüdischer Eltern, emigrierte 1933 über England nach Palästina. Dort absolvierte er eine Schreinerlehre und begann 1937 an der Central School of Arts and Crafts in London mit dem Studium von Malerei, Textilentwurf und Bühnenbildnerei. 1939 entwarf er sein erstes Bühnenbild für das Tavistock Little Theatre. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kehrte er nach Palästina zurück, arbeitete als Information Officer und Englisch-Lehrer, und war Mitinhaber einer Werbeagentur. Er nahm an Kunstausstellungen teil und veröffentlichte Gedichte und Essays. 1946 kehrte er nach London zurück, wurde jedoch für die Nürnberger Prozesse engagiert und dolmetschte dort. 1949 zog er nach Ambach am Starnberger See, wo er als freier Maler und Grafiker arbeitete und 1950 seine literarische Karriere mit einer Kindergeschichte begann. 1951 wurde er zur Gruppe 47 eingeladen, und 1955 feierte sein erstes Theaterstück Premiere. 1957 ließ er sich in Poschiavo nieder und entwickelte neue Theaterformen. Sein Prosabuch Tynset erhielt 1966 den Georg-Büchner-Preis. Sein Bestseller Mozart (1977) beeinflusste das Stück und den Film Amadeus. Ab 1961 nahm er wieder an Ausstellungen teil, und 1980 hielt er die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele. 1984 kündigte er an, angesichts der Umweltkatastrophe zur bildenden Kunst zurückzukehren.
Insel-Bücherei - 1161: Janssen und wir
- 63 Seiten
- 3 Lesestunden
Wolfgang Hildesheimer Marbot: Eine Biographie
- 326 Seiten
- 12 Lesestunden
Wolfgang Hildesheimer, geboren am 9. Dezember 1916 in Hamburg als Sohn jüdischer Eltern, emigrierte 1933 über England nach Palästina. Dort absolvierte er eine Schreinerlehre und begann 1937 an der Central School of Arts and Crafts in London mit dem Studium von Malerei, Textilentwurf und Bühnenbildnerei. 1939 gestaltete er sein erstes Bühnenbild am Tavistock Little Theatre in London. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kehrte er nach Palästina zurück, wo er als Information Officer und Englisch-Lehrer arbeitete und eine Werbeagentur leitete. 1946 kehrte er nach London zurück, wurde jedoch für die Nürnberger Prozesse engagiert. 1947 dolmetschte er in Nürnberg und nahm an Kunstausstellungen teil. 1949 ließ er sich in Ambach am Starnberger See nieder und begann seine literarische Karriere mit einer Kindergeschichte. 1951 wurde er zur Gruppe 47 eingeladen, 1955 erhielt er den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Nach seinem Umzug nach München 1953 siedelte er 1957 nach Poschiavo über und entwickelte eine neue Art von Theaterstücken. Sein Prosabuch Tynset wurde 1966 ausgezeichnet, und sein Bestseller über Mozart beeinflusste das Theaterstück und den Film Amadeus. Hildesheimer war auch als bildender Künstler aktiv und kündigte 1984 an, angesichts der Umweltkatastrophe zur Kunst zurückzukehren.
Contents: Der Drachenthron -- Die Herren der Welt -- Pastorale oder Die Zeit für Kakao -- Landschaft mit Figuren -- Die Uhren -- Der schiefe Turm von Pisa -- Das Opfer Helena -- Die Verspätung -- Nachtstück -- Mary Stuart.