Der belgische Schriftsteller und Maler als Reisender durch die Kulturen Asiens. Kalkutta, Nepal, Ceylon, China, Japan, Malaysien, Java und Bali. Michaux erfährt die Exotik in jenem Zwischenbereich, in dem die traditionelle Ethnographie und Reiseliteratur nicht mehr und der moderne „entzauberte“ Massentourismus noch nicht das Terrain für sich monopolisiert haben. Der Reisende wehrt sich gegen den Sog der hinduistischen bzw. buddhistischen Transzendentalität und betrachtet seine Reisen als 'imaginäre Reisen', die sich gewissermaßen ohne ihn verwirklichen. Mit Naivität, eingestandener Ignoranz und der Frechheit, alles zu entmystifizieren, beschreibt er daher keine reale Reise, selten nur Vorkommnisse und Anektoten, sondern er versucht sich an einer ungenierten Typologie 'des Inders, des Chinesen, des Japaners' etc. Wie in den zur selben Zeit entstehenden Schriften der Surrealisten erschafft Michaux aus den Bruchstücken einer (allerdings sehr genau beobachteten) äußeren Wirklichkeit einen sehr bissigen, die Sanftheit des Impressionismus immer meidenden Ton. In wenigen Fußnoten, die erst 1967 dem Text hinzugefügt werden, gibt er der sozialen Wirklichkeit reales Gewicht, indem die historischen Ereignisse, die in Indien zum Sieg der Bemühungen Gandhis und der Aufweichung der Kastenherrschaft führten und in China zur Revolution bzw. zur ›Kulturrevolution‹ der 60er Jahre, in ihrer Wirkkraft kurz und prägnant evoziert werden.
Henri Michaux Bücher
Henri Michaux war ein sehr eigenwilliger belgischer Dichter, Schriftsteller und Maler, der in französischer Sprache schrieb. Er ist am besten für seine esoterischen Bücher in einem sehr zugänglichen Stil bekannt, wobei sein Gesamtwerk Poesie, Reiseberichte und Kunstkritik umfasst. Michaux reiste ausgiebig und experimentierte mit Drogen, was zu zwei seiner faszinierendsten Werke führte.

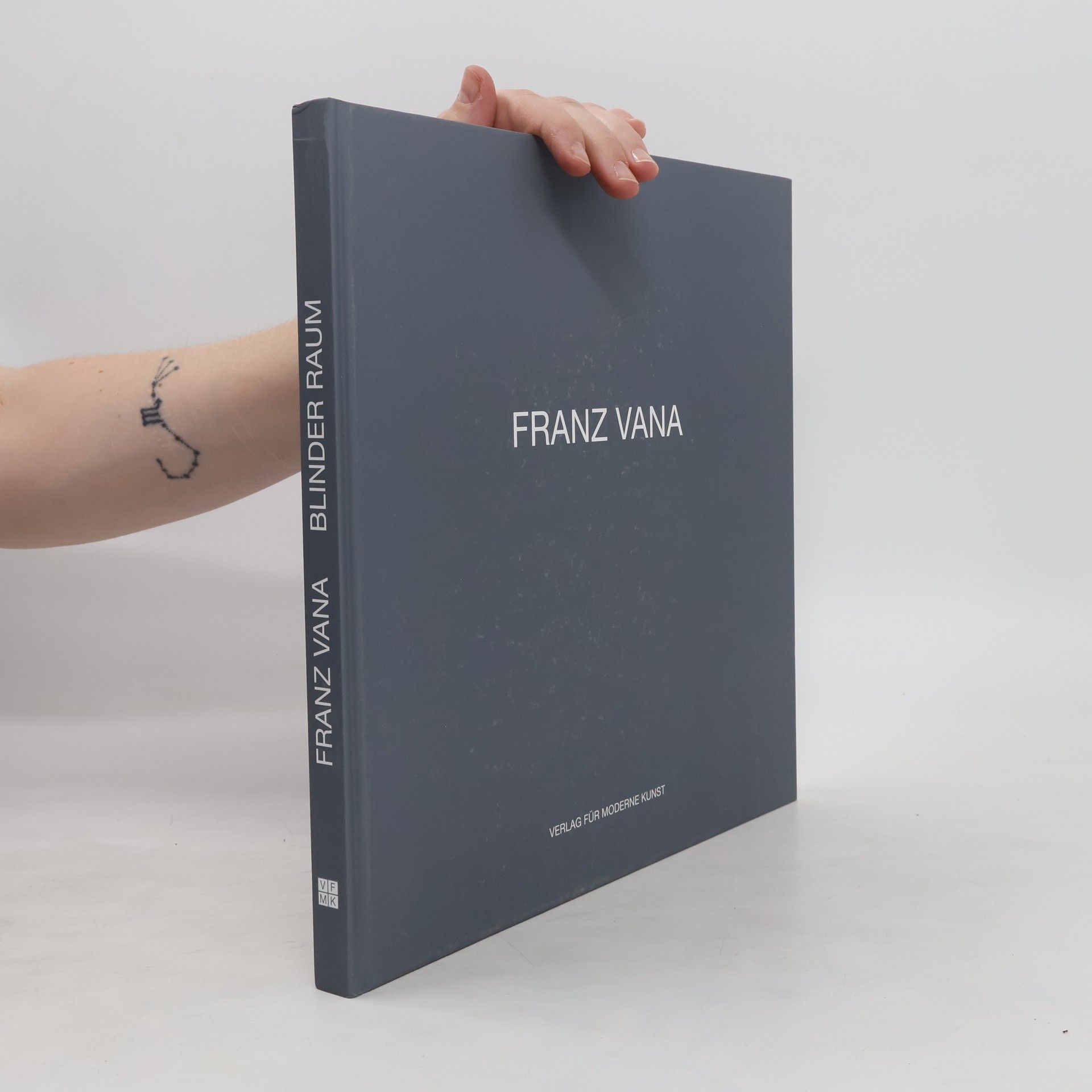
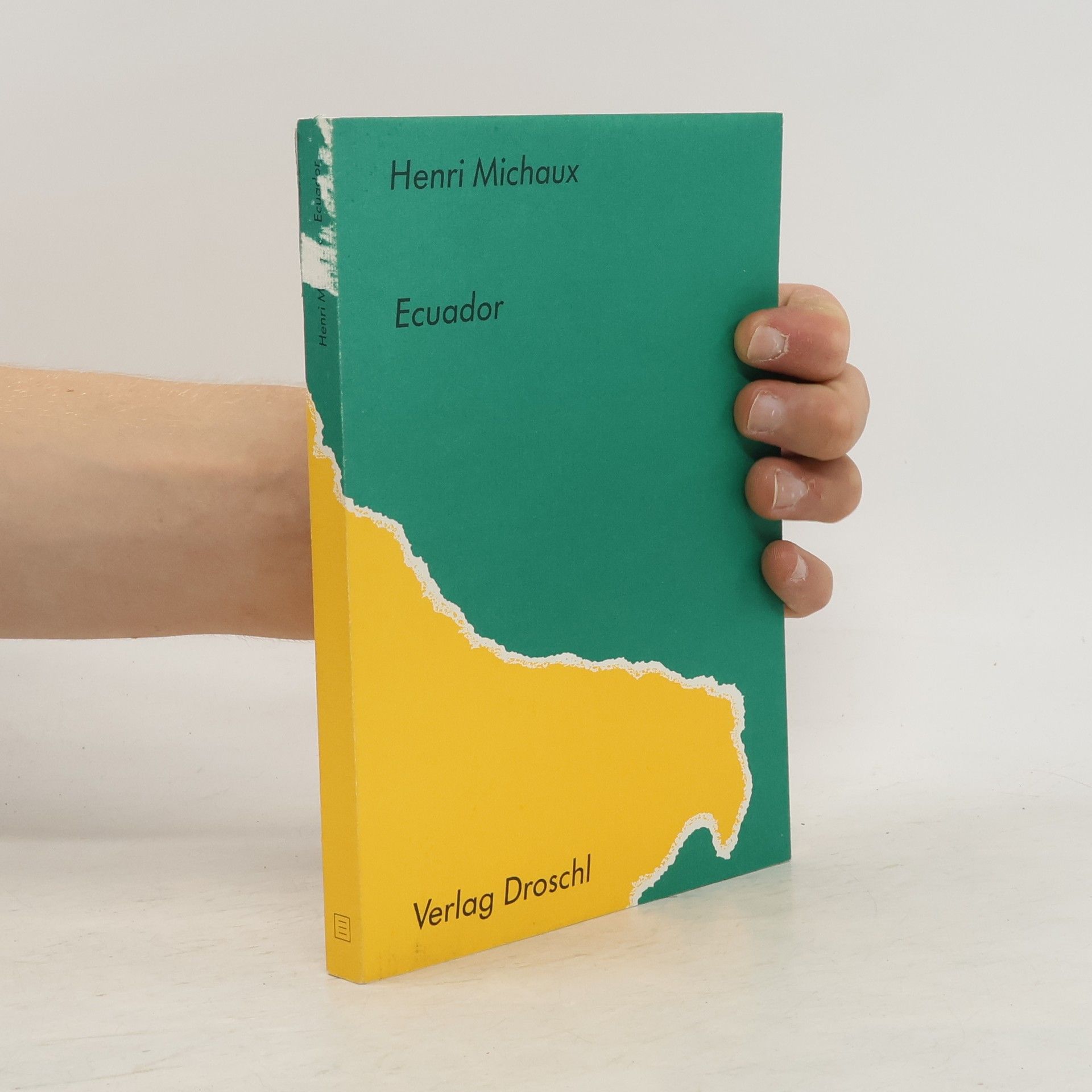

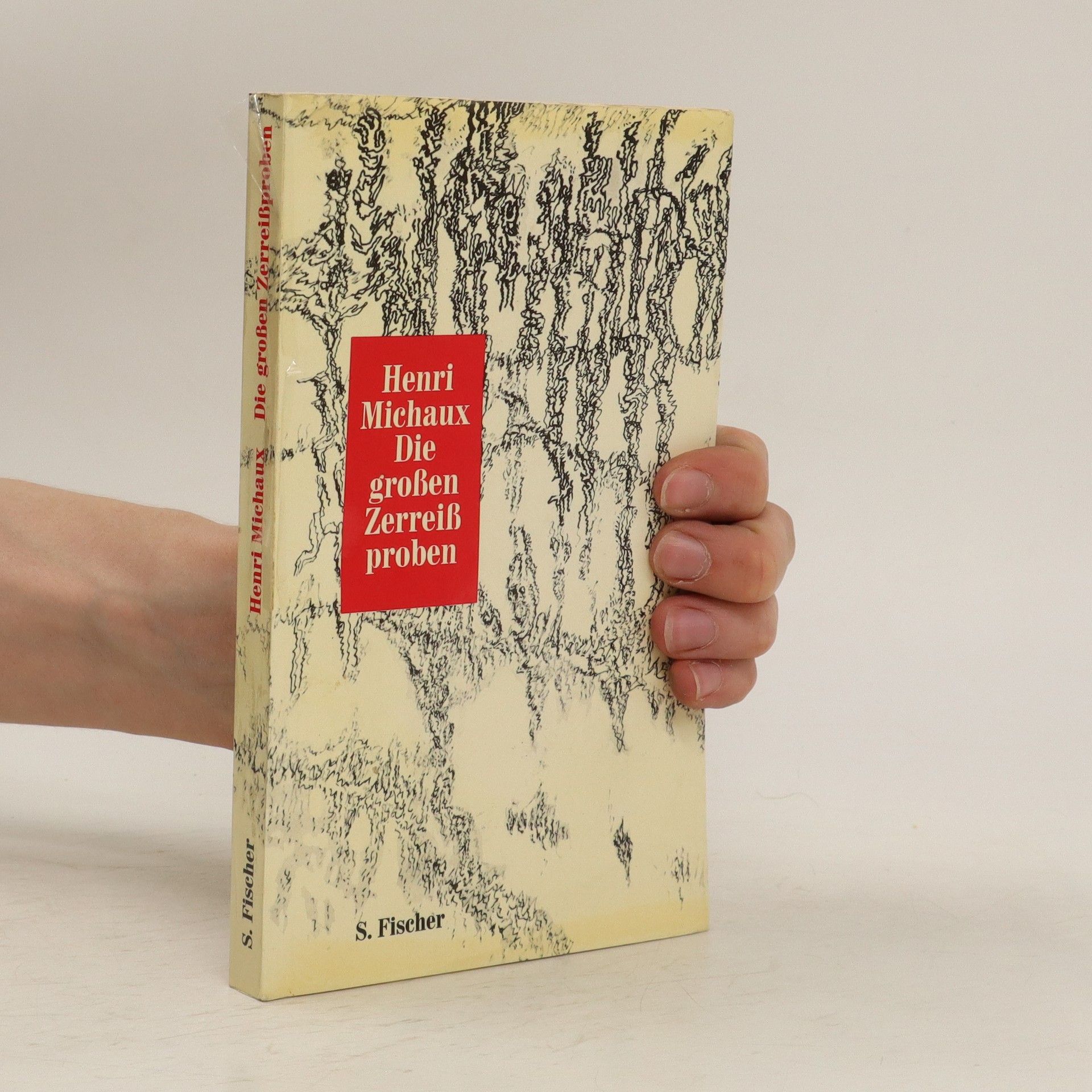
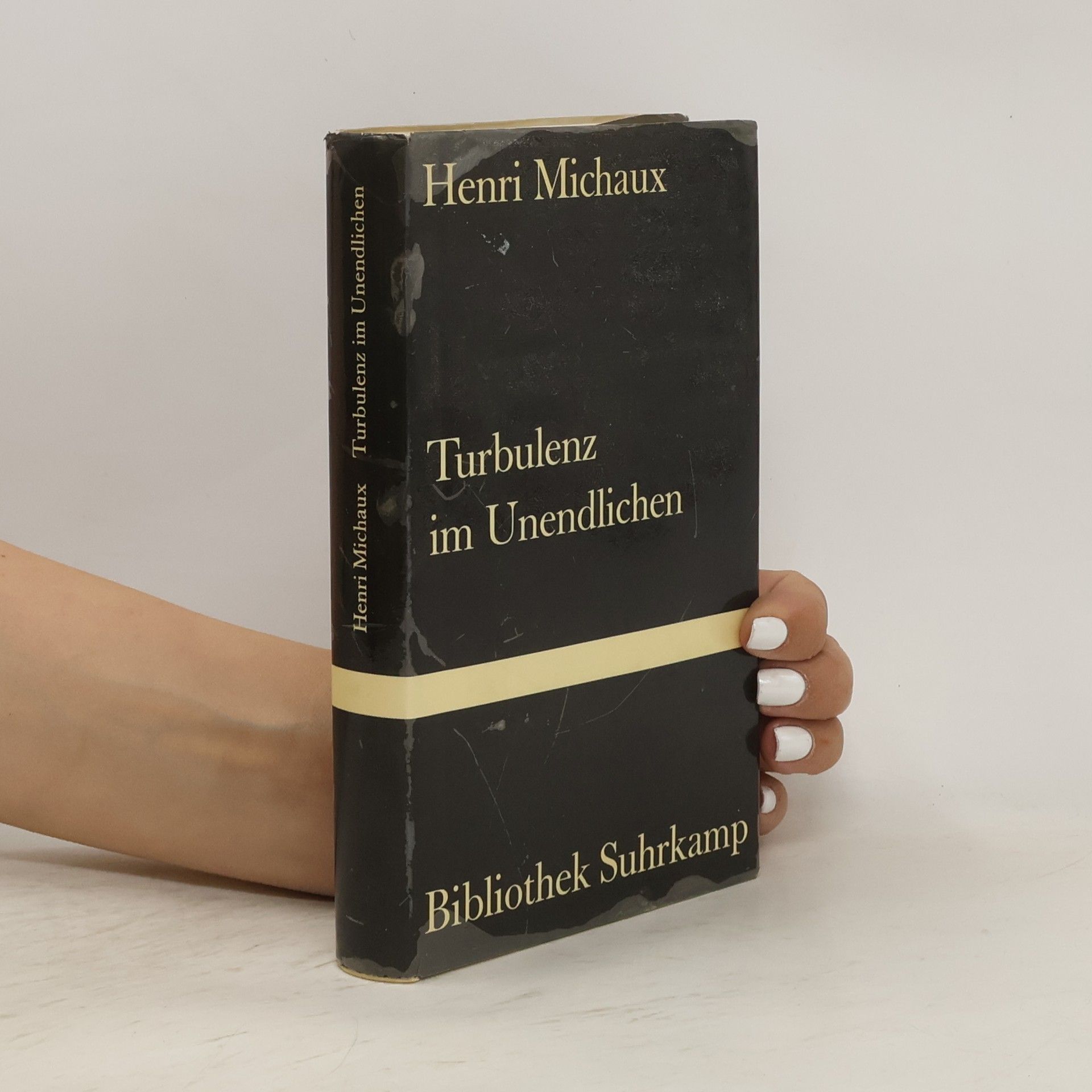

Henri Michaux, der 1899 geborene, bedeutende belgische Schriftsteller und Maler begab sich früher als die Zeitmode in das Abenteuer der Droge. In seinen Meskalin-Versuchen entdeckt Michaux, dieser »Sindbad des Geistes«, wie André Gide ihn nannte, Neuland des Bewußtseins. Sein Buch, die Texte wie die Zeichnungen, führen den Leser ein in die Ästhetik, Ethik und Metaphysik der Droge; es ist ein Forschungsbericht, existentielle Prosa und mythischer Text zugleich. Die Droge als Abenteuer, die Droge aber auch als Höllenfahrt, als Gefängnis der Unendlichkeit, als Erkenntnis der Abgründe und Enttäuschung, eine »schlecht verdiente Unendlichkeit«. »Henri Michaux ist ein Sprachkünstler hohen Ranges. Er gibt keine stammelnden Protokolle. Seine Prosa – von Kurt Leonhard brillant ins Deutsche übertragen – sind durchgearbeitete Texte.« Günter Blöcker, Frankfurter Allgemeine Zeitung »In der Radikalität seiner Einsichten übertrifft er die, die mit ihm vergleichbar sind, also etwa Borges oder Beckett. Auch wenn man ihn unaufmerksam liest, kann man den Vorgang dieser Lektüre schwerer rückgängig machen als bei anderen Autoren.« Helmut Heißenbüttel
Ecuador
- 160 Seiten
- 6 Lesestunden
„Ecuador“ ist das Tagebuch einer Reise, die Michaux ein Jahr lang durch alle Teile dieses südamerikanischen Landes führt, vom Pazifik bis zu den Andengipfeln, und in einer abenteuerlichen Bootsfahrt über den Amazonas wieder zum Atlantik. Anders als sein Buch über seine Reise nach Indien und China ist das Reisetagebuch „Ecuador“ ausgesprochen lyrisch – es enthält auch einige der schönsten Gedichte des jüngeren Michaux. Die Mischung aus aktionsreichen, abenteuerlichen Passagen und rücksichtslosen Selbstreflexionen eines Reisenden, der dem Fremden gegenübersteht und nicht gewillt ist, das Andere allein um seiner selbst willen ideologisch ab- oder auch aufzuwerten, bringt einen auch heute noch immer gültigen (und sehr sympathischen) Text zuwege, dessen größter Feind das Belletristische ist.
BLINDER RAUM ist die erste größere Monografie des südburgenländischen Künstlers FRANZ VANA. Sie bietet Einblick in sein grafisches Werk von 1972 bis 2021. Seine eigenwillige, abstrakte wie gegenständliche Formensprache verwebt witzreiche Wortspiele, geometrische Fragmente und zuweilen fantasiereiche Motive auf Bildflächen. Die größtenteils monochromen Grafitarbeiten zeugen von einem subtilen Empfinden für Körper, Formen, Licht und Schatten. Eine Werkmonografie mit Textbeiträgen von Barbara Horvath, Henri Michaux, Franz Vana und Martin Zeiller.
Gong bin ich. Lyrik und kurze Prosa
- 299 Seiten
- 11 Lesestunden
Auswahl von Ralf Pannowitsch mit einem Nachwort von Eberhard Geisler, umfasst 299 Seiten.
Passagen
- 160 Seiten
- 6 Lesestunden
"Passagen" ist eine Sammlung von Texten von Michaux aus den Jahren 1937–50, die Malerei, Musik und künstlerische Produktion thematisieren. Der Band erforscht Übergänge zwischen Realem und Irrealem sowie zwischen Wahrnehmung und Imaginärem und bietet eine Poetik des Fragments und der Diskontinuität.
Im Lande der Zauberei & Hier Poddema
- 124 Seiten
- 5 Lesestunden
"Hier Podemma" ist eine dystopische Vision, die die Anthropologie des untergegangenen NS-Regimes reflektiert und in die Zukunft der Genmanipulationen weist. Der Autor zeigt eine surrealistische Freude an absurden und witzigen Einfällen, wie etwa unerwarteten Meereswellen auf der Landstraße.
Reise nach Groß- Garabannien
- 126 Seiten
- 5 Lesestunden



