Moderne Arbeit in der Bundesverwaltung
Digital, flexibel und gesund
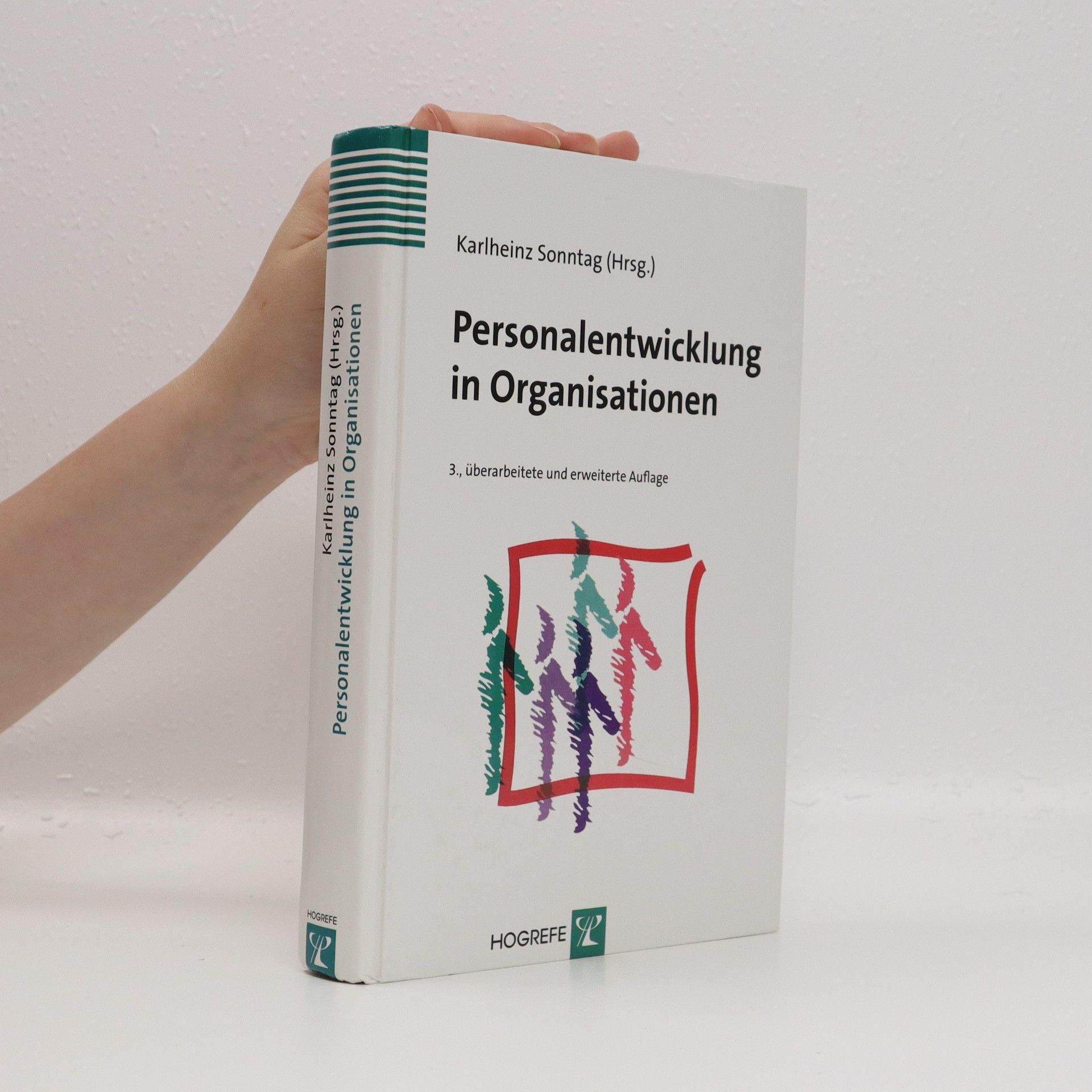

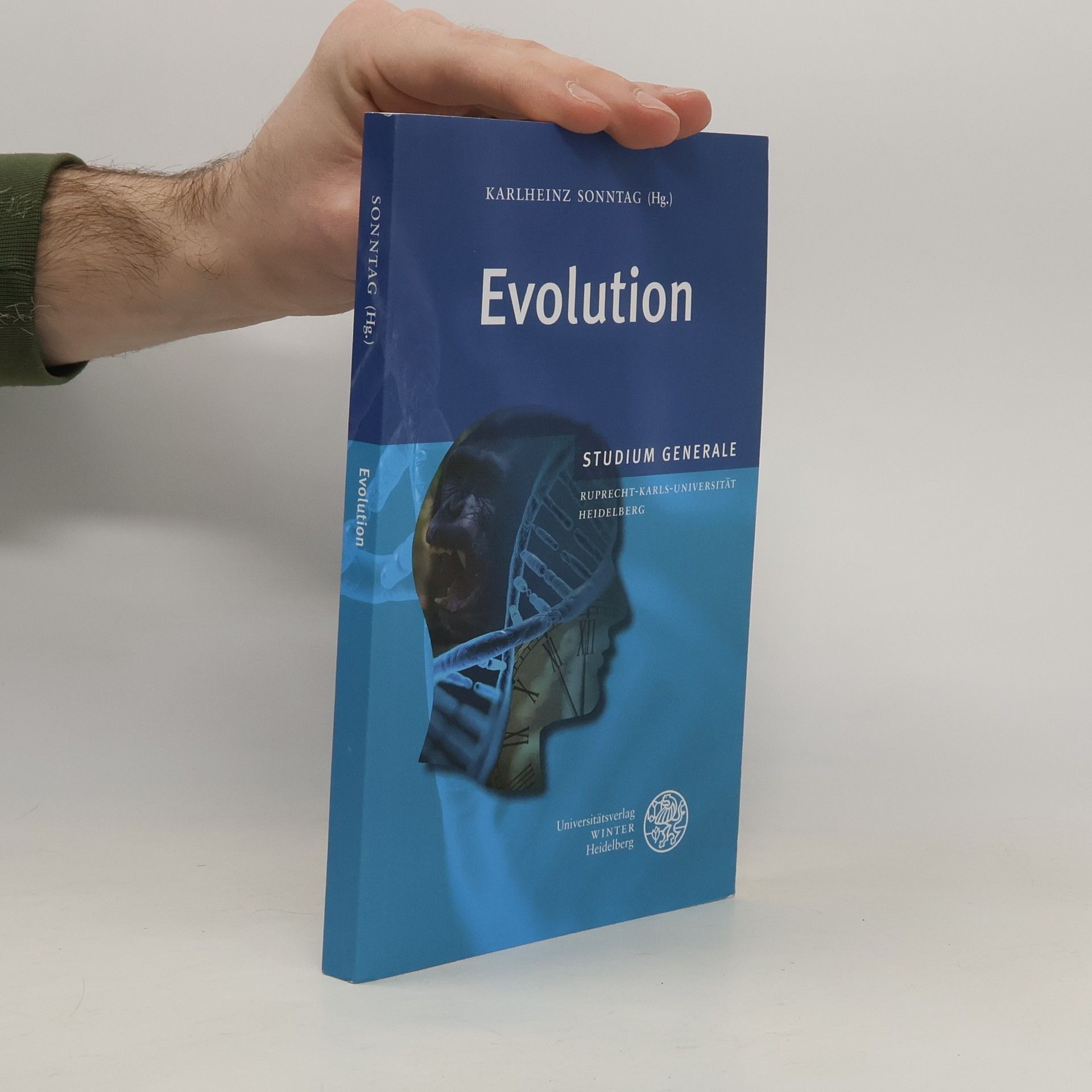


Digital, flexibel und gesund
Das Projekt MEgA
Natur und Leben zeichnen sich durch Vielfalt und Komplexität aus. Mit der Entstehung dieser Vielfalt, den Veränderungen, Entwicklungen sowie deren Regulation beschäftigt sich die Evolutionstheorie. „Evolution verstehen“ war das Thema des Heidelberger Studium Generale im Sommersemester 2013. In der Tat haben wir noch längst nicht alles verstanden, wie Entwicklungen zu meist höheren komplexeren Lebensformen vor sich gehen. Was sind die Grundlagen unserer vermeintlich hohen kognitiven Fähigkeiten, die uns im Verlauf der Evolution zum Homo Sapiens machten? Warum können Rabenvögel kognitive Leistungen vollbringen, die auf dem Niveau von Schimpansen und darüber liegen, obwohl sie über keinen Kortex verfügen, der erst die Voraussetzung für höhere kognitivere Leistungen darstellt? Warum haben sich trotz eines gemeinsamen Vorfahren Quastenflosser und Menschen unterschiedlich entwickelt? Antworten auf all diese fundamentalen Fragen sucht die Evolutionsforschung. Wie aber gehen wir mit den Erkenntnissen der Evolutionsforschung um? Beeinflussen sie unser Selbstbewusstsein? Welche Auswirkungen haben die Schlussfolgerungen auf Religion und Politik?
Der Übergang zur Wissensgesellschaft, technologische Innovationen, die Auflösung fester Berufsverläufe sowie die zunehmende Flexibilisierung von Arbeit fordern von Mitarbeitern und Führungskräften, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten durch kontinuierliches Lernen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Um der Dynamik der Lernbedarfe gerecht zu werden, müssen Lernen und Arbeit in Konzeption und Gestaltung stärker verbunden werden. Arbeitsorientiertes Lernen bietet hierfür einen neuen Ansatz. Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Frage, wie Lernen direkt in der Arbeit gestaltet werden kann und wie der Arbeitsbezug in Lernumgebungen zu verbessern ist. Hierzu werden psychologische Grundlagen und Modelle, praxisorientierte Gestaltungsansätze sowie Analyseinstrumente und Methoden dargestellt und diskutiert.
Die Analyse und Gestaltung des Entwicklungspotenzials von Mitarbeitern und Führungskräften ist eine zentrale Aufgabe in allen Organisationen. Dieses Buch beschäftigt sich zunächst mit Personalentwicklung aus der Sicht unterschiedlicher psychologischer Disziplinen, z. B. mit der Veränderbarkeit von Persönlichkeitsmerkmalen oder den Lern- und Entwicklungspotenzialen in der Arbeit. Darüber hinaus bietet der Band konkrete Maßnahmen, Methoden und Strategien zur Feststellung des Entwicklungspotenzials und -bedarfs, zur kompetenzförderlichen und transferorientierten Trainingsgestaltung sowie zur Evaluation. In dieser überarbeiteten und erweiterten Auflage des Buches wurden ergänzend Kapitel zur Organisationsdiagnose und zur Bedeutung der Personalentwicklung für die Unternehmensperformance aufgenommen. Das Buch liefert somit Arbeits- und Organisationspsychologen, Personalwissenschaftlern, Personalmanagern, Führungskräften sowie Personaltrainern und -beratern einen umfassenden Überblick zu den Forschungs- und Anwendungsgebieten der Personalentwicklung.