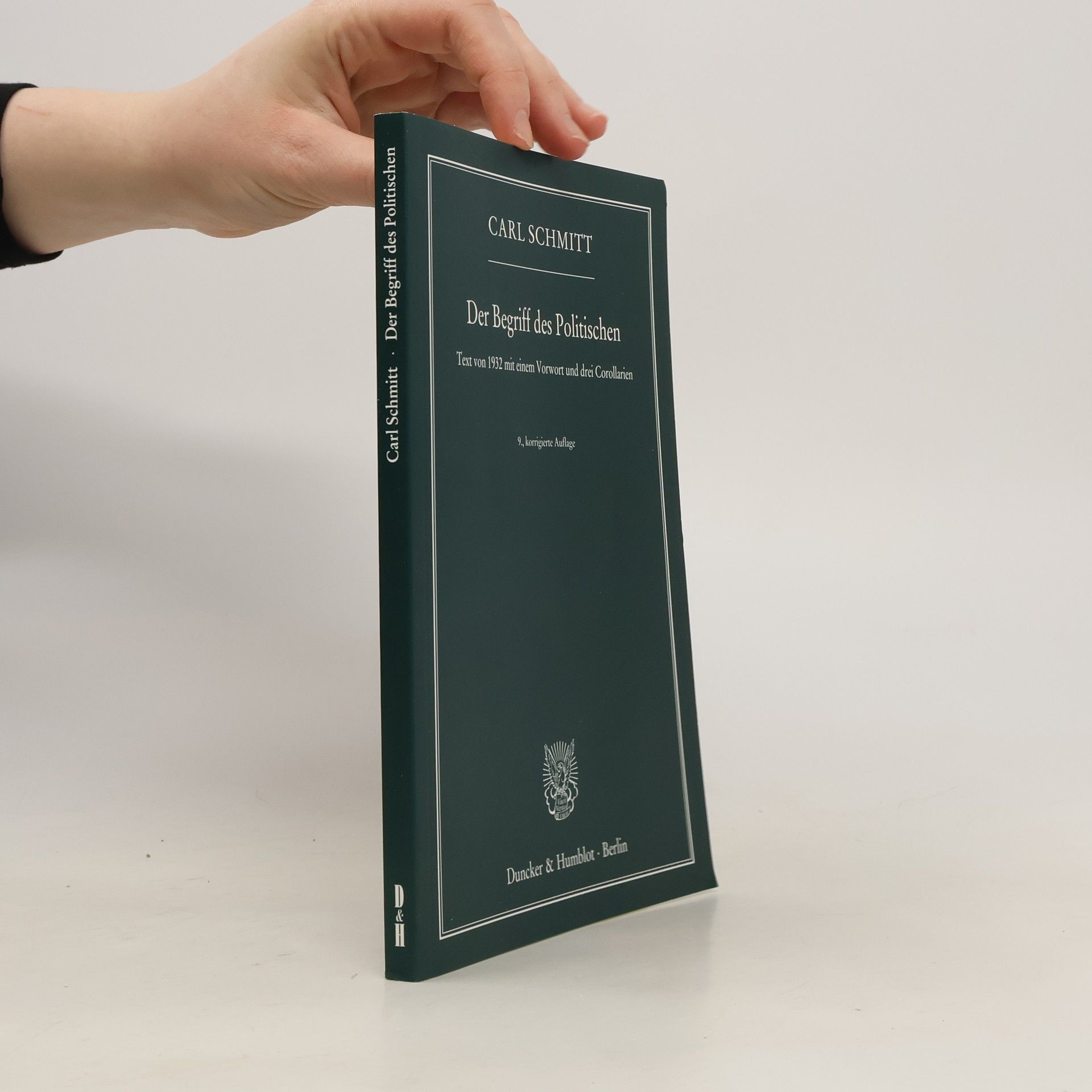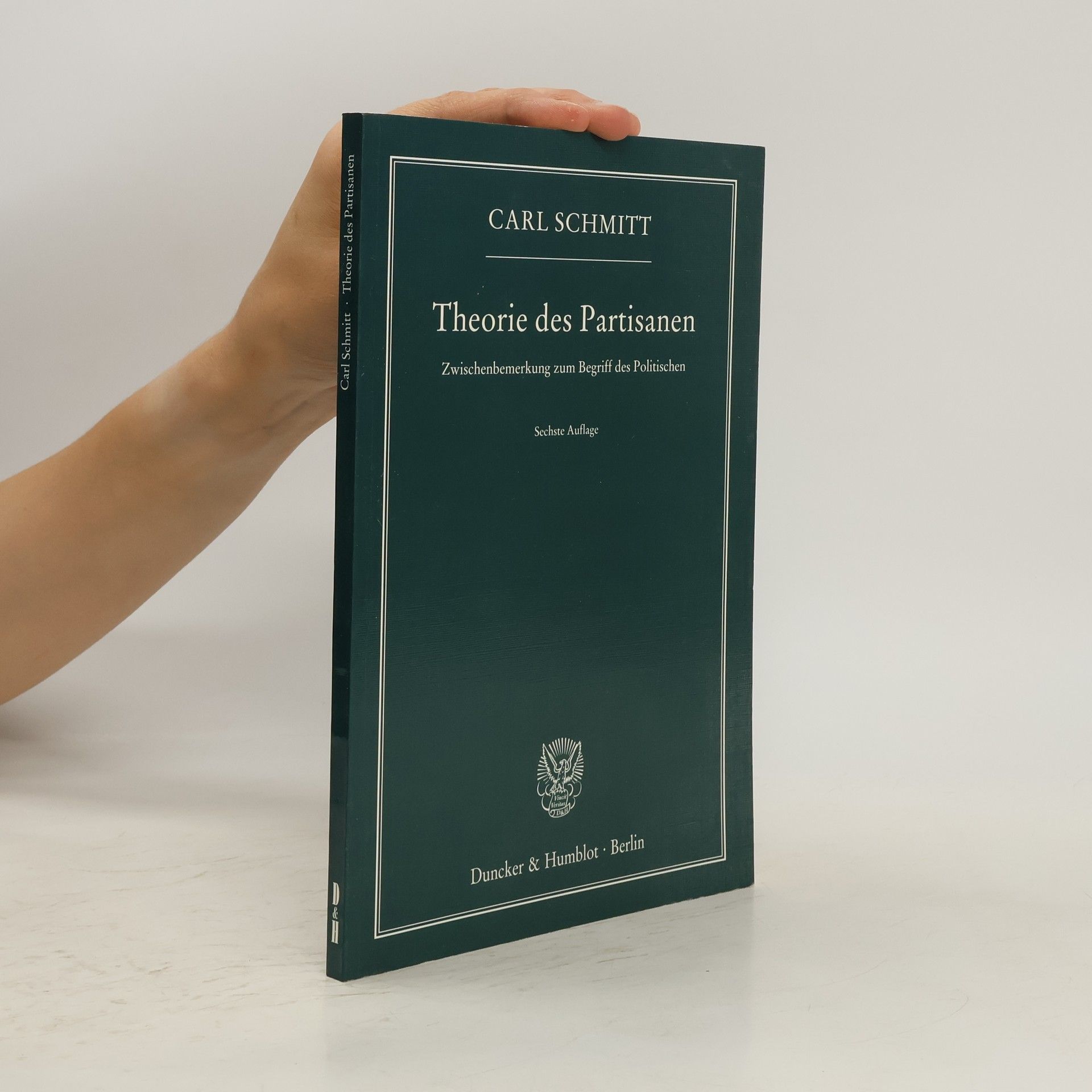»Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet« ist der erste Satz von Carl Schmitts Schrift »Politische Theologie«. Er wird national und international zitiert, oft ohne Nennung des Urhebers, so dass ein weiteres Diktum Schmitts zutrifft, dass er ›Gemeingut aller Gebildeten‹ geworden ist. Die kleine Schrift über Begriff und Problem der Souveränität, Dezisionismus, Politische Theologie als Soziologie juristischer Begriffe und die der Gegenrevolution wird seit Erscheinen im Jahr 1922 bis heute besprochen, gedeutet und kritisiert. Die 11. Auflage enthält Satzkorrekturen aus Schmitts Handexemplar und ein Personenverzeichnis.
Carl Schmitt Bücher
Carl Schmitt war ein deutscher Rechtsgelehrter, dessen einflussreiche Werke in der Weimarer Republik entstanden. Seine Theorien zur Souveränität, zur Krise der parlamentarischen Demokratie und zur Politik, die auf der Freund-Feind-Unterscheidung beruht, prägten sein Denken. Schmitt strebte danach, die Weimarer Verfassung zu verteidigen, doch seine Schriften deuteten teilweise auf eine Hinwendung zu einem autoritäreren politischen System hin. Seine spätere Arbeit widmete sich dem Völkerrecht, kritisierte den liberalen Kosmopolitismus und gipfelte in seinem grundlegenden Werk über die Grundlagen der internationalen Rechtsordnung.





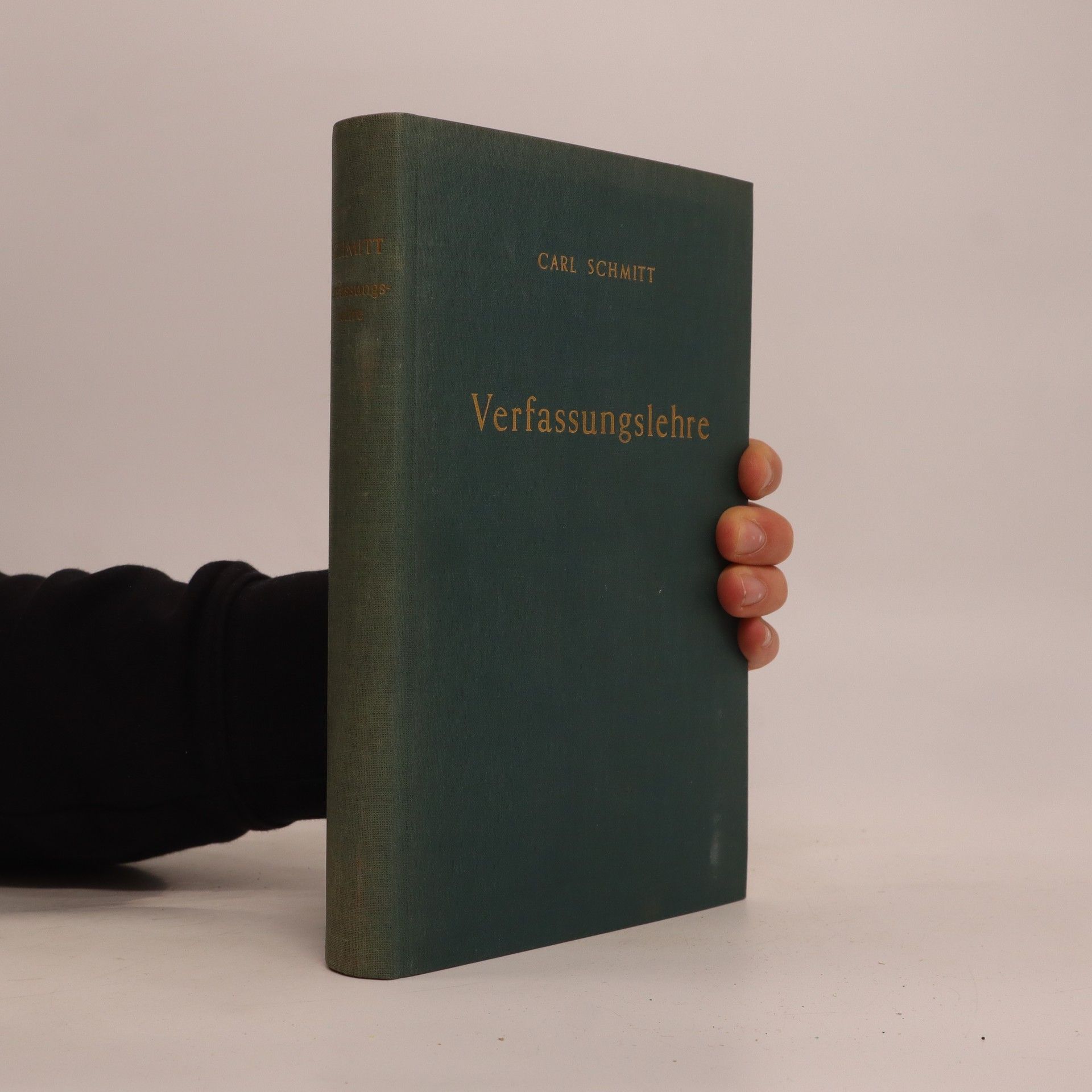

Carl Schmitt gehört nach wie vor zu den anregendsten und zugleich umstrittensten politischen Denkern des 20. Jahrhunderts. In seiner Verfassungslehre formulierte er grundsätzliche, auch heute noch immer gültige Gedanken zu einem juristischen Kernthema – weshalb sich der Verlag zur zehnten Auflage entschlossen hat. »Die vorliegende Arbeit ist weder ein Kommentar noch eine Reihe monographischer Einzelabhandlungen, sondern der Versuch eines Systems. In Deutschland liegen heute zur Weimarer Verfassung ausgezeichnete Kommentare und Monographien vor, deren hoher Wert in Theorie und Praxis anerkannt ist und keines Lobes mehr bedarf. Es ist aber notwendig, sich außerdem auch um den systematischen Aufbau einer Verfassungstheorie zu bemühen und das Gebiet der Verfassungslehre als besonderen Zweig der Lehre des öffentlichen Rechts zu behandeln.« Auszug aus Carl Schmitts Vorwort zur 1. Auflage 1928
Die Diktatur
- 259 Seiten
- 10 Lesestunden
»Zu erwähnen, daß nicht nur Bücher, sondern auch Redensarten ihr Schicksal haben, wäre eine Banalität, wenn man damit nur die im Laufe der Zeit sich abspielenden Veränderungen meinte, um durch eine nachträgliche Prognose oder ein geschichtsphilosophisches Horoskop zu zeigen, ›wie es kam, daß es kam‹. Das ist aber nicht das Interesse dieser Arbeit, die sich vielmehr um systematische Zusammenhänge bemüht und deren Aufgabe gerade darum so schwierig ist, weil ein zentraler Begriff der Staats- und Verfassungslehre untersucht werden soll, der, wenn er überhaupt beachtet wurde, höchstens beiläufig an den Grenzen verschiedener Gebiete […] undeutlich erschien, im übrigen aber ein politisches Schlagwort blieb, so konfus, daß seine ungeheure Beliebtheit ebenso erklärlich ist wie die Abneigung der Rechtsgelehrten, sich darauf einzulassen.« Aus den Vorbemerkungen zur 1. Auflage (1921) von Carl Schmitt
Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens.
- 63 Seiten
- 3 Lesestunden
»In der vierten Auflage des Buches ›Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens‹ von Carl Schmitt sind die Korrekturen und Ergänzungen berücksichtigt, die in zwei Handexemplaren vom Verfasser eingetragen wurden. Eines befindet sich im Nachlass Carl Schmitts im Landesarchiv NRW, Abtlg. Rheinland, RW 265 Nr. 27227, das andere war im Besitz des Carl Schmitt-Bibliographen Piet Tommissen. Die Korrekturstellen sind im Text durch Anmerkungen in eckigen Klammern gekennzeichnet, die Korrekturen selbst sind dem Haupttext als Anhang nach dem Register beigefügt«. Aus der Vorbemerkung zur 4. Auflage
Politische Theologie
- 72 Seiten
- 3 Lesestunden
»Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet« ist der erste Satz von Carl Schmitts Schrift »Politische Theologie«. Er wird national und international zitiert, oft ohne Nennung des Urhebers, so dass ein weiteres Diktum Schmitts zutrifft, dass er ›Gemeingut aller Gebildeten‹ geworden ist. Die kleine Schrift über Begriff und Problem der Souveränität, Dezisionismus, Politische Theologie als Soziologie juristischer Begriffe und die der Gegenrevolution wird seit Erscheinen im Jahr 1922 bis heute besprochen, gedeutet und kritisiert. Die 10. Auflage enthält Satzkorrekturen aus Schmitts Handexemplar und ein Personenverzeichnis.
Wenn zu Beginn dieser Darlegungen über »Legalität« und »Legitimität« die heutige innerstaatliche Lage Deutschlands staats- und verfassungsrechtlich als »Zusammenbruch des parlamentarischen Gesetzgebungsstaates« gekennzeichnet wird, so ist das nur als eine zusammenfassende, kurze, fachwissenschaftliche Formel gemeint. Optimistische oder pessimistische Vermutungen und Prognosen interessieren hier nicht; von »Krisen« – seien es nun biologische, medizinische oder ökonomische Krisen, Nachkriegskrisen, Vertrauenskrisen, Gesundungskrisen, Pubertätskrisen, Schrumpfungskrisen oder was immer – soll ebenfalls nicht gesprochen werden. Um die ganze Problematik des heutigen Legalitätsbegriffes, des ihm zugehörigen parlamentarischen Gesetzgebungsstaates und des aus der Vorkriegszeit überlieferten Rechtspositivismus richtig zu verstehen, bedarf es staats- und verfassungsrechtlicher Begriffsbestimmungen, welche die gegenwärtige innerpolitische Lage in ihren staatlichen Zusammenhängen im Auge behalten. Aus der Einleitung
Der Begriff des Politischen
Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien.
"Es soll ... ein Rahmen für bestimmte rechtswissenschaftliche Fragen abgesteckt werden, um eine verwirrte Thematik zu ordnen und eine Topik ihrer Begriffe zu finden. Das ist eine Arbeit, die nicht mit zeitlosen Wesensbestimmungen anfangen kann, sondern zunächst einmal mit Kriterien ansetzt, um den Stoff und die Situation nicht aus den Augen zu verlieren. Hauptsächlich handelt es sich dabei um das Verhältnis und die gegenseitige Stellung der Begriffe Staatlich und Politisch auf der einen, Krieg und Feind auf der anderen Seite, um ihren Informationsgehalt für dieses Begriffsfeld zu erkennen."--Carl Schmitt, aus dem Vorwort zur 2. Auflage
Die Tyrannei der Werte
- 91 Seiten
- 4 Lesestunden
Carl Schmitt war ein Meister der polemischen Traktate und Pamphlete, dessen literarische Form als brûlot bezeichnet werden kann – ein entflammbarer Text, der darauf abzielt, das Schiff des Gegners in Brand zu setzen. In seiner Schrift über die „Tyrannei der Werte“ wird die zentrale These bereits im Titel deutlich: Werte bieten dem Gemeinwesen und seinem Recht keinen festen Grund, sondern verschärfen dessen Probleme. Besonders wenn Werte als Mittel zur Schaffung von Gemeinsamkeit betrachtet werden, können sie destruktiv wirken. In der jungen Bundesrepublik, die nach den Verwerfungen durch Nationalsozialismus und Krieg nach Werten strebte, kritisiert Schmitt diese Haltung scharf. Obwohl seine These klar erscheint, wirft sie grundlegende Fragen auf: Auf welcher Ebene bewegt sich Schmitts Argumentation? Geht es um politische Philosophie, Ethik oder Verfassungsrecht? Schmitt selbst deutet an, dass er „Überlegungen eines Juristen zur Wert-Philosophie“ anstellt. Sein Text befindet sich somit in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen Philosophie und Jurisprudenz. Der Autor möchte sowohl Philosophen als auch Juristen ansprechen, läuft dabei jedoch Gefahr, beide zu enttäuschen.
Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus
- 89 Seiten
- 4 Lesestunden
Theorie des Partisanen
- 96 Seiten
- 4 Lesestunden
»Die Ausgangslage für unsere Überlegungen zum Problem des Partisanen ist der Guerrilla-Krieg, den das spanische Volk in den Jahren 1808 bis 1813 gegen das Heer eines fremden Eroberers geführt hat. In diesem Kriege stieß zum ersten Male Volk (...) mit einer modernen, aus den Erfahrungen der französischen Revolution hervorgegangenen, gut organisierten, regulären Armee zusammen. Dadurch öffneten sich neue Räume des Krieges, entwickelten sich neue Begriffe der Kriegführung und entstand eine neue Lehre von Krieg und Politik. Der Partisan kämpft irregulär. (...) Zu allen Zeiten der Menschheit und ihrer vielen Kriege und Kämpfe hat es Kriegs- und Kampfregeln gegeben, und infolgedessen auch Übertretung und Mißachtung der Regeln. (...) Nur ist dabei zu beachten, daß, für eine Theorie des Partisanen im ganzen, die Kraft und Bedeutung seiner Irregularität von der Kraft und Bedeutung des von ihm in Frage gestellten Regulären bestimmt wird. (...)« Aus der Einleitung