Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen
- 262 Seiten
- 10 Lesestunden
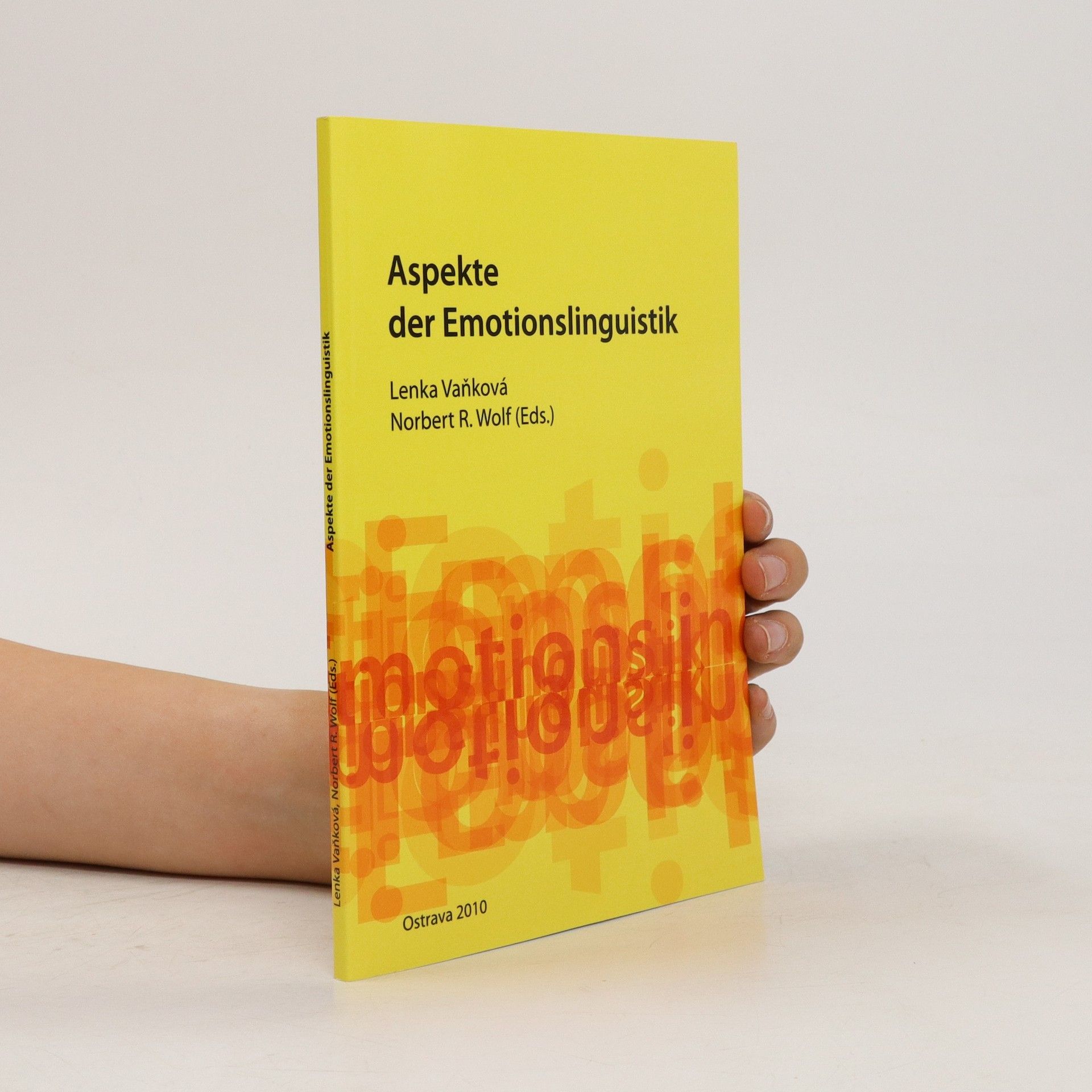
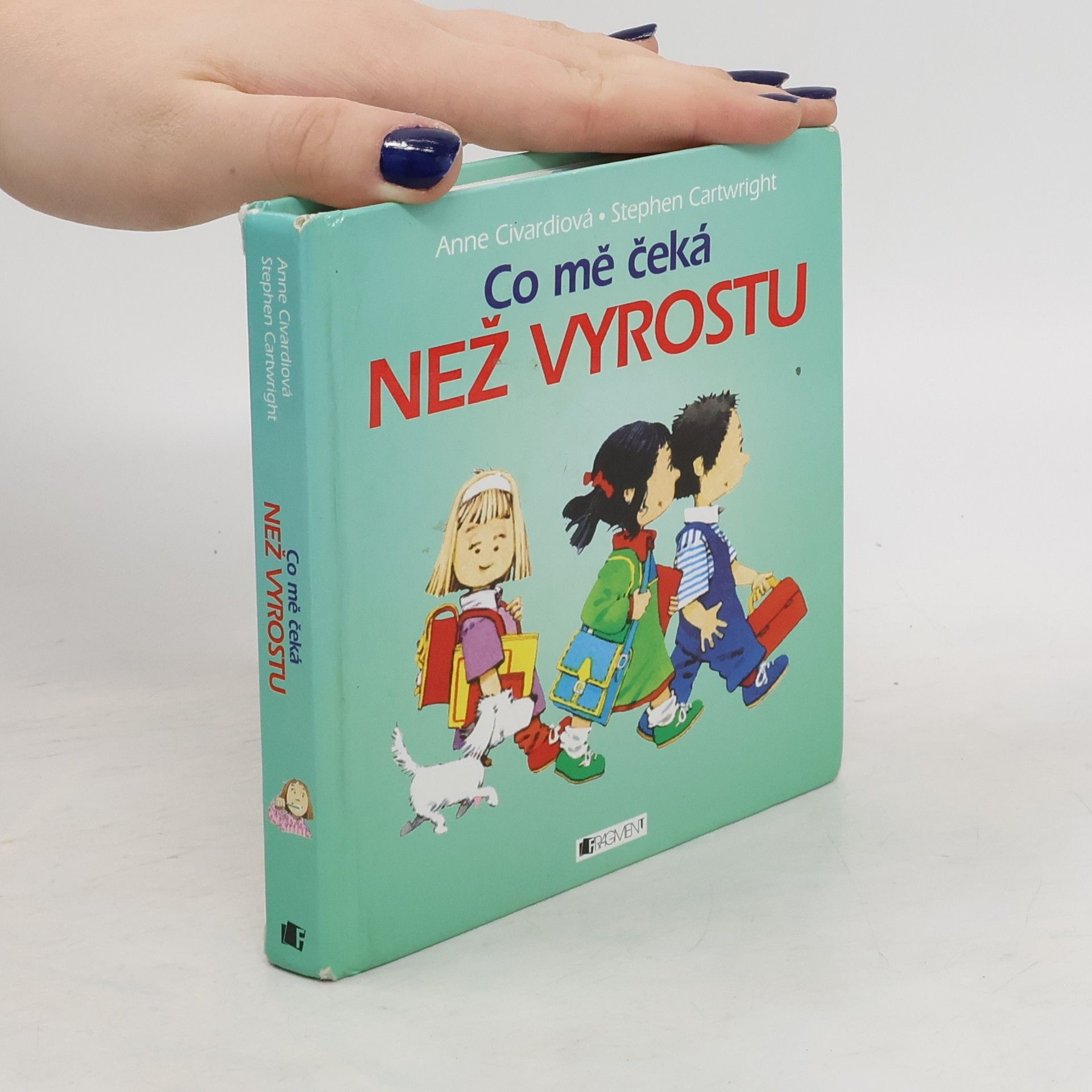

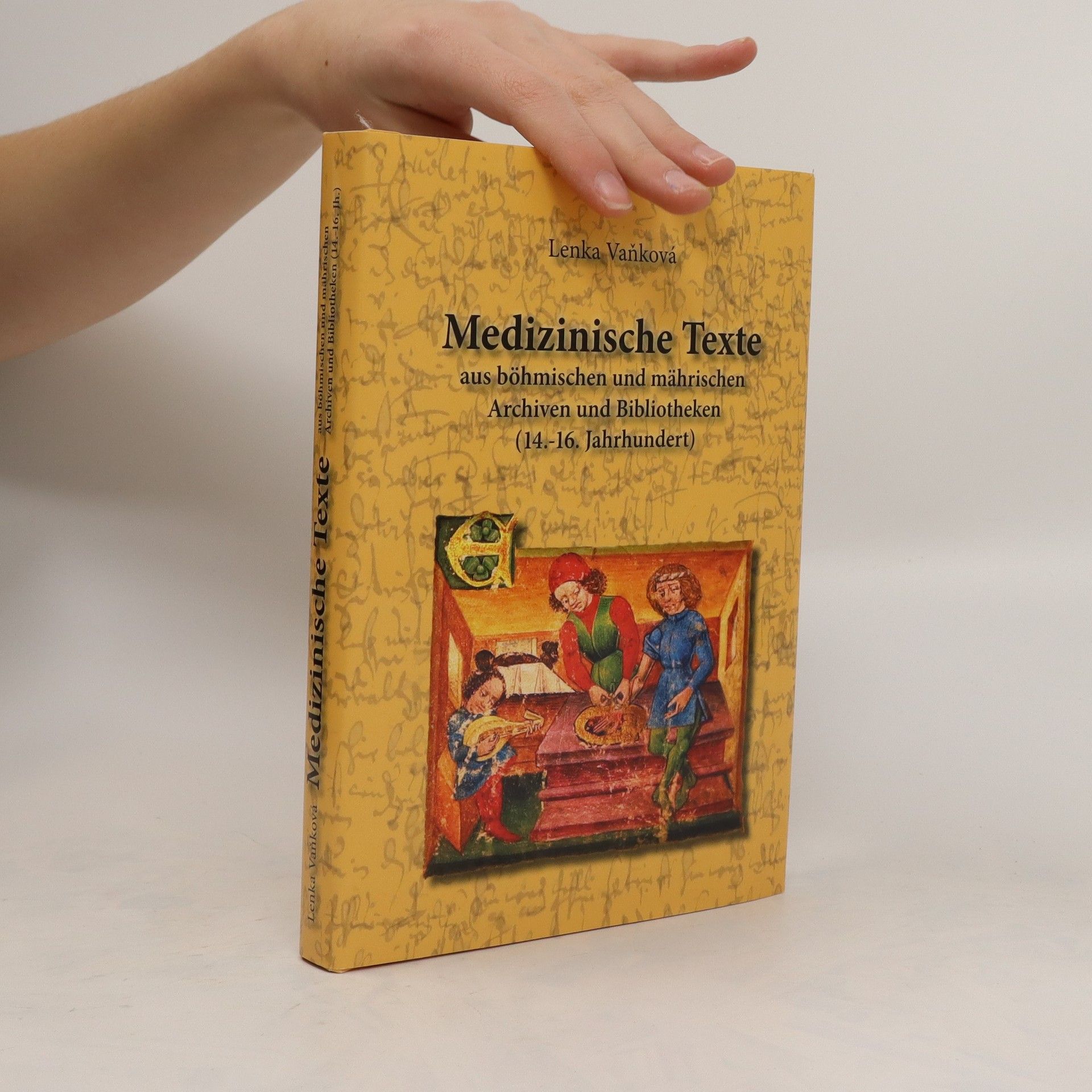
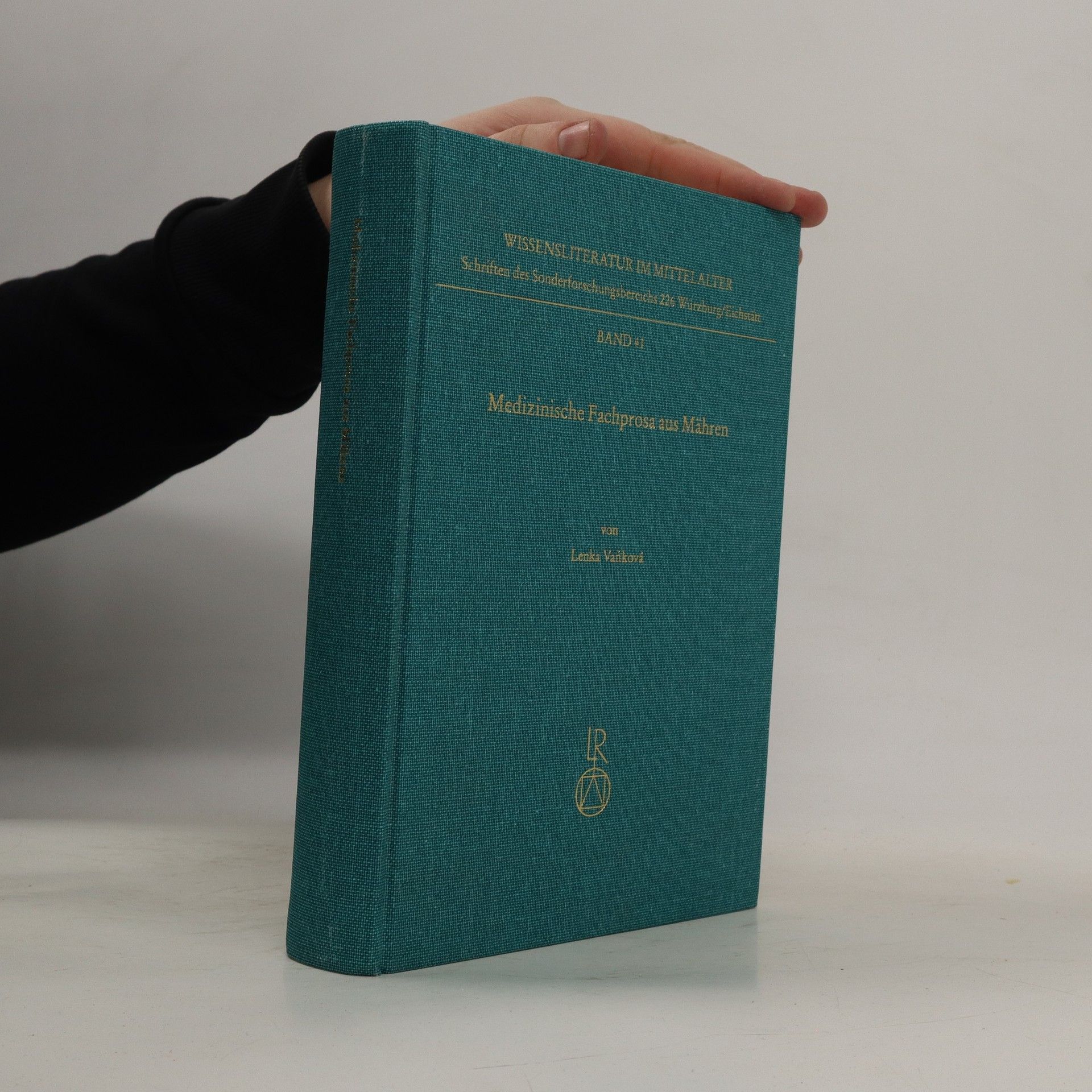

Im späten Mittelalter nahm das Angebot an deutschsprachigem medizinischem Schrifttum erheblich zu. Die Anzahl der Originalwerke wuchs, und bereits vorhandene Schriften wurden abgeschrieben und kompiliert, sodass sie in verschiedene Regionen des deutschen Sprachraums gelangten. Dies belegt einen intensiven interkulturellen Austausch, an dem auch Mähren maßgeblich beteiligt war, wie die medizinischen Texte zeigen, die heute in Olmütz aufbewahrt werden. Der zweite Teil der Arbeit präsentiert diese 15. Jahrhundert stammenden Texte, darunter das Olmützer medizinische Kompendium, das Öl-, Salben-, Pulver- und Pflasterbuch, die Wundarznei, die Chirurgie und das Kräuterbuch, und macht sie für linguistische und medizinhistorische Interessierte zugänglich. Der erste Teil beleuchtet die Stellung der untersuchten Handschriften im Kontext der deutschsprachigen medizinischen Literatur und bietet eine linguistische Analyse. Dabei werden weniger akzentuierte Aspekte der bisherigen Forschung behandelt, die auch in der Vorbereitung der Edition Anwendung finden. Die Analysen zur Syntax und ihre Auswirkungen auf die Interpunktion sowie der phonographematische Teil sind zentral. Zudem wird die Makrostruktur der Texte untersucht, und der Vergleich mit korrespondierenden Überlieferungen zeigt, dass bereits in spätmittelalterlichen medizinischen Fachschriften bestimmte Aufbaumuster erkennbar sind, auch wenn unterschiedliche Ansätze zur Inhaltspräsent
Metodikou chceme pomoci kolegům historikům, památkářům a kurátorům v lepší orientaci v módě raného novověku a relevantní zahraniční odborné literatuře, která je dostupná v elektronické podobě na webu Národního památkového ústavu. Slovníček odborných termínů z oblasti módy, módních doplňků, šperků a textilních materiálů nabízí základní orientaci v této problematice.
O tom, jaké to bude, až se mamince narodí další miminko, rodina se přestěhuje do nového domu, přibude malé štěňátko nebo když bude muset malý človíček navštívit zubaře či dokonce strávit několik dní v nemocnici, a také o dalších nových situacích v životě předškoláčka, vypráví prostě a roztomile tato kouzelně ilustrovaná knížka.
Publikace poukazuje na jazykové prostředky, jimiž se manifestuje emocionalita v písemném projevu, a nabízí několik detailních analýz literárních textů (a jednoho textu publicistického), které jsou nezbytným předpokladem projejich interpretaci.
Tyto exponáty patří mezi nejstarší a nejcennější na našich hradech a zámcích. Textová část zahrnuje tematické studie o produkci tuzemských puškařů, vojenských vůdcích a českých, moravských a slezských zbrojnicích. Dále se pokouší odpovědět na sociologické a filozofické otázky ohledně smyslu existence různých dobových zbraní. Analýza historického vývoje zbraní a zbrojí ukazuje souvislosti mezi různými styly, konstrukcemi a uživatelskými hledisky, přičemž se zaměřuje na téměř dvě stovky artefaktů z vojenství, lovectví a sběratelství z 35 sbírkových fondů. Katalog je rozdělen do pěti částí, které se věnují renesančním sbírkám šlechty, výzbroji vojáků od 17. do 19. století, lovectví, zbraním Orientu a Dálného východu a romantismu. Publikace je součástí výstavního projektu realizovaného v rámci vědeckovýzkumného projektu NAKI DF13P01OVV020, zaměřeného na hodnocení sbírkových fondů militarií.
Nahlédněte do nitra Sochy svobody, egyptské pyramidy nebo římského kolosea. Poznejte, jak se žilo na středověkém hradě. Zjistěte, která přehrada je největší na světě a jak se staví obří mrakodrapy. Zažijte vzrušující dobrodružství a zjistěte, proč a jak vznikala tato gigantická díla.
Ein aufwendig gestaltetes, großformatiges Bilderbuch, das Kinder und Erwachsene inspiriert und Begeisterung für die Tier- und Pflanzenwelt weckt. Warum haben Giraffen einen so langen Hals und Elefanten einen Rüssel? Wieso gleicht kein Hase dem anderen? Und sind Pferd, Zebra und Esel tatsächlich miteinander verwandt? All das und noch viel mehr erklärt Sabina Radeva anhand kurzer Texte und einzigartiger Illustrationen und vermittelt so anschaulich die komplexe Evolutionstheorie. Auf diese Weise verwandelt sie Darwins wissenschaftliches Werk in einen spektakulären Hingucker für alle Altersklassen.