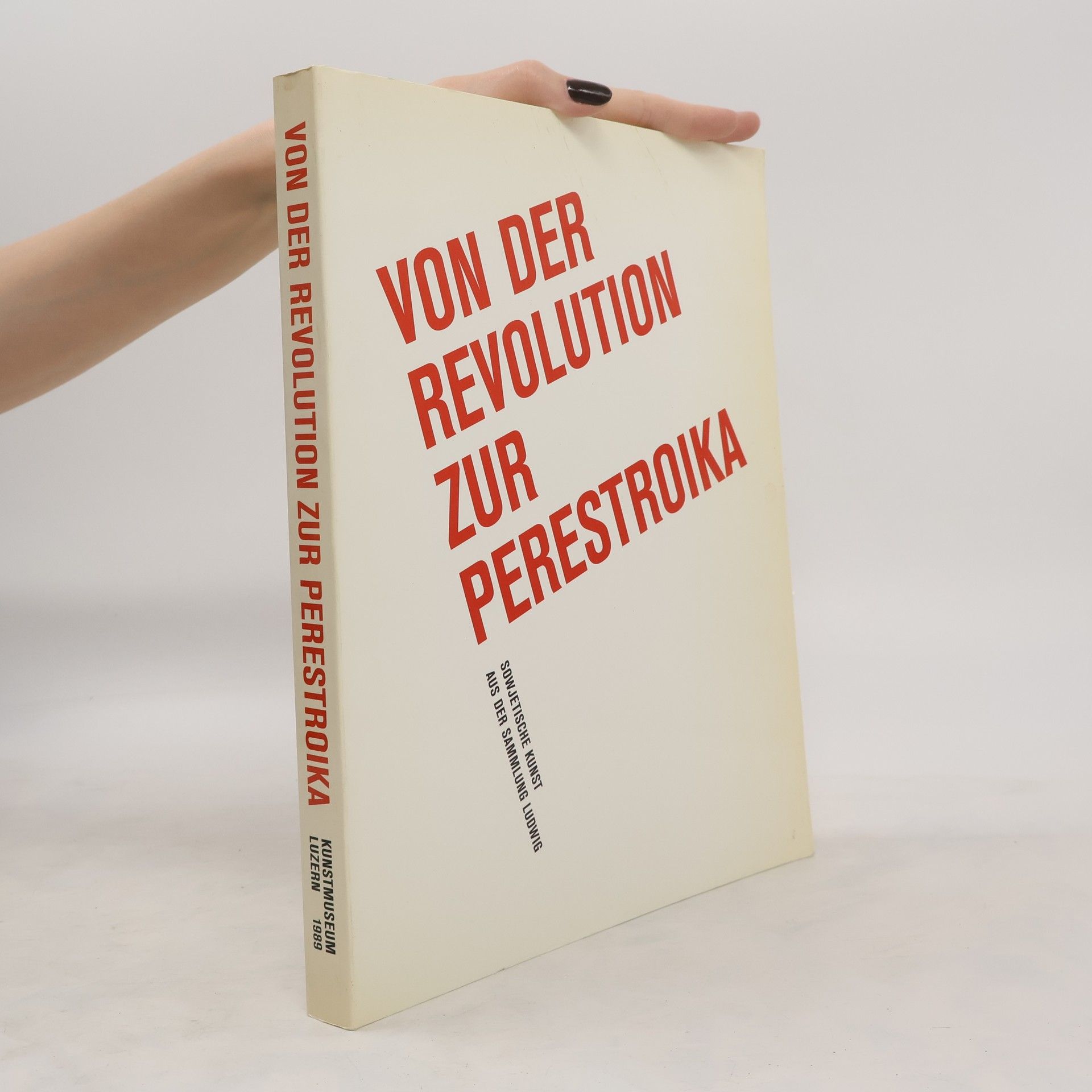Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert verfolgten die russischen Denker und Denkerinnen des Kosmismus das Ziel, die Menschen durch Technologie unsterblich zu machen. Auf diese Weise sollte das christliche Versprechen der Wiederauferstehung im Hier und Jetzt eingelöst werden. Eine zentrale Rolle spielten bei diesem Unterfangen die Künste, die aufgrund ihrer Fähigkeit Dinge zu verewigen, als den Naturwissenschaften und der Medizin ebenbürtig angesehen wurden. Ausgehend vom historischen Kosmismus nimmt der Band angesichts neuer philosophischer Strömungen wie Spekulativer Realismus, Neuer Materialismus sowie Transhumanismus den Materialismus als zentralen Denkmodus des 20. Jahrhunderts in den Blick. Auf den Spuren aufeinanderfolgender Generationen von Künstler*innen, die seit der historischen Avantgarde vom Kosmismus geprägt wurden, wird dessen utopisches Potenzial erkundet.
Boris Groys Bücher
Boris Groys ist ein renommierter Kunstkritiker, Medientheoretiker und Philosoph, dessen Werk die vielschichtige Beziehung zwischen Kunst, Philosophie und Technologie untersucht. Während seiner umfassenden akademischen Laufbahn, die Professuren an renommierten Institutionen weltweit umfasste, befasst sich Groys eingehend mit Themen der Moderne, der künstlerischen Avantgarde und dem allgegenwärtigen Einfluss der Medien auf das zeitgenössische Denken. Seine theoretischen Ansätze bieten tiefe Einblicke in die Komplexität des künstlerischen Diskurses und dessen Entwicklung im digitalen Zeitalter. Sein literarischer Beitrag liegt in der unermüdlichen Erforschung der Grenzen von Kunst und Philosophie.


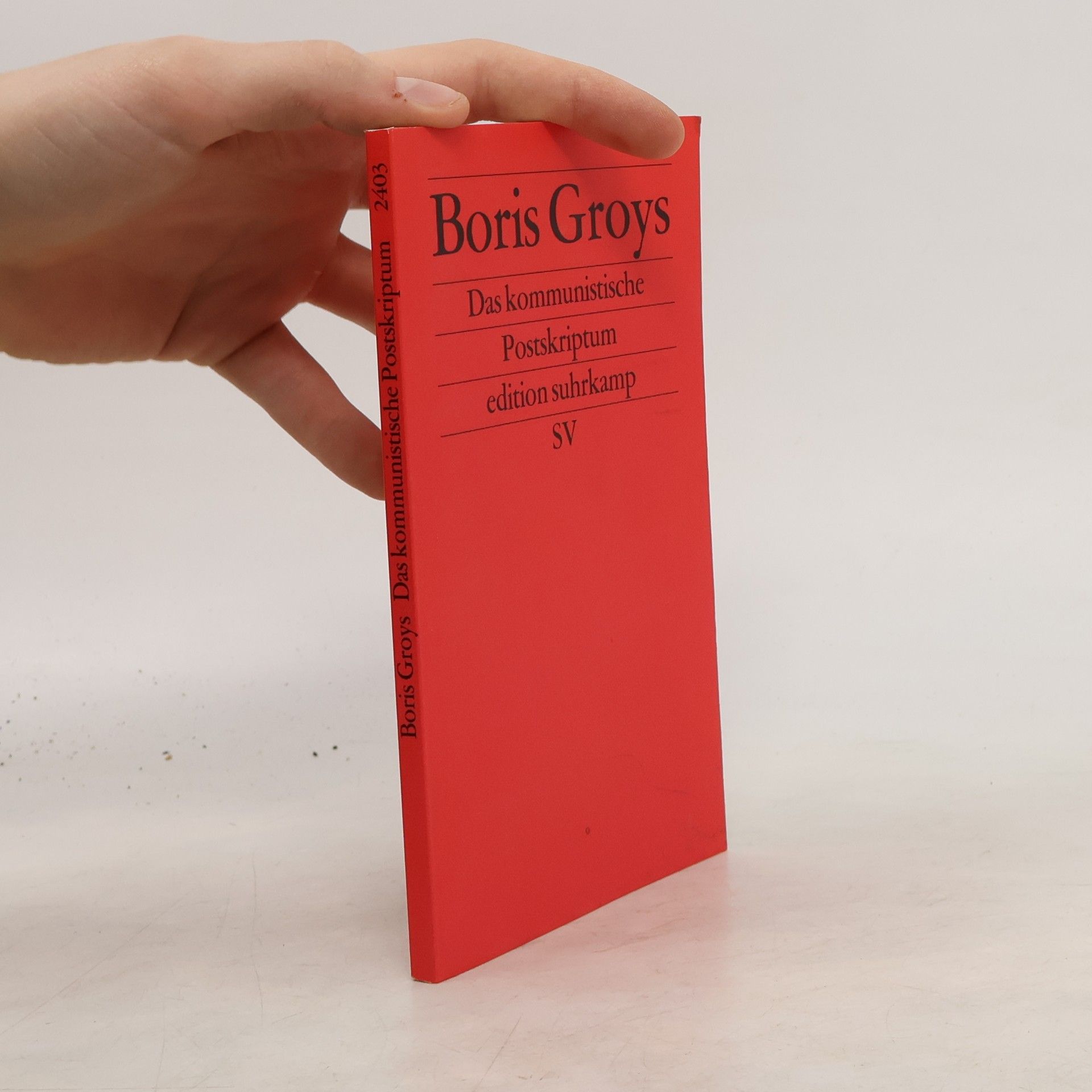


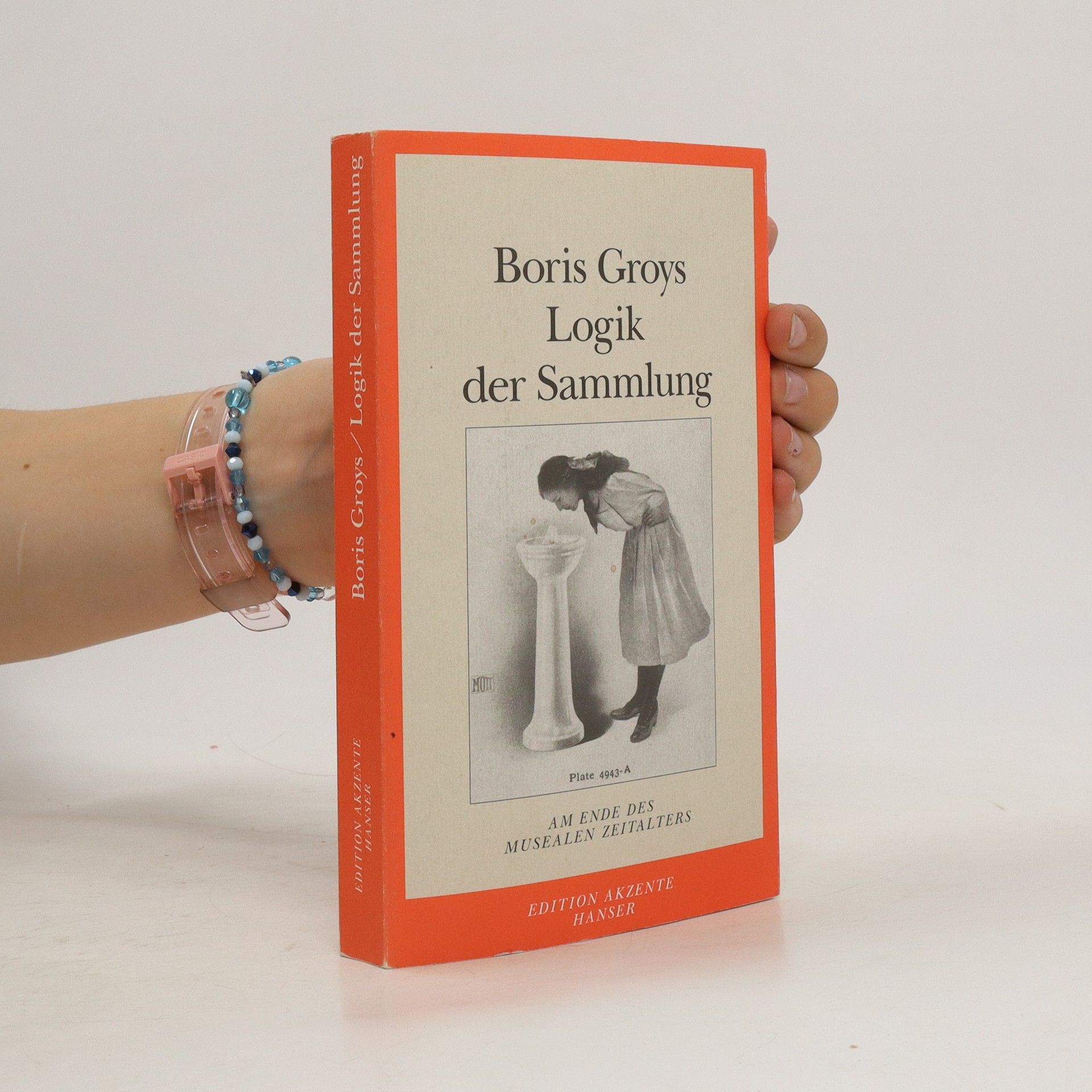
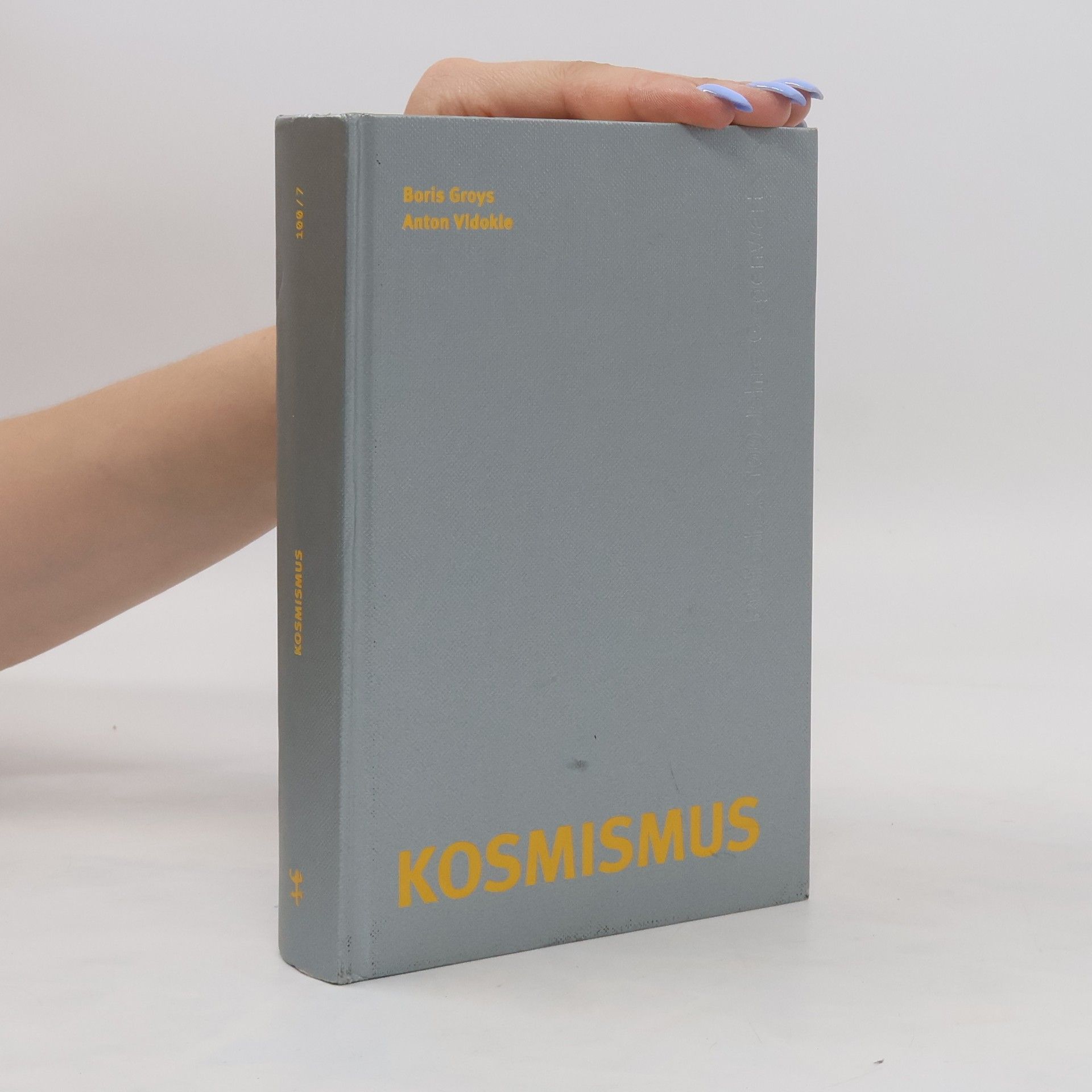
Logik Der Sammlung
- 226 Seiten
- 8 Lesestunden
Die Kunst dieses Jahrhunderts war eine Kunst des Museums. Doch in unserem Zeitalter der Medien und der totalen Verfügbarkeit von Bildern verliert das Museum als Raum jenseits der Wirklichkeit seine Ausstrahlungskraft. Boris Groys zeigt an Beispielen, wie die Kunst durch die Herrschaft der Medien explodiert und wie wir mit all unserer angesammelten Kunst im nächsten Jahrtausend umgehen müssen.
Die technische Reproduzierbarkeit hat eine Verfügbarkeit und Perfektion erreicht, die zu einer neuen Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Raum des Museums und seiner profanen Umgebung zwingt. Daher schlägt Boris Groys eine Topologie der Kunst vor: eine Theorie, nach der das räumliche Verhältnis zwischen Kunstwerk und Betrachter zur zentralen Unterscheidung zwischen der ästhetischen und alltäglichen Wahrnehmung von Bildern wird.
Die Vernunft an die Macht
- 109 Seiten
- 4 Lesestunden
Mit dem Kommunismus ist ein politisches Modell gescheitert, das konsequent auf die vernünftige Planung von Wirtschaft und Gesellschaft setzte. Die Jahrzehnte währenden Erfahrungen mit dieser 'Vernunft an der Macht' haben das Vertrauen in die Macht der Vernunft ein weiteres Mal erschüttert. Allerdings ist mittlerweile deutlich geworden, dass der Rückzug staatlichen Einflusses und der Verzicht auf rationale Planung einem destruktiven Spiel der Marktkräfte und postdemokratischen Tendenzen die Bühne überlassen. Mit Boris Groys und Vittorio Hösle trafen in der HfG Karlsruhe zwei Philosophen aufeinander, die in ihrer Gegensätzlichkeit und gleichzeitigen Nähe ideale Protagonisten der vom ICI Berlin organisierten Reihe 'Spannungsübungen' waren. Ausgehend von der politischen Situation der Gegenwart entwickelte sich eine grundsätzliche Debatte über Macht und Ohnmacht der Vernunft in der Moderne. Das in zauberbergartiger Eleganz ausgetragene Streitgespräch verliert auch in der gedruckten Form nichts von seiner Faszination.
Das kommunistische Postskriptum
- 95 Seiten
- 4 Lesestunden
Die heutige Welt ist gekennzeichnet von Projekten nicht bloß der ökonomischen, sondern auch der politischen und ideologischen Globalisierung. All diese Unternehmungen versuchen, sich mit revolutionären oder mit friedlichen Mitteln durchzusetzen - vom vereinten Europa zum politischen Islam. Es handelt sich dabei um post-kommunistische Projekte, denn erstens ist ihre Entstehung und Verbreitung vor allem durch den Untergang des Kommunismus möglich geworden, und zweitens sind ihre Strategien, Ziele und mediale Selbstdarstellung von den Erfahrungen des historischen Kommunismus zutiefst geprägt.
Über das Neue
- 194 Seiten
- 7 Lesestunden
Jeder Künstler, der es zustande brachte, seinem Werk dauerhafte Erinnerung zu verschaffen, tat das durch Neuerungen gegenüber seinen Vorgängern. Kunstgeschichte, Ästhetik und Philosophie haben sich weidlich darum bemüht, an der Reihe dieser Neuerungen Entwicklungen zu bestimmten Zielen abzulesen. Etwa die immer besser gelingende Annäherung an eine äußere oder innere Wirklichkeit, an das Authentische, das Ursprüngliche, das wirklich Subversive, das Utopische. Die Pointe von Boris Groys' „kulturökonomischer“ Betrachtungsweise ist es, all diese inhaltlichen Beschreibungen künstlerischer Innovationen einzuklammern, um statt dessen herauszuarbeiten, daß das Neue zuerst und zuletzt - nichts als das Neue ist: nämlich die Aufwertung von bisher als wertlos Erachtetem zu Wertvollem. Die künstlerische Innovation stellt sich deshalb als beständige Neubestimmung der Grenze zwischen einem Bereich des wertlos „Profanen“ und der als wertvoll erachteten „Kultur“ dar. Eine nüchterne Einsicht, die aber nicht mit moralischem Unterton eine Reform unserer Diskurse über die Kunst einfordert, sondern viele wortreiche Beschwörungen künstlerischer Innovationen auf wohltuende Distanz bringt.
Von der Revolution zur Perestroika
Sowjetische Kunst aus der Sammlung Ludwig
German, French
Zum Kunstwerk werden
- 200 Seiten
- 7 Lesestunden
Die Auseinandersetzung mit der menschlichen Sehnsucht, durch ästhetische Praktiken Unsterblichkeit zu erlangen, steht im Mittelpunkt des Buches. Es beleuchtet die Herausforderungen, Täuschungen und Abgründe, die mit diesem Streben verbunden sind. Historische und strukturelle Analysen führen zu einer fundierten Beantwortung der Frage, wie Sterbliche in zeitlose Kunstwerke verwandelt werden können. Leser erwartet eine tiefgründige Reflexion, die zum Staunen anregt und neue Perspektiven auf das Verhältnis von Kunst und Tod eröffnet.
Zur menschlichen Existenz gehört elementar die Sorge. Sie besitzt vielerlei Formen: Fürsorge, Selbstsorge, Pflege oder medizinische Vorsorge. Spätestens mit der Pandemie wurde klar, dass der Körper nicht mehr Privatbesitz des Subjekts ist. Stattdessen wurde das leibliche Wohl beinahe vollständig sozialisiert, bürokratisiert und politisiert. Das Ich scheint die Selbstbestimmung an ein Gesundheits-System abgetreten zu haben. Der Philosoph Boris Groys lotet in seinem neuen Buch aus, ob und wie diese Autonomie wieder zurückgewonnen werden kann.