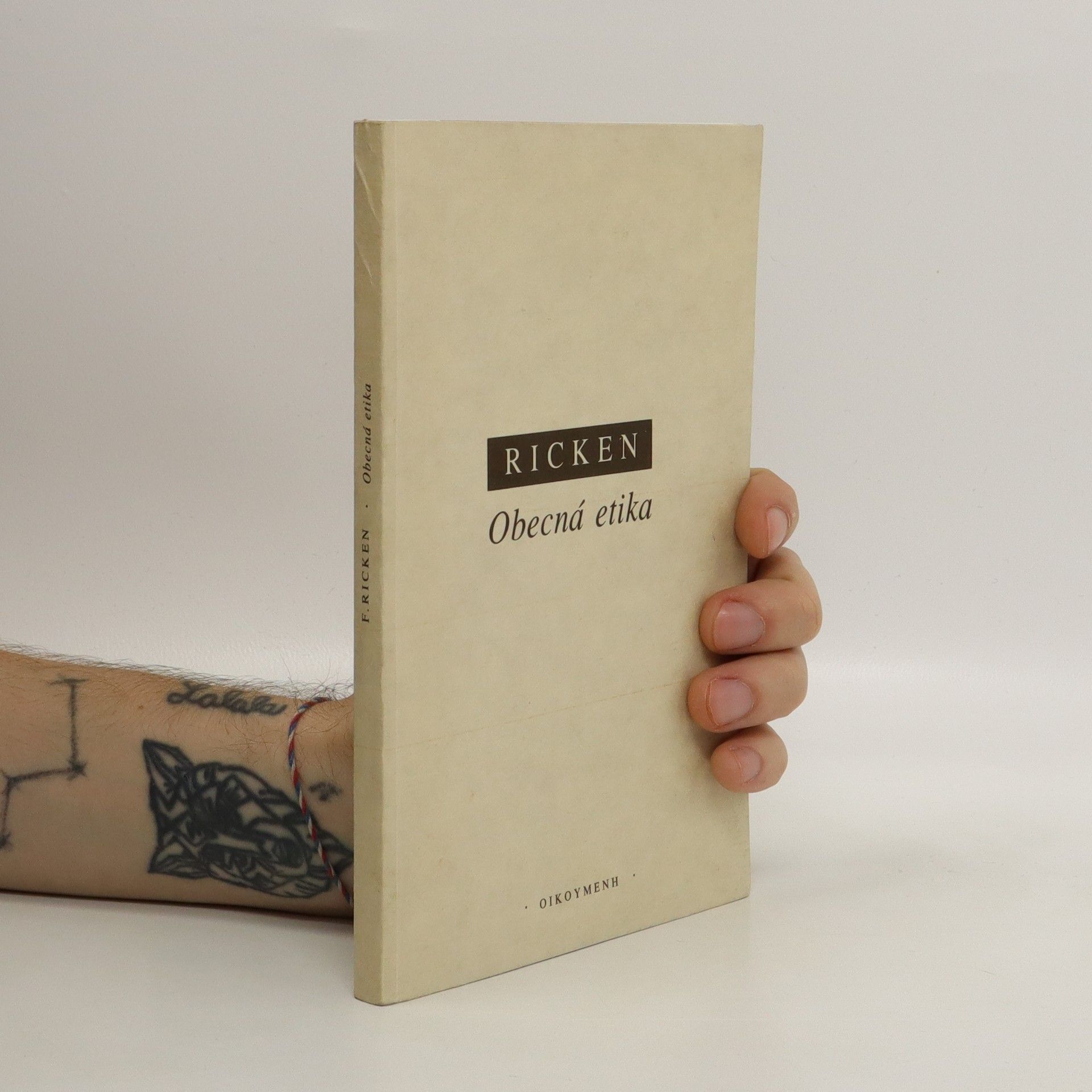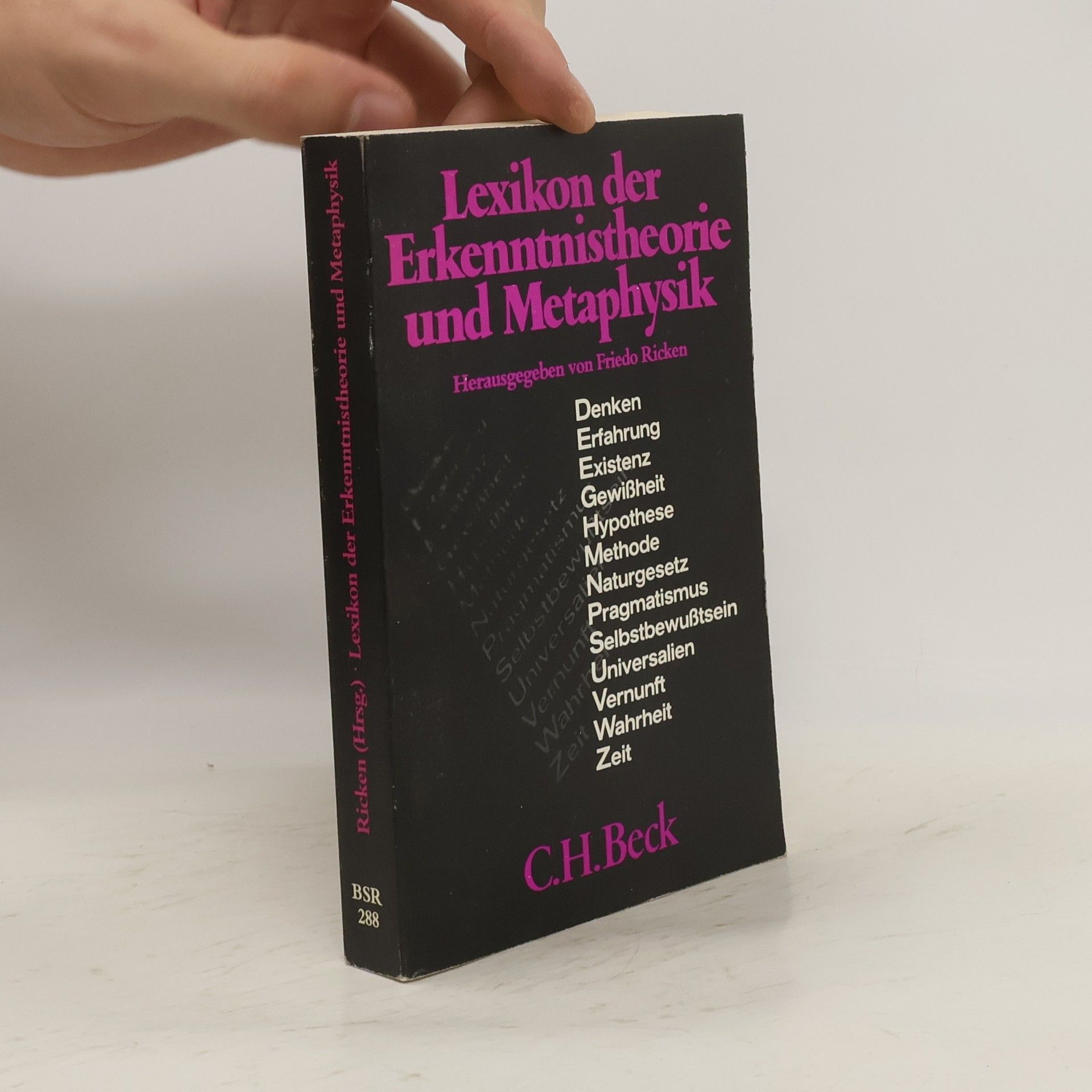Friedo Ricken Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

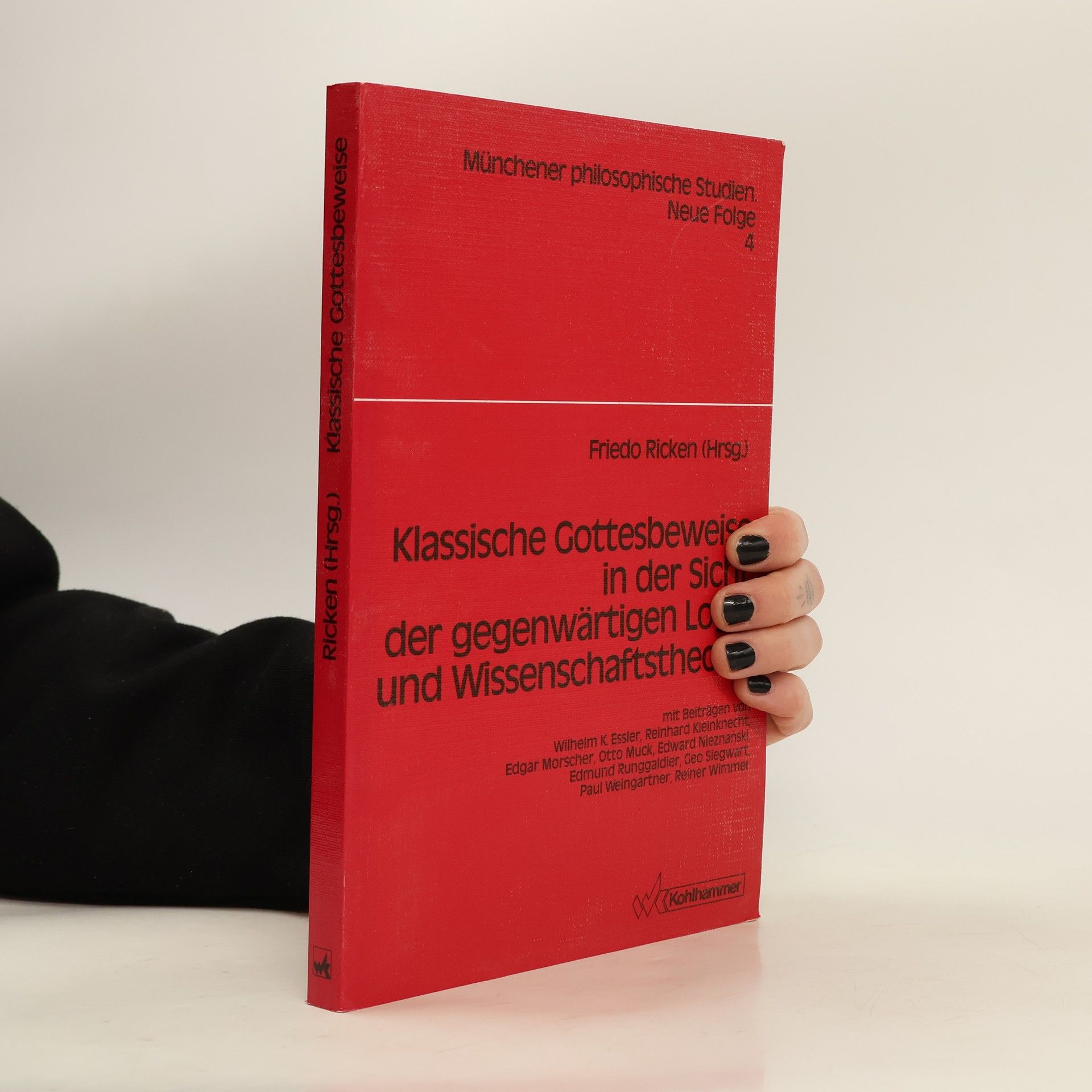


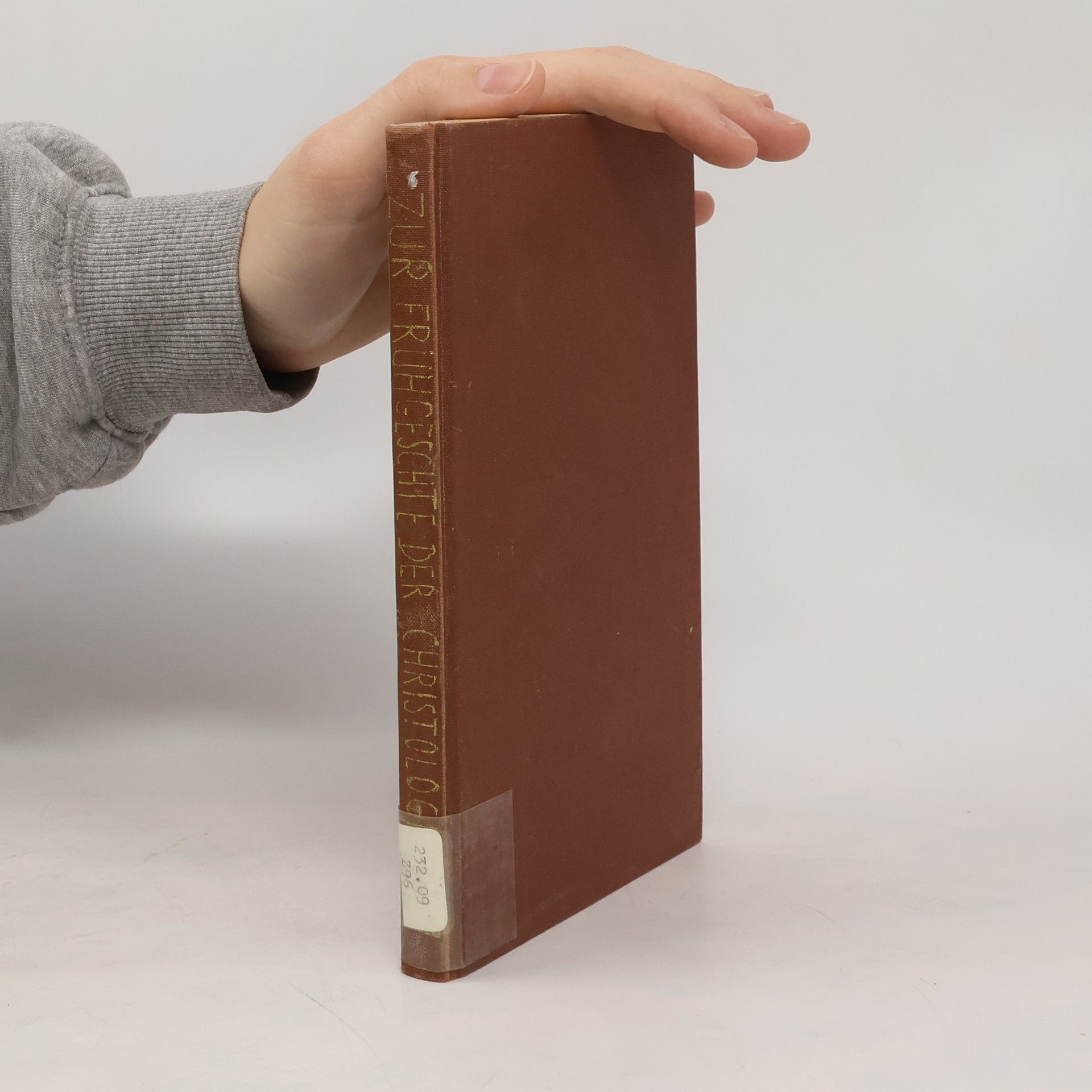

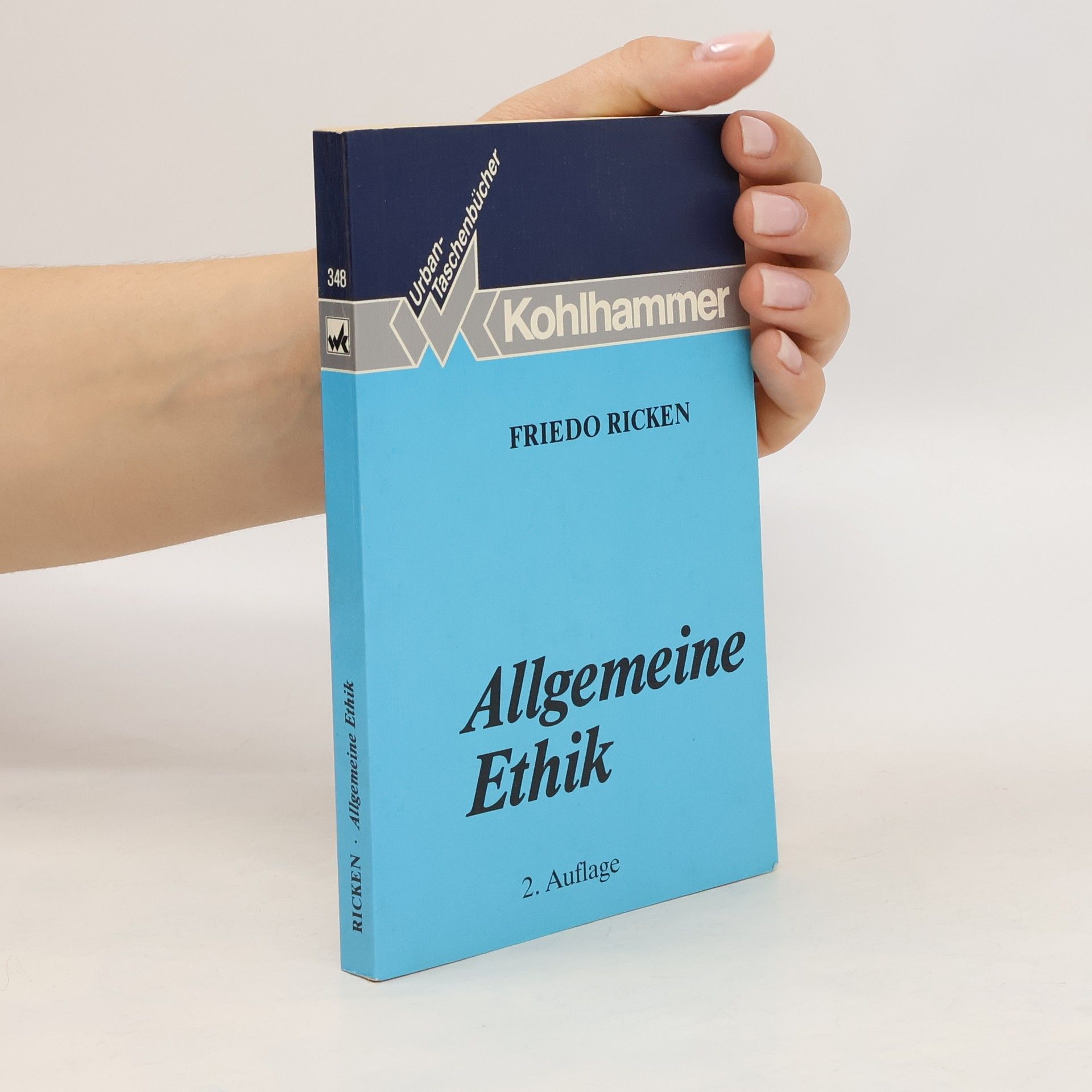
In den verschiedenen Disziplinen, die sich mit der Religion befassen, findet gegenwärtig der Begriff der Erfahrung ein breites Interesse. Grund dafür ist einmal die Vielzahl der Religionen: Läßt sich durch das Studium der religiösen Erfahrung, vor allem der Mystik der verschiedenen Weltreligionen, zeigen, daß allen Religionen die eine Erfahrung einer letzten Wirklichkeit zugrunde liegt? Der zweite Grund ergibt sich aus der Situation der Religionsphilosophie nach Hume und Kant: Gegenüber den klassischen Gottesbeweisen gewinnt nun, vor allem durch Friedrich Schleiermacher und William James, der Begriff der Erfahrung für die Deutung und Rechtfertigung der religiösen Überzeugung an Bedeutung. Die Beiträge des Bandes diskutieren das Problem aus der Sicht der Religionswissenschaft, der Philosophie, der Theologie, der Religionspsychologie und der Religionssoziologie. Sie zeigen die Bedeutung des Erfahrungsbegriffs für den interreligiösen Dialog. Der Herausgeber: Professor Dr. Dr. Friedo Ricken lehrt Ethik und Geschichte der Philosophie an der Hochschule für Philosophie München. Zielgruppen: PhilosophInnen, ReligionswissenschaftlerInnen, TheologInnen.
Hledání odpovědi na hlavní etické problémy na základě srovnání různých metodických přístupů.
Active philosophising, that is not limited by current states, but wants to keep the entire reality in its view has to rely on conversation with history. The antique era plays a major role in this, as the Greeks were the first to pose questions that occupy philosophers up to today. They pointed out approaches to resolution, the basic terms are their doing, thus the philosophy of the classical era is appropriate for an introduction to philosophical thinking. The work reaches from Pre-Socratic philosophy (600 B. C.) to the end of Neo-Platonism (600 aD). It emphasises on questions, terms and theses, which remain essential to modern philosophising.