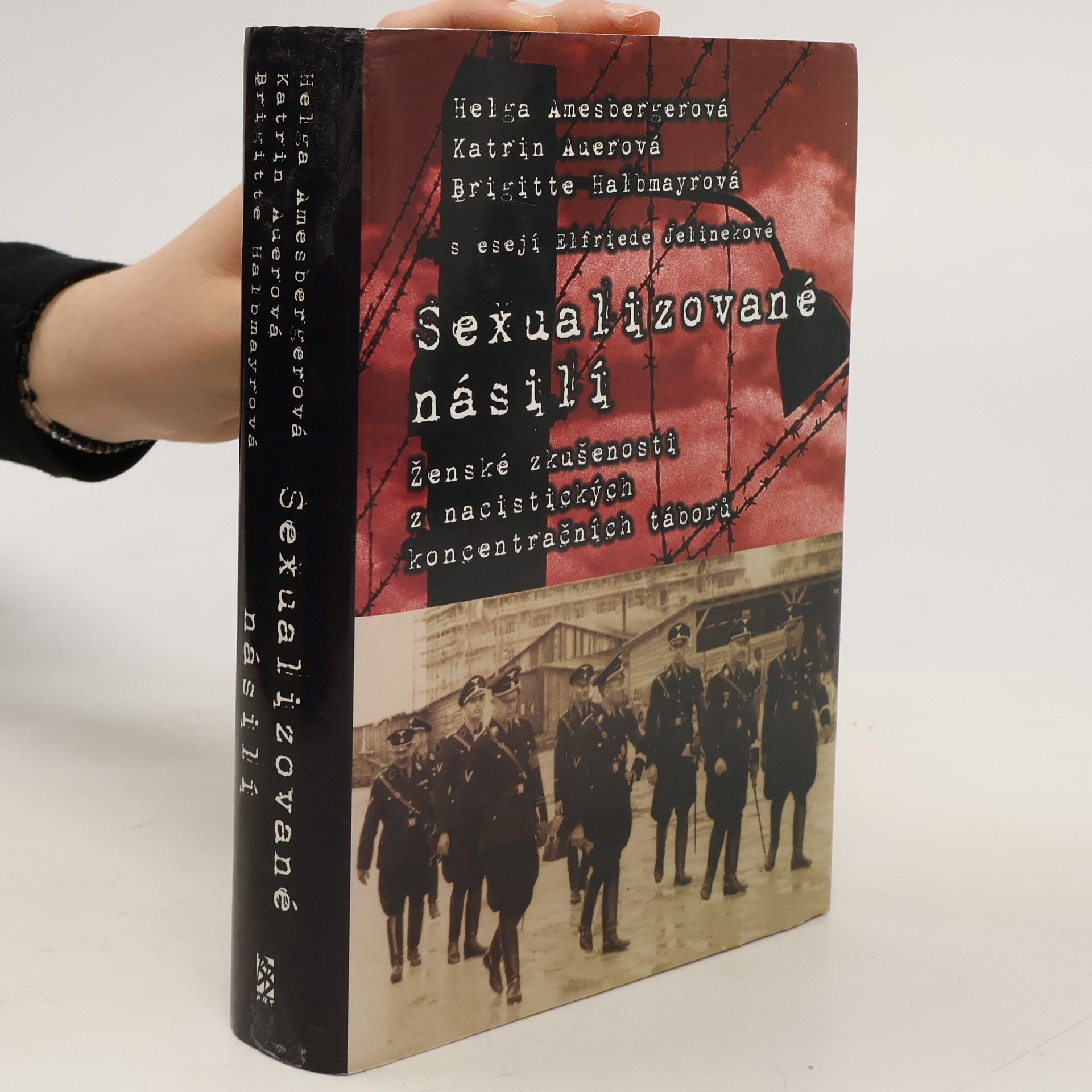This book offers a blend of moral imagination and social-political analysis to overcome the defects COVID-19 has exposed in our political-economic order. It shows how hegemony and complexity prevent societies from envisioning better practices and institutions and presents feasible solutions.
Helga Amesberger Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)



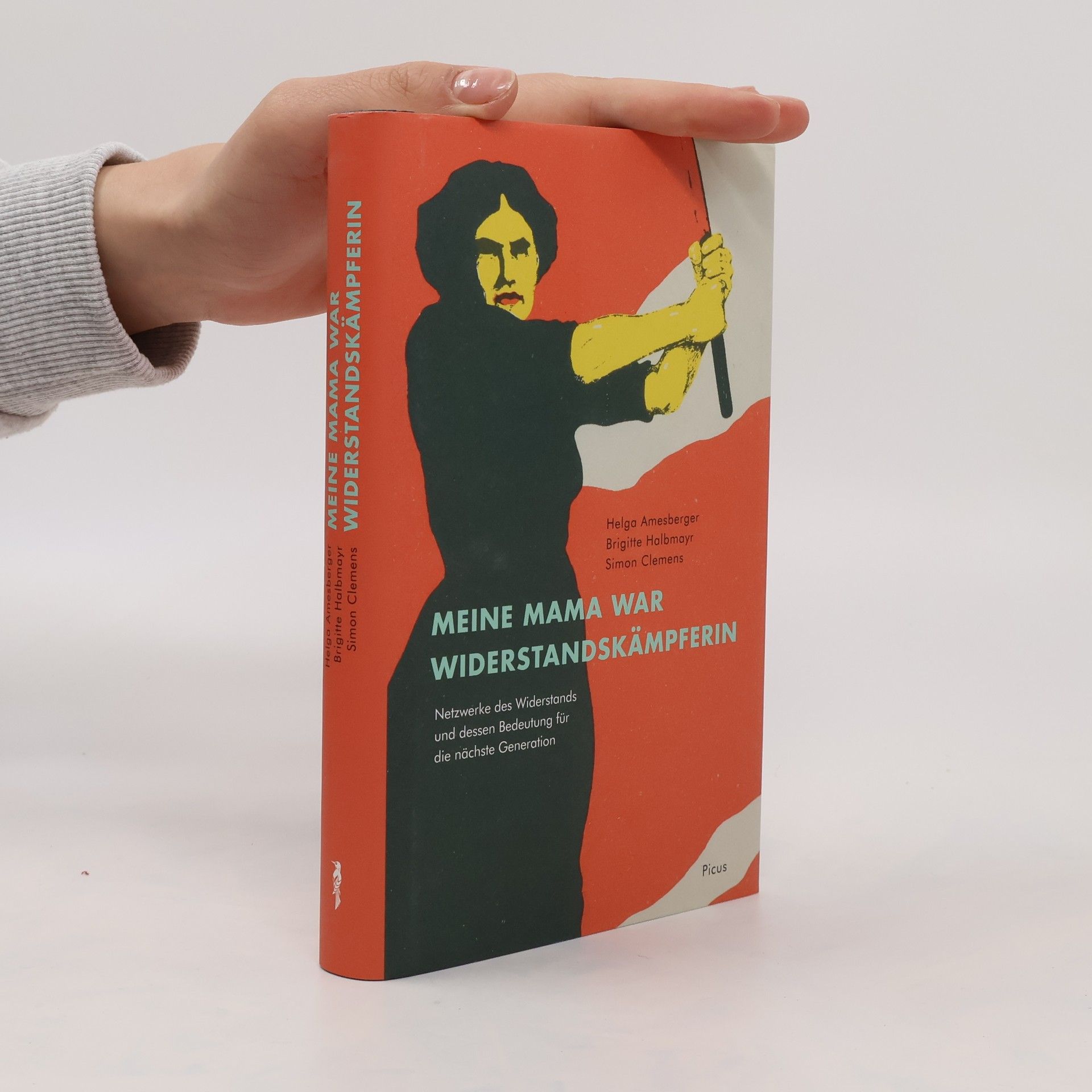

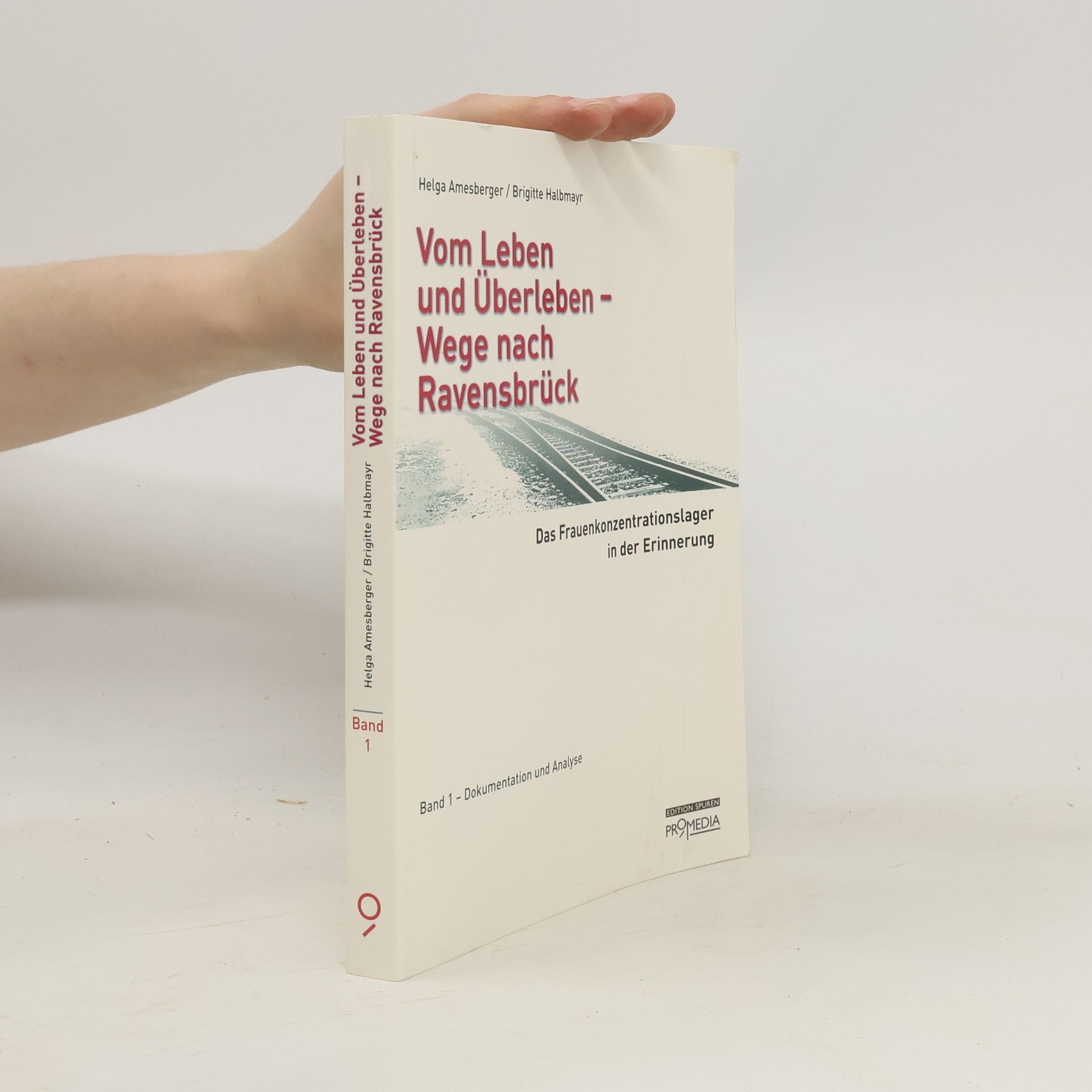

Stigma asozial
Geschlechtsspezifische Zuschreibungen, behördliche Routinen und Orte der Verfolgung im Nationalsozialismus
Meine Mama war Widerstandskämpferin
Netzwerke des Widerstands und dessen Bedeutung für die nächste Generation
Junge Frauen im Widerstand werden nach der Niederschlagung des Nationalsozialismus zu Müttern, die eine neue Generation prägen: Welchen Beitrag zur Demokratisierung haben sie geleistet? Der organisierte Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird zumeist männlich gedacht – doch auch Frauen betätigten sich: Sie waren nicht unpolitisch und passiv, ihr Widerstand war nicht auf den humanitären Bereich beschränkt. Wer waren diese Frauen? Wie waren sie organisiert? Eindrucksvoll legen die Autorinnen und der Autor anhand von Einzelschicksalen dar, in welche Netzwerke diese Frauen eingebunden waren und wie ihr Widerstand aussah. In konsequenter Folge wird auch das Weiterwirken untersucht: In Interviews mit Söhnen und Töchtern der Widerstandskämpferinnen werden nicht nur die Auswirkungen der Widerstandstätigkeit auf Mutter und Familie, sondern auch die innerfamiliäre Tradierung von Narrativen sowie politischem Bewusstsein ergründet.
Das Privileg der Unsichtbarkeit
- 199 Seiten
- 7 Lesestunden
Sexualizované násilí
- 383 Seiten
- 14 Lesestunden
Autorkami práce jsou dvě rakouské socioložky a jedna historička. Předmětem jejich sociologicko-historické studie se staly ženy, konkrétně vězeňkyně v nacistických koncentračních táborech a jejich zkušenosti se sexuálně zaměřeným násilím. Kniha čerpá jednak z autobiografických vzpomínek bývalých vězeňkyň, a jednak z přímých rozhovorů s několika ženami. Jednou z žen přímo autorkami dotazovaných je i Češka Klára. Zpovědi žen jsou anonymní. Kniha je zaměřena na nucenou ženskou prostituci v koncentračních táborech, na proces těhotenství, porodu a "péče" o matky a novorozence v nacistických táborech. Pozornost je též věnována násilí, které bylo na vězeňkyních pácháno jako na ženách. Závěrečná kapitola uvádí zajímavou sociologickou studii, v níž jsou bývalé vězeňkyně z Ravensbrücku sledovány i po válce, a to ve smyslu sňatků a narozených dětí.
Sexualisierte Gewalt gegen Frauen während der nationalsozialistischen Verfolgung war lange auf geringes wissenschaftliches Interesse gestoßen. Der Breitenwirkung dieses Buches ist es zu verdanken, dass nunmehr in Politik und Öffentlichkeit das Bewusstsein für sexualisierte Gewalt gewachsen ist, die von erzwungenem Nacktsein und Verweigerung jeglicher Intimsphäre bis zu Zwangssterilisierung und Sexzwangsarbeit reicht. Durch die Berücksichtigung des Faktors Geschlecht und der Geschlechterverhältnisse zwischen Opfern und TäterInnen in der Analyse sexualisierter Gewalt ermöglichen die Autorinnen neue Einblicke in die Machtstrukturen eines Konzentrationslagers. Beleuchtet werden zudem Aspekte wie Menstruation, Schwangerschaft und Mutterschaft im KZ sowie die Auswirkungen von Verfolgung und traumatisierender Gewalterfahrungen auf das Leben nach 1945, insbesondere im Bereich Partnerschaft und Mutterschaft.Für die Neuausgabe des 2004 erstmals erschienenen Buches hat Elfriede Jelinek einen Essay verfasst, der in voller Länge enthalten ist.