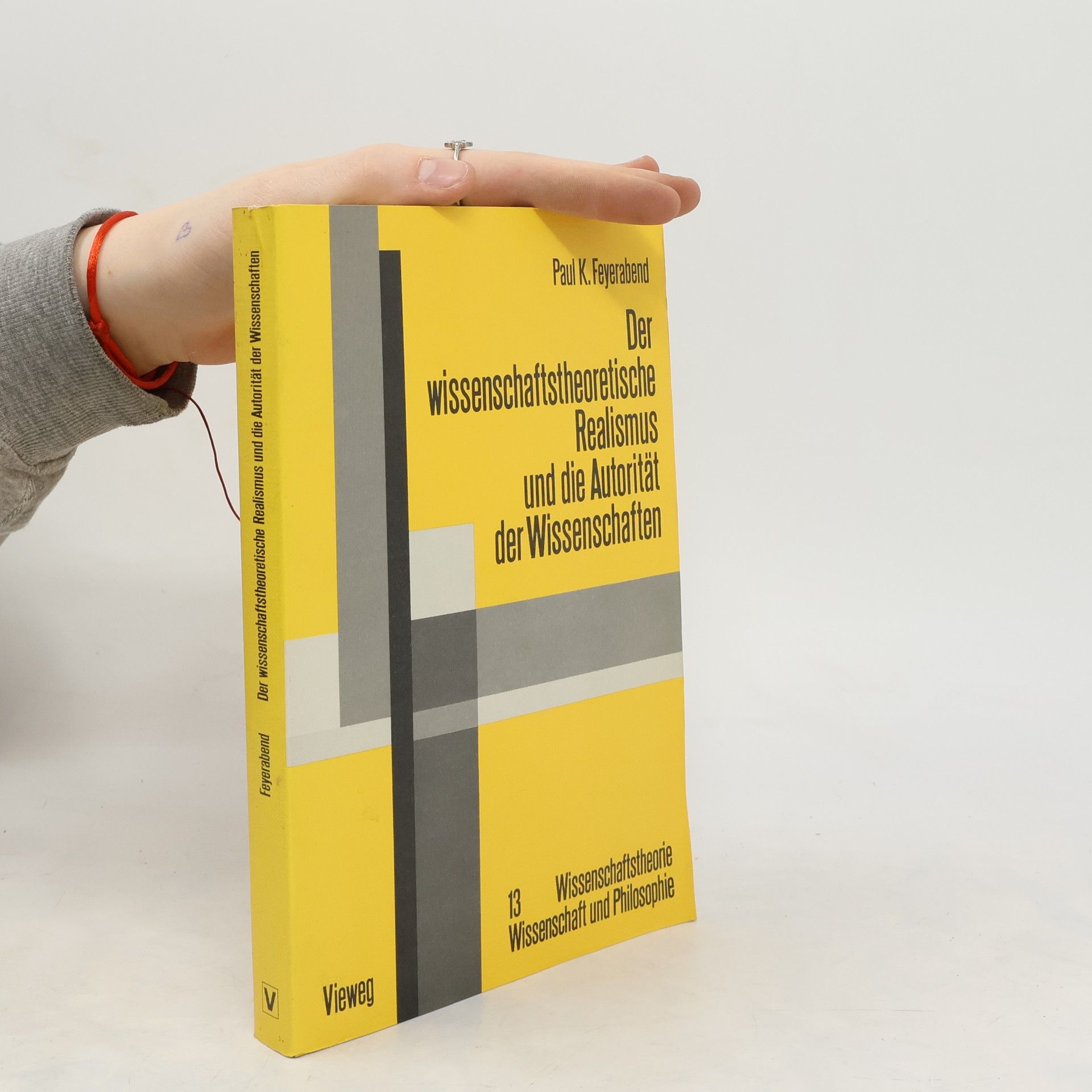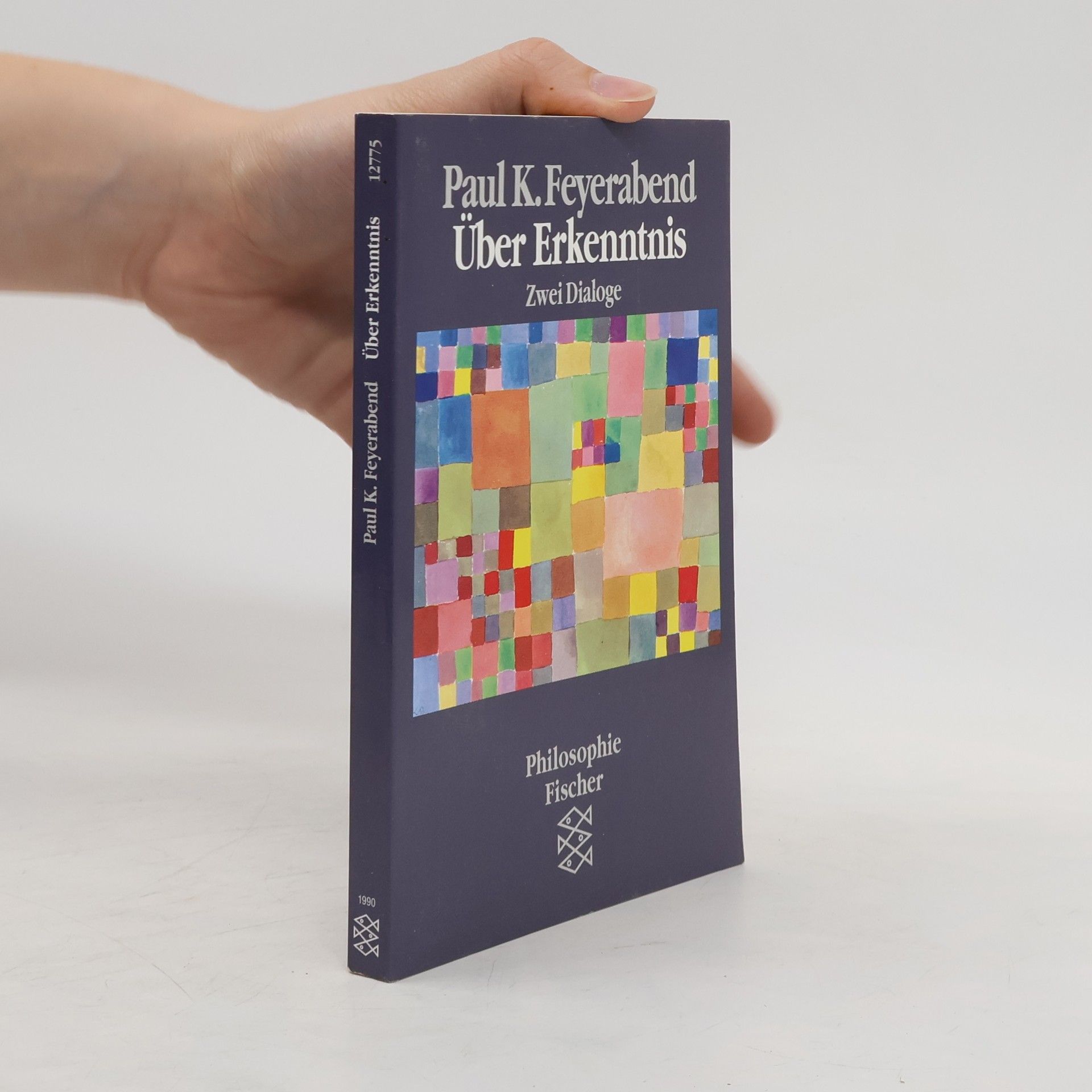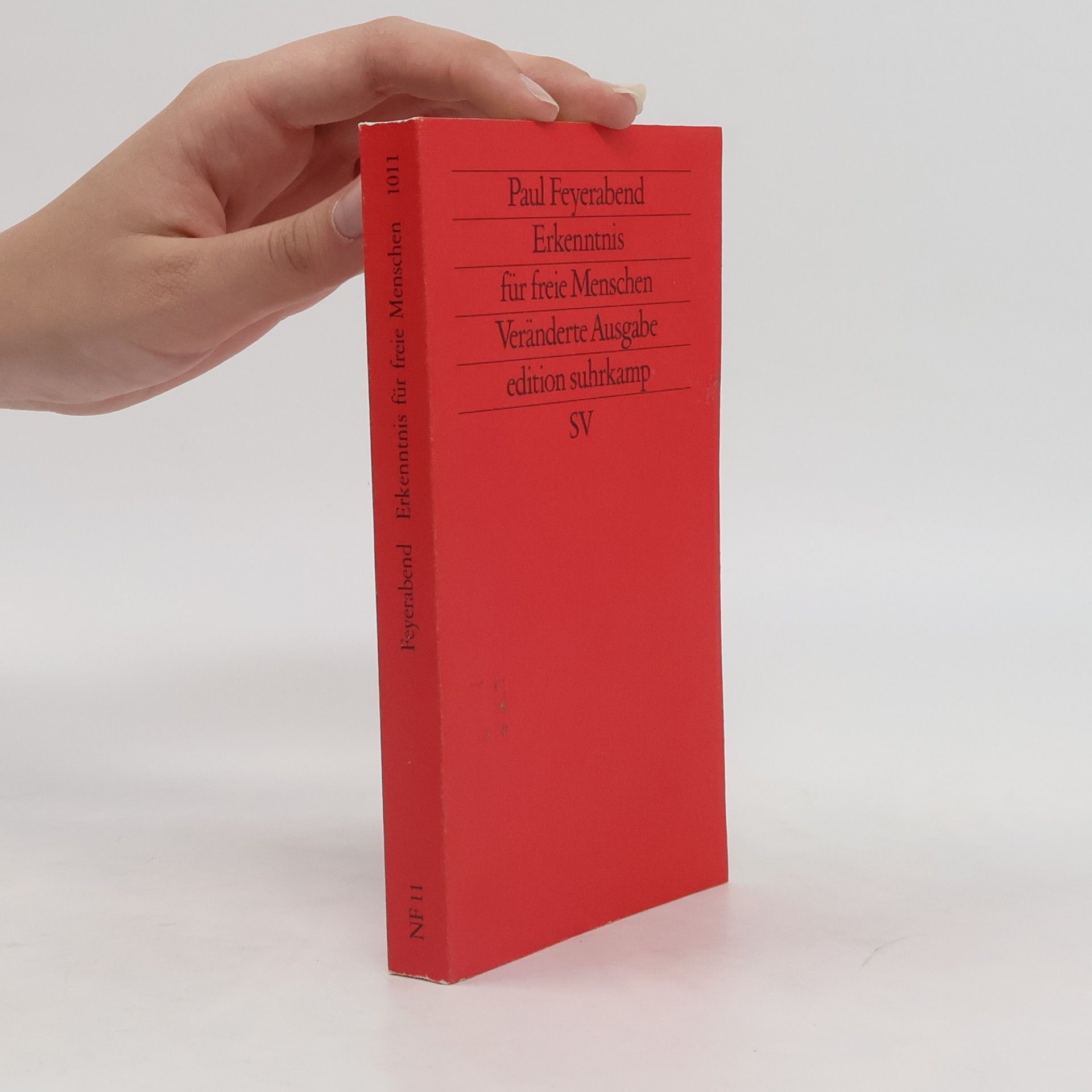Probleme des Empirismus
Schriften zur Theorie der Erklärung, der Quantentheorie und der Wissenschaftsgeschichte Ausgewählte Schriften
Inhaltsverzeichnis: Einleitung zu den Grenzen eines kritischen Realismus. Der Pluralismus als methodologisches Prinzip. Wissenschaftlicher und philosophischer Realismus: Historischer Hintergrund, Arten des Realismus, Maxwell und Mach, das Zweisprachenmodell, Inkommensurabilität. Wissenschaftliche Praxis und philosophische Theorie: Degenerationsprozess der Wissenschaftstheorie, Commonsense und abstrakte Philosophie, historische und abstrakte Traditionen, Aristoteles, philosophische Maßstäbe, Ernst Mach und seine Nachfolger, Popper, Kuhn, Lakatos und das Ende des Rationalismus, politische Folgen. Erklärung, Reduktion und Empirismus: Annahmen des zeitgenössischen Empirismus, Kritik der Erklärung, methodologische Überlegungen, Sinninvarianz. Antwort an Kritiker: Pluralismus, starke Alternativen, Fortschrittsmodell, Konsistenz, historische und methodologische Fragen, Beobachtung. Der klassische Empirismus. Besprechung von Ernest Nagels „The Structure of Science“. Materialismus und das Leib-Seele-Problem. Verteidigung der klassischen Physik: Auffassungen von menschlicher Erkenntnis, Parmenideisches Vorgehen, Fortbestehen klassischer Ideen, klassische Statistik, Wahrscheinlichkeiten, Birkhoffs Satz. David Böhms Naturphilosophie. Quantentheorie der Messung: Probleme, von Neumanns Theorie, Stadien des Messprozesses, Schwierigkeiten. Dialektischer Materialismus und Quantentheorie. Zwei Theorien des Erkenntniswandels: Mill und Hegel. Wit