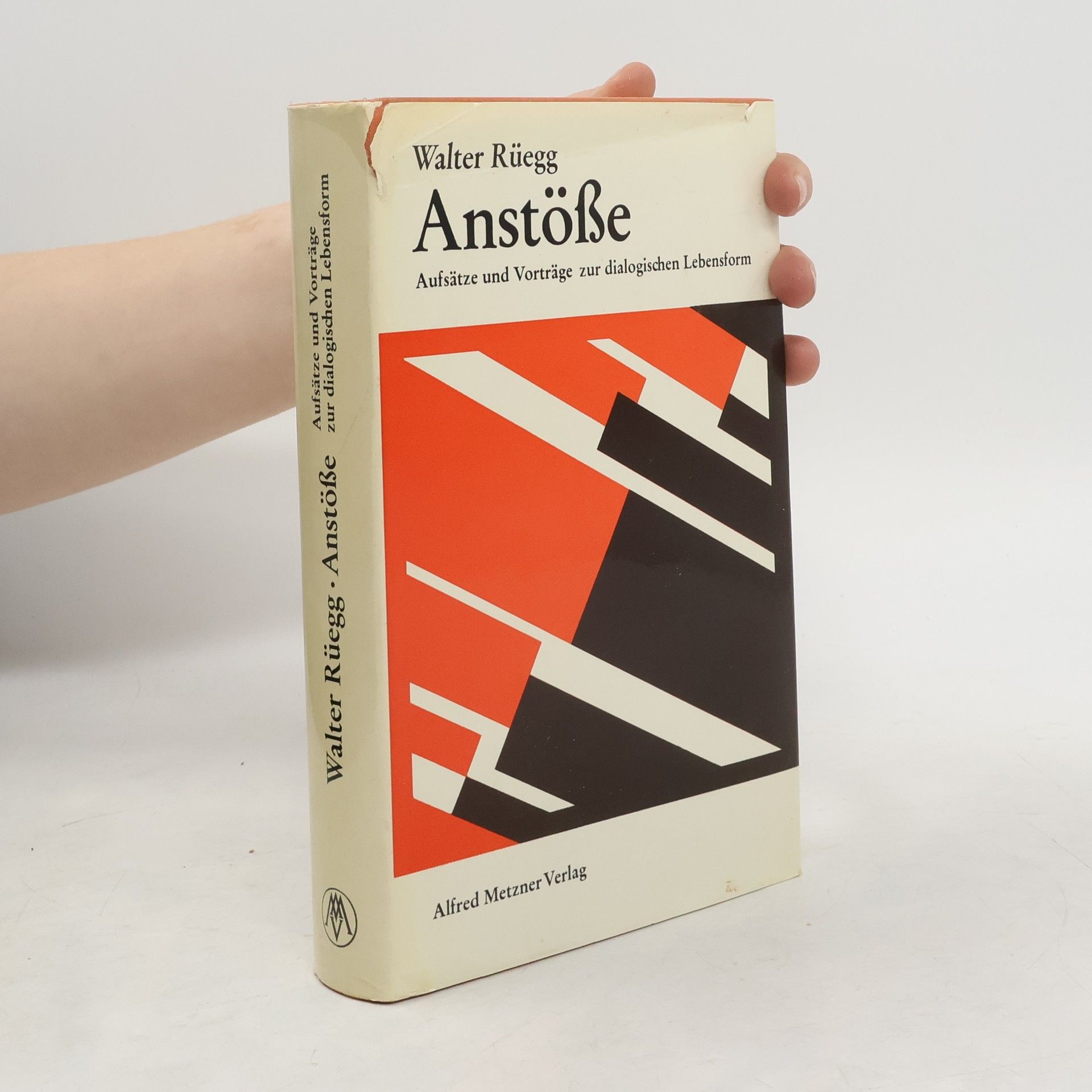Walter Rüegg Bücher
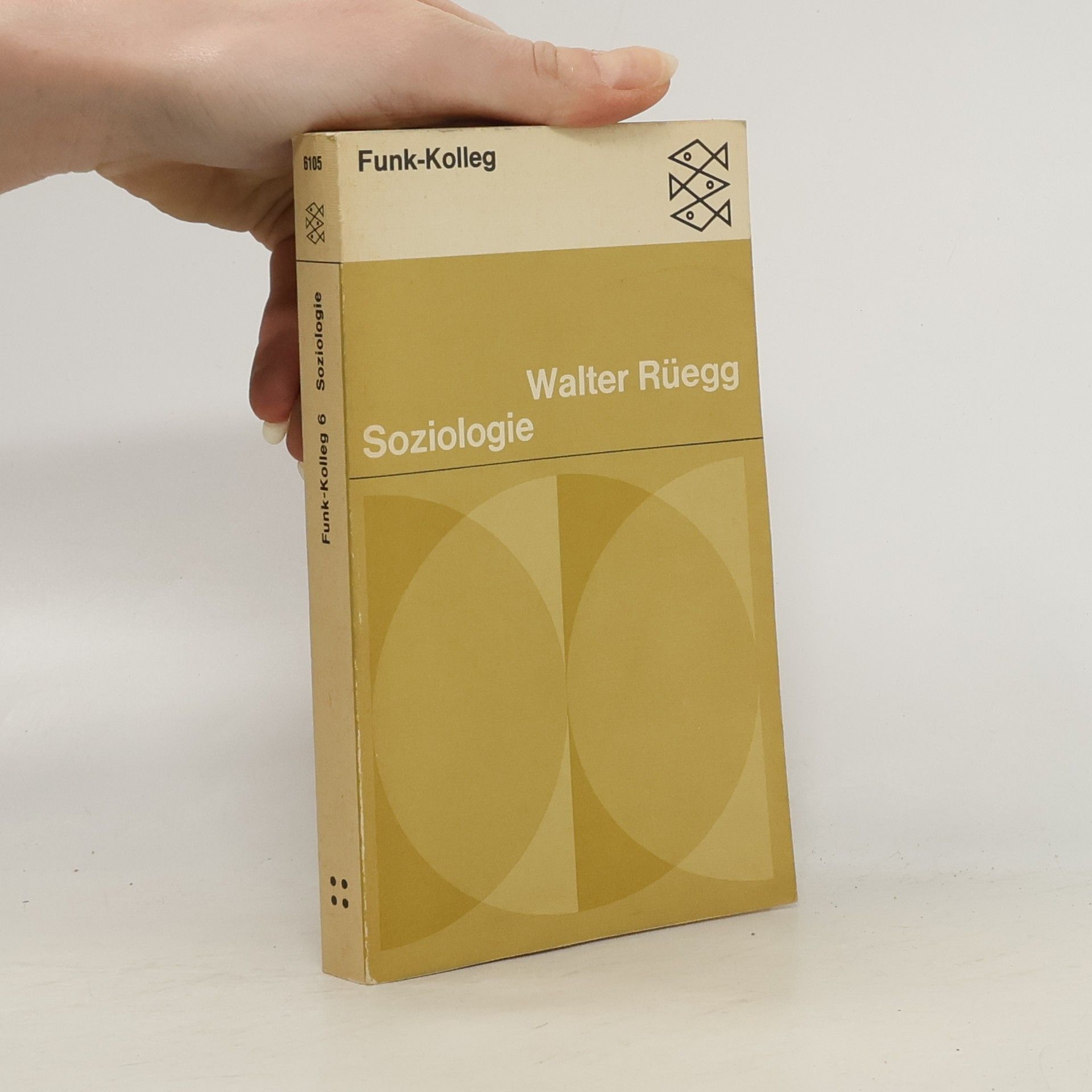
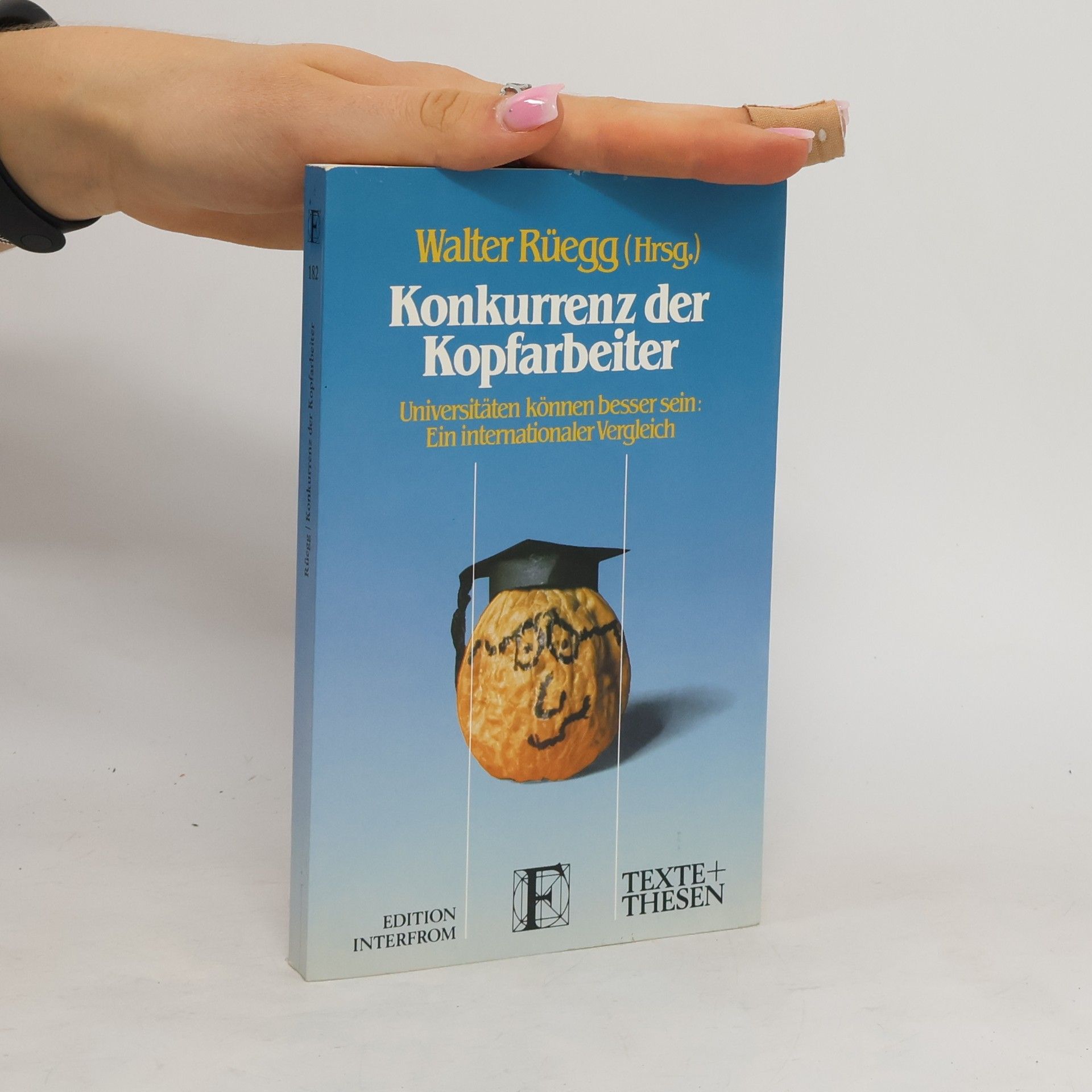

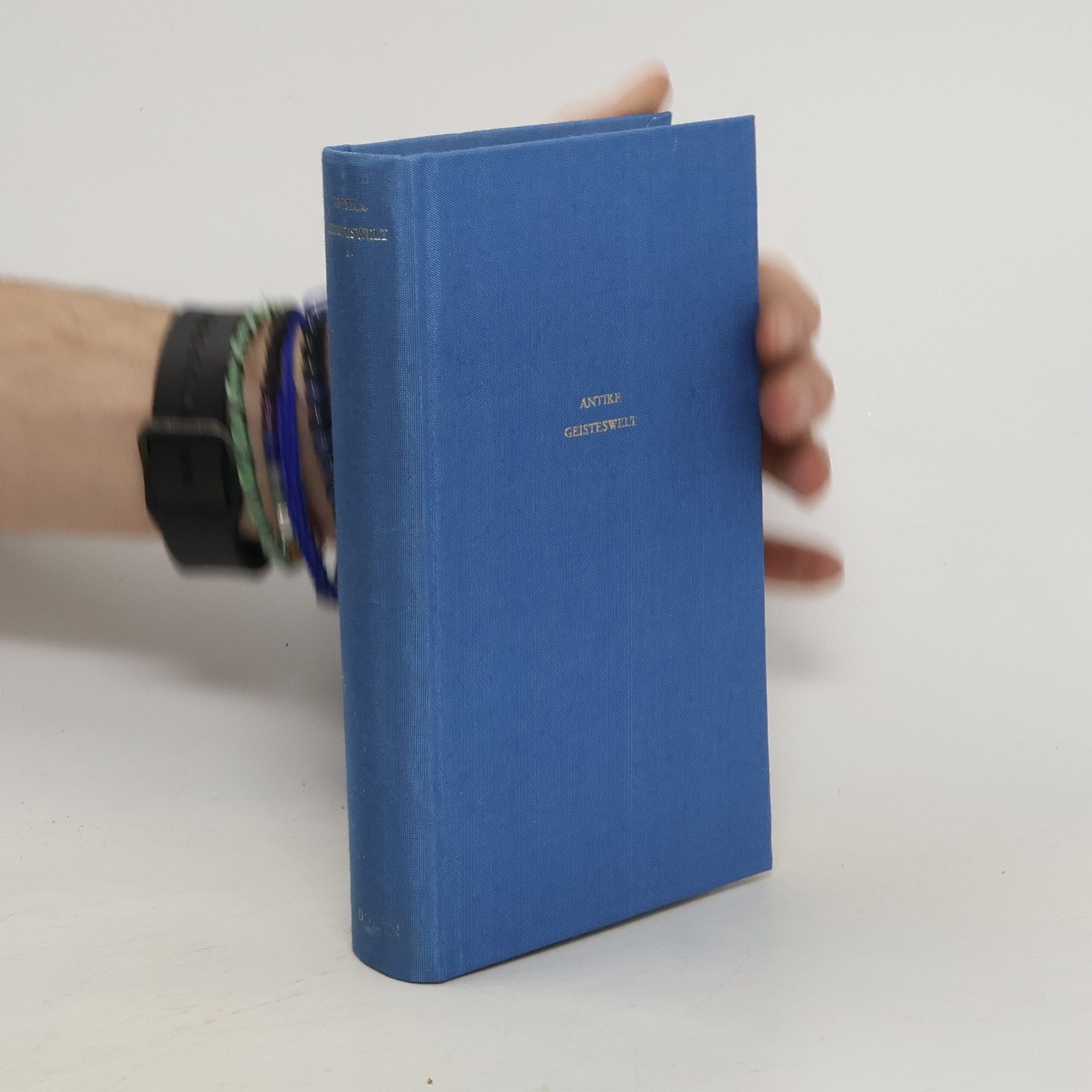
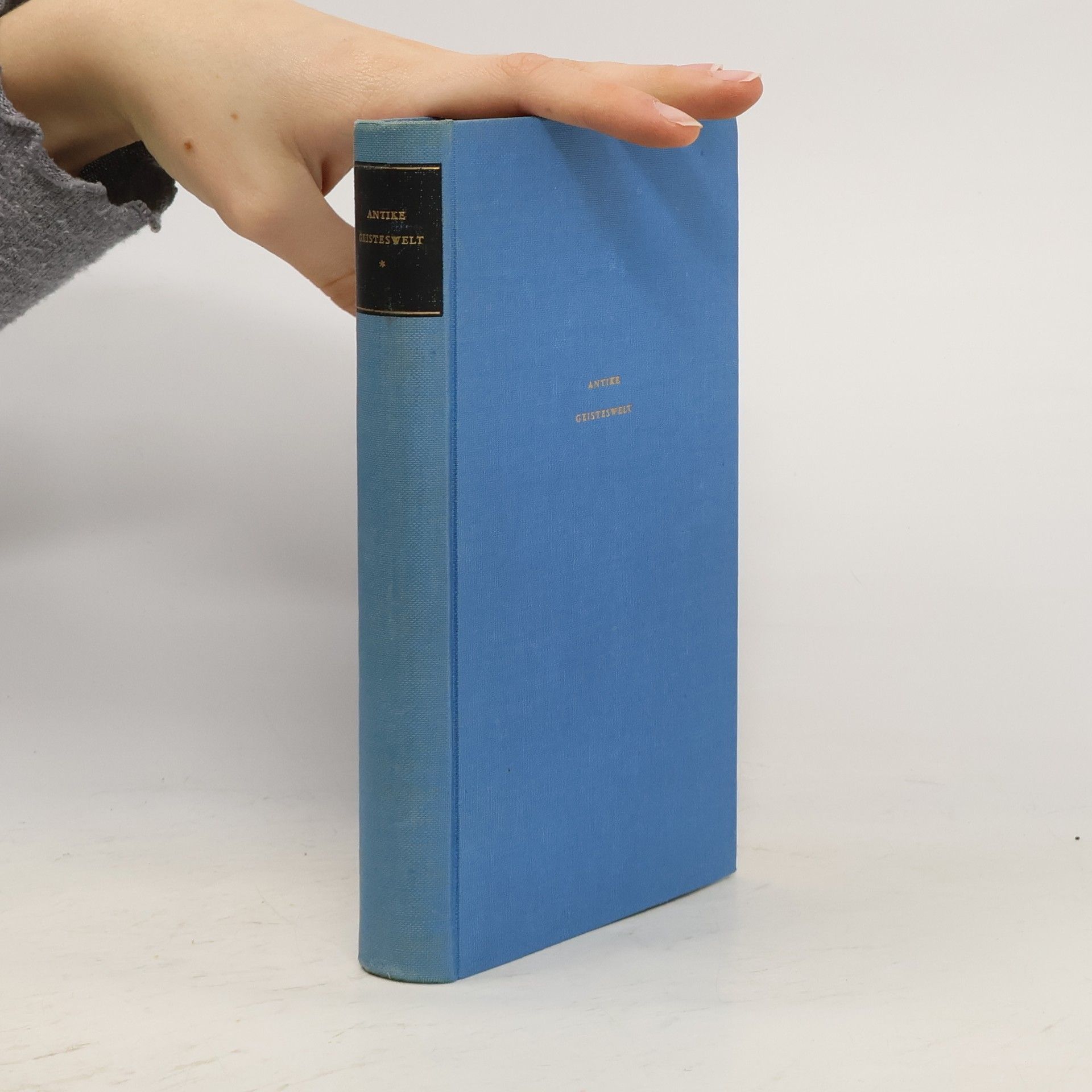
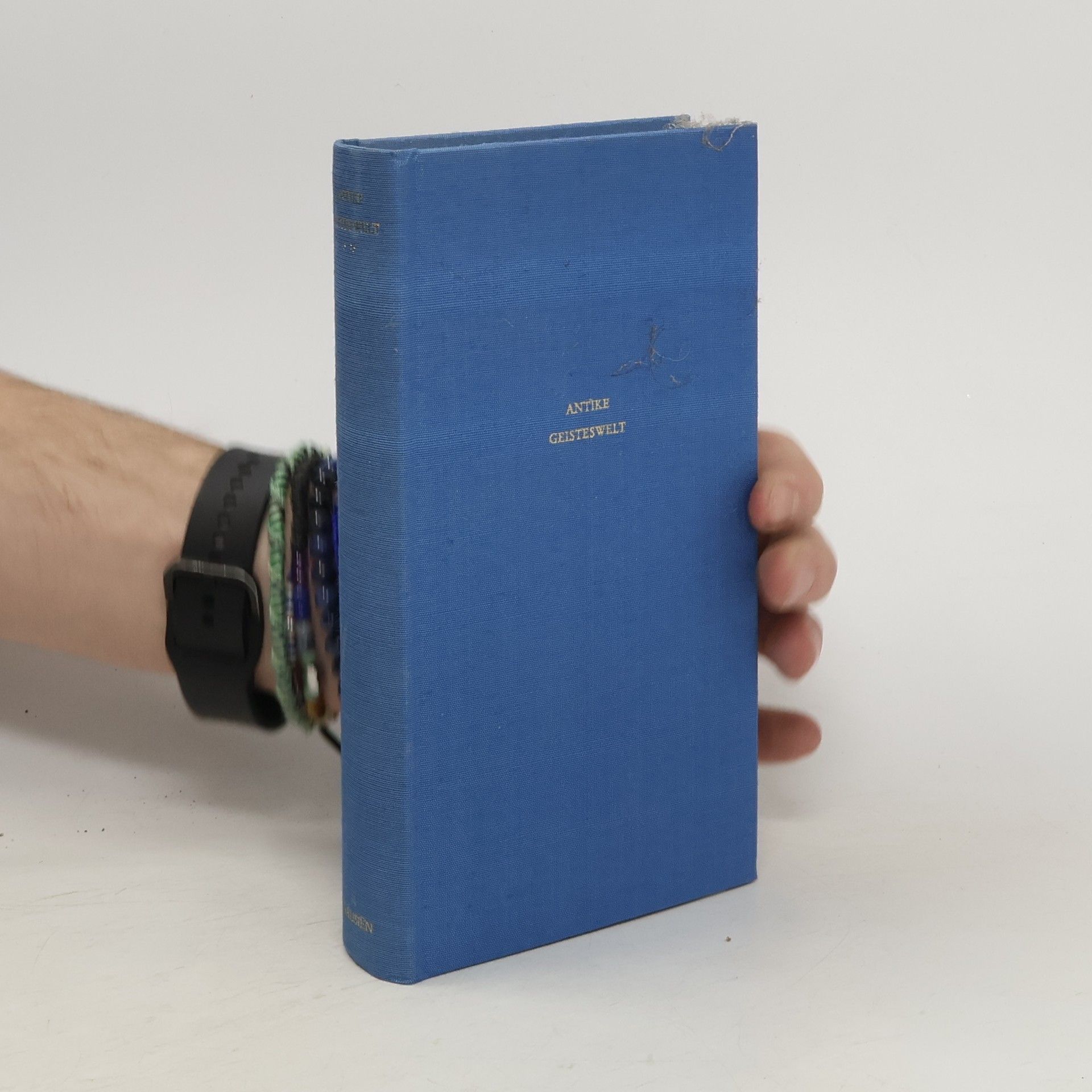
Antike Geisteswelt 1
Natur und Geist
Infektionskrankheiten, einst die größte Bedrohung der Menschheit, konnten in den letzten zwei Jahrhunderten durch Fortschritte in Hygiene, Impfungen und Antibiotika weitgehend besiegt werden. Auch das Risiko großer Hungersnöte ist gesunken, was zu einer signifikanten Erhöhung der Lebensdauer und verbesserter Lebensqualität, insbesondere in den Industrieländern, geführt hat. Diese Entwicklungen verdeutlichen den enormen Fortschritt der Menschheit im Umgang mit gesundheitlichen Herausforderungen.
Konkurrenz der Kopfarbeiter
- 157 Seiten
- 6 Lesestunden
Soziologie
- 315 Seiten
- 12 Lesestunden
Im sechsten Band der Serie "Funk-Kolleg zum Verständnis der modernen Gesellschaft" wird eine Wissenschaft vorgestellt, die unsere gesellschaftliche Wirklichkeit analysiert. Arbeitsweise und Ergebnisse der Soziologie betreffen die gesellschaftliche Existenz eines jeden von uns, sind daher also für uns alle von einer unmittelbaren und allgemeineren Bedeutung als die Ergebnisse mancher anderen Wissenschaft.Der Verfasser stellt in diesem Buch Geschichte, Gegenstände, verschiedene methodologische Ansatzpunkte und Denkmodelle der Soziologie vor. Neben der bloßen Beschreibung setzt sich der Verfasser kritisch mit den verschiedenen Möglichkeiten soziologischer Forschung auseinander, um schließlich den eigenen Standpunkt einer Soziologie als humanistischer Wissenschaft zu umreißen.