Die Geschichte geht weiter
Ungemütliche Essays
Peter Rosei ist ein österreichischer Prosaautor, dessen Werk tief in die Grenzen des Wissens und die Diskrepanzen zwischen Denken und Handeln in der westlichen Gesellschaft eintaucht. Sein umfangreiches Schaffen umfasst Romane, Erzählungen, Essays, Gedichte und Theaterstücke, die oft Themen der gebrochenen Realitäten und Dissonanzen im modernen Leben erforschen. Roseis Stil zeichnet sich durch scharfsinnige Analyse und die Fähigkeit aus, verborgene Spannungen in der menschlichen Psyche und in breiteren sozialen Kontexten aufzudecken. Seine Texte laden die Leser ein, über die Komplexität der Existenz und das Wesen des Seins nachzudenken.
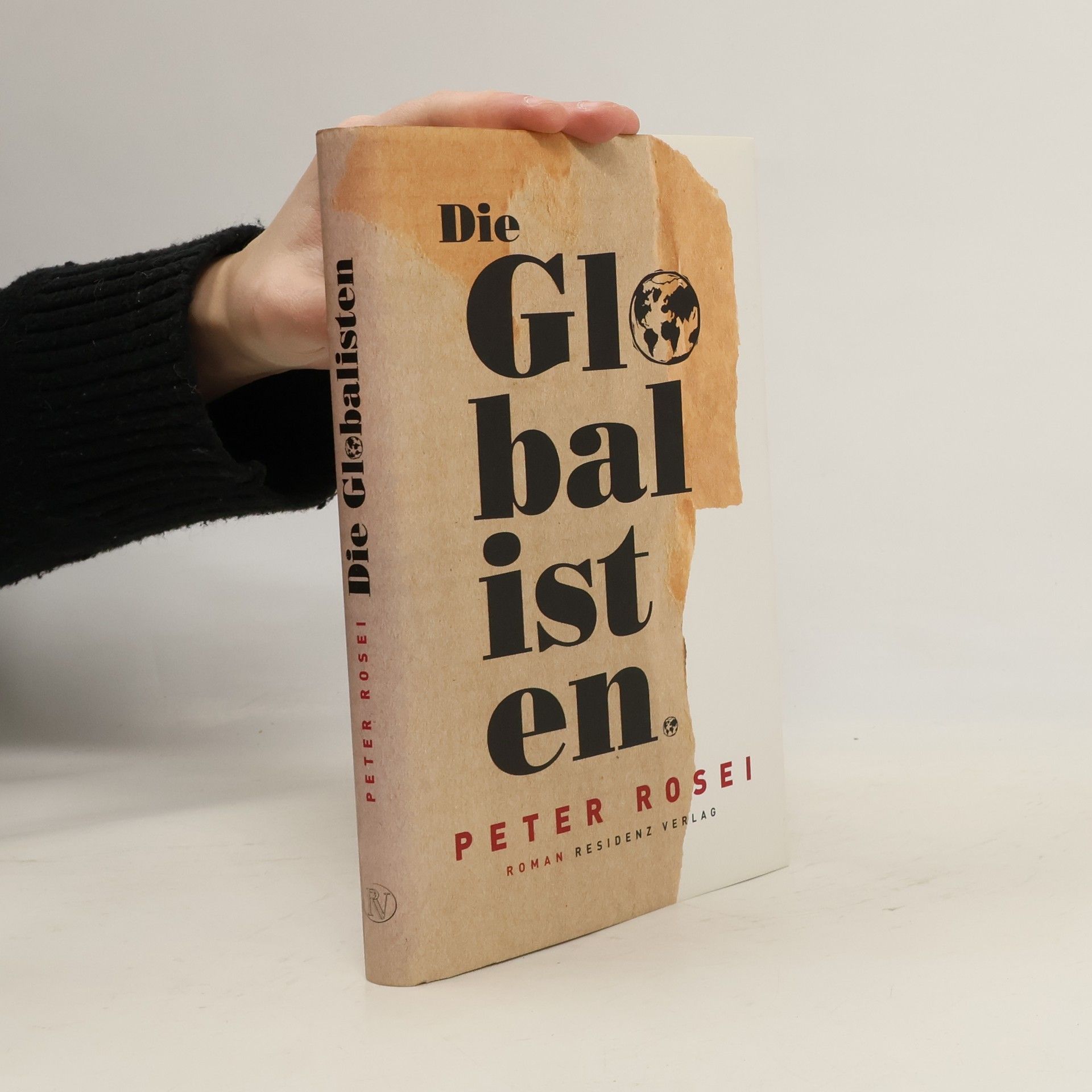
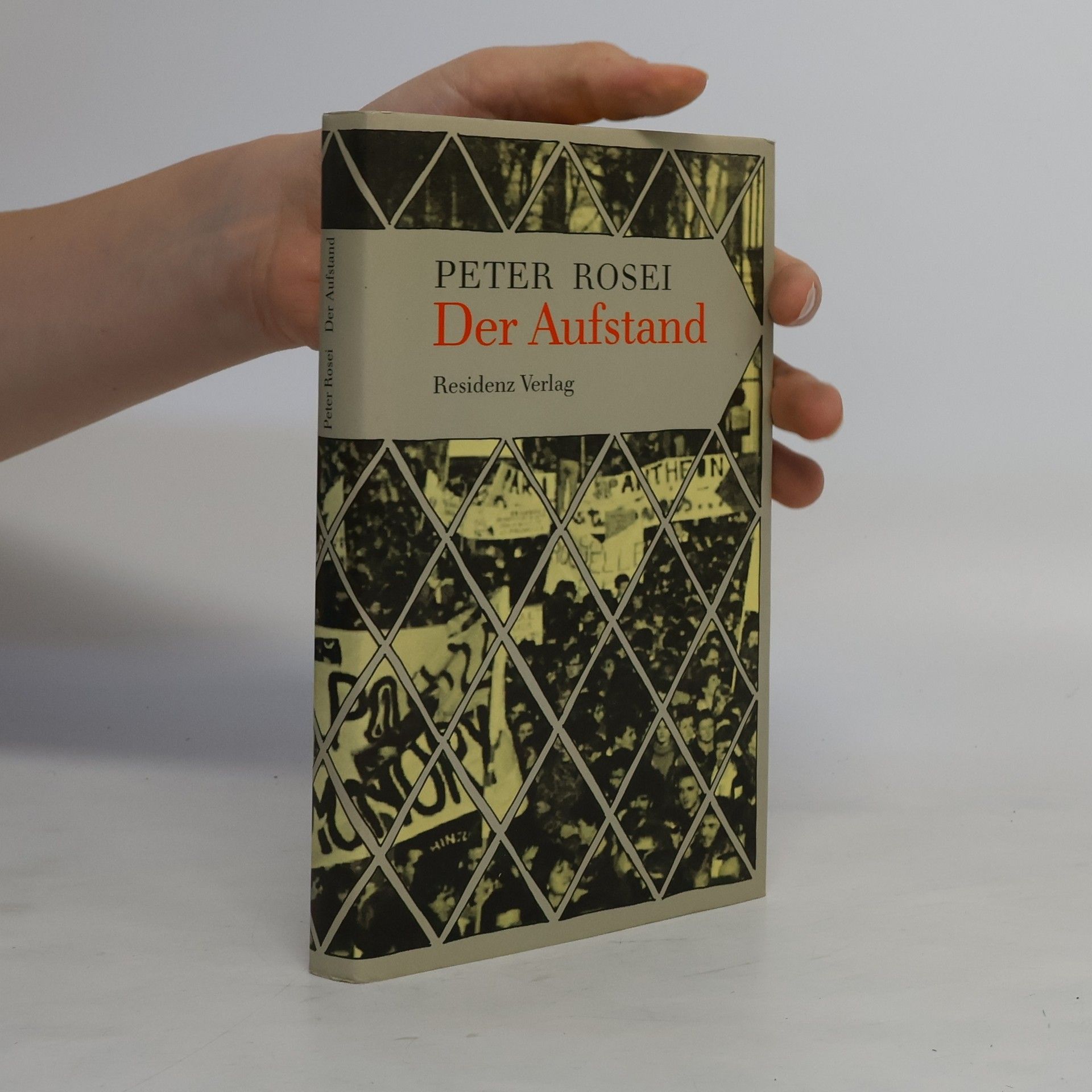

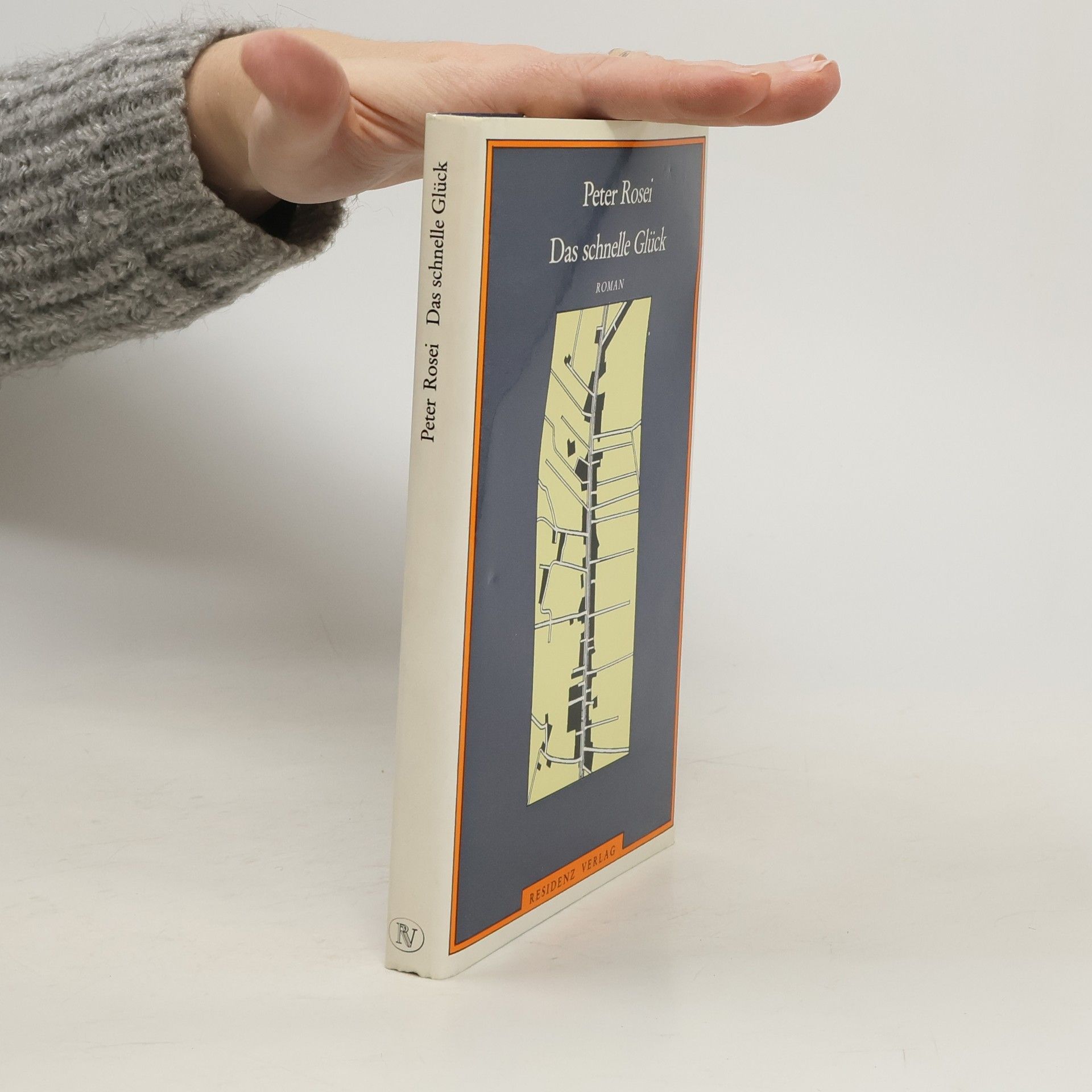


Ungemütliche Essays
Wahrheit und Dichtung
„Das wunderbare Leben“ ist nicht einfach Peter Roseis Autobiografie. Es ist sein Versuch zur literarischen Wahrhaftigkeit und zugleich die Geschichte eines Autors, der viele Leben gelebt hat. Dessen Devise lauten könnte: Das Leben ist wunderbar, auch wenn es zu Zeiten schrecklich ist. Aus kleinen Verhältnissen stammend, kommt der junge Mann als Sekretär des Malers Ernst Fuchs rasch zu Geld, gibt aber alles auf, um seiner Berufung als Dichter gerecht zu werden. Nach Jahren schwerer Krisen folgt ein abenteuerliches Bohème-Leben an der Seite der Künstler und Literaten der 70er- und frühen 80er-Jahre, darunter sein engster und langjährigster Freund H. C. Artmann. Schließlich die große Wende – aber lesen Sie selbst: Wahrheit und Dichtung ergänzen sich in diesem Text.
Lena aus dem steirischen Dorf, Andràs aus dem ungarischen Plattenbau, Eva Bartuska aus der Brünner Vorstadt – sie alle suchen in Wien ihr Glück. Angetrieben von den Versprechen sozialen und ökonomischen Aufstiegs und dem Traum von der großen Liebe, lassen sie sich durch die große Stadt treiben. Doch was ist dieses vielbeschworene Glück? Manchmal ein Filialleiterposten, manchmal eine rauschhafte Nacht, und oftmals eine fadenscheinige Illusion, die an der alltäglichen Gemeinheit zuschanden geht. Und doch wäre dieser Roman kein „Märchen vom Glück“, wenn Rosei hier nicht erstmals fast versöhnlich würde: Und so hat, wer den Niederungen des Lebens ins Auge schaut und alle Hoffnung fahren lässt, am Ende doch Anrecht auf, ja, das ersehnte Glück …
Peter Roseis neuer Essayband erkundet tiefgründige Fragen zu Kunst, Politik und Lebensformen. Seine Texte, geprägt von Selbstbefragung und einem dialogischen Denken, behandeln Literatur, Utopien und bildende Kunst. Rosei fordert dazu auf, die Welt direkt zu zeigen und diskutiert in programmatischen Reden auch gesellschaftliche Themen.
Peter Rosei ist immer in Bewegung gewesen, geleitet von einer unerschöpflichen Neugierde auf Landschaften und Städte, auf Menschen und ihre Geschichten. „Die große Straße“ versammelt erstmals seine Aufzeichnungen aus fünf Jahrzehnten und drei Kontinenten. Wir lernen Peter Rosei als Reisenden kennen, der nicht nur scharf beobachtet und viel weiß, sondern sich auch durchlässig macht für Eindrücke und Bilder, für Gerüche und Klänge, der sich dem Fremden geduldig annähert und ihm dennoch seine Faszination belässt. Von Peking nach Los Alamos, von Seoul nach Moskau, von Paris über Bratislava nach Texas und Istanbul führt uns dieses wunderbar labyrinthische Buch, das erfüllt ist von der Dankbarkeit des Autors für die Buntheit der Welt und die Vielfalt des menschlichen (Über)lebens.
Jana, ehrgeizige Tochter eines abgewirtschafteten Hoteliers aus der slowakischen Tatra, hat nichts als ihre Schönheit, um ihre Träume von einem besseren, aufregenderen Leben im reichen Westen zu verwirklichen. Sie begegnet dem Profiteur Gstettner, der von Wien aus seinen trüben Geschäften nachgeht – ob gefälschte Designermode oder verzweifelte Flüchtlinge, Gstettner handelt mit allem. Tone Kral, der Bauernsohn aus dem slowenischen Karst, der sich als Kellner und Gigolo durchschlägt, und der gealterte Wiener Theaterkritiker Kalman komplettieren das Quartett lebenshungriger Existenzen, die in der Grauzone zwischen alter und neuer politischer Ordnung versuchen, sich durchzulavieren.
„Wir versuchen doch alle nur, auf der goldenen Kugel zu tanzen, ganz egal, wie und wohin sie rollt“, meint der Schweizer Geschäftsmann Weill, Spezialist für Import/Export, im Wiener Café Imperial philosophisch zu seinem Partner Blaschky. Währenddessen fantasiert der abgehalfterte Dichter Josef Maria Wassertheurer am Brunnenmarkt über sein nächstes Meisterwerk und im fernen Sankt Petersburg erwartet ein geheimnisvoller Herr Tschernomyrdin den entscheidenden Anruf. Das kriminelle Netzwerk der Globalisten spannt sich von Zürich und Paris nach Bukarest und Moskau bis ins idyllische Salzkammergut. Mit leichter Hand hat Rosei ein Satyrspiel geschaffen, das die Wirklichkeit zur Deutlichkeit entstellt – so bösartig, dass es zum Lachen ist.
Ein lustvolles Spiel um Eros, Macht und Geld. Gisela Stern hat es geschafft. Aus bescheidenen Verhältnissen stammend, hat sie in eine wohlhabende Familie eingeheiratet, sich eine Karriere in einer Bank erarbeitet und verkehrt in der sogenannten besseren Gesellschaft. Trotzdem bleibt eine ungewisse Sehnsucht, ein Gefühl der Deplatziertheit … Als ein gut aussehender, ehrgeiziger Mann in ihr Leben tritt, beginnt sich das Karussell der Macht zu drehen, die Verknüpfung von Politik und Begehren nimmt ihren Lauf. Meisterlich inszeniert Peter Rosei mit den Mitteln seines lakonischen Stils den Aufstieg und Fall einer Frau vor dem Hintergrund einer höchst korrupten Gesellschaft. Ein scharfsinniger und facettenreicher Roman.
Der Kapitalismus ist ein weites Land Das Leben ist nur eine Chance, und Georg Asamer hat sie genützt: Er hat es zum Eigner einer höchst erfolgreichen Werbeagentur gebracht. Als er mit seinem Protegé Andy Sykora einen Nachfolger installiert, muss er erkennen, dass er alt geworden ist – die Geschäftsstrategien haben sich geändert. Auch Hans Falenbruck, eine Zufallsbekanntschaft von Sykora, Erbe eines Schweizer Pharmakonzerns, geht mit der Zeit: Er reist nach Wien, um von hier aus die Eroberung der Ostmärkte zu betreiben. Irma Wonisch wieder, Tochter aus gutem Haus, eine alte Liebe von Falenbruck, tut sich mit Tom Loschek zusammen. Der aufstrebende Broker weckt mit aparten Investitionsideen den Abenteurergeist, der sie alle verbindet. Peter Rosei führt uns in die Brennkammer jener Welt, wo auf Umwegen und doch fast gesetzmäßig jenes Klima entsteht, in dem sich zerstörerische Wünsche mit himmelstürmenden Hoffnungen paaren. „Geld!“ ist ein lakonischpackendes Buch, ein scharfsinnigböses Puzzle mit komödiantischen Zügen.
Originally published in 2005, Metropolis Vienna, like Heimito von Doderer's great novel The Demons (Sun & Moon Books, 1993) before it, follows several individuals in Vienna as their stories interlink with each other. But unlike von Doderer's work, which focuses on the events leading up to WWII, Rosei's novel concerns the beautiful Austrian city in the second half of the 20th century. A profound and moving novel that introduces one of the great Austrian writers to an English-speaking audience.