Keller - Mansarde - Einsiedelei
Imaginäre Orte des Dichtens. Auch eine Literaturgeschichte

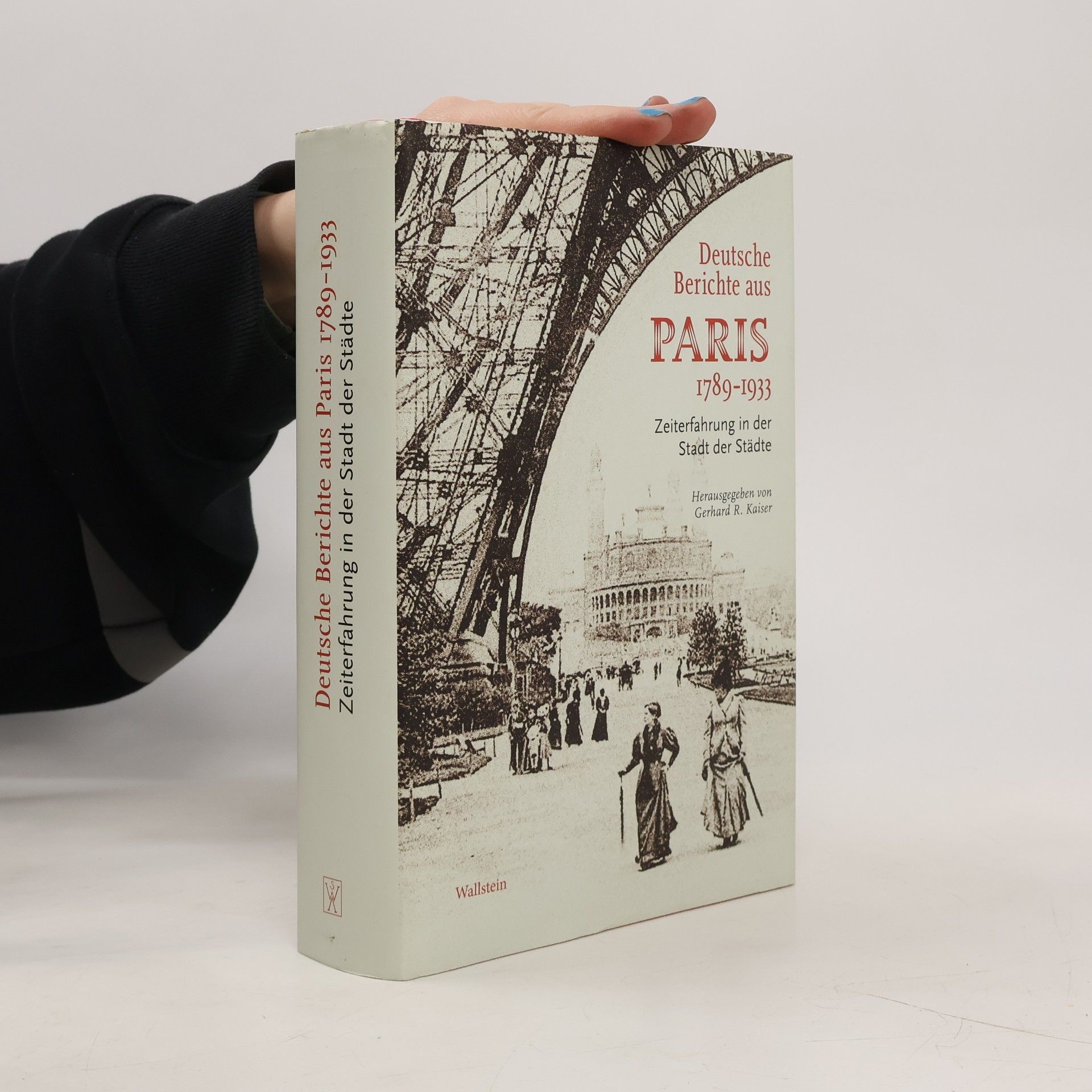
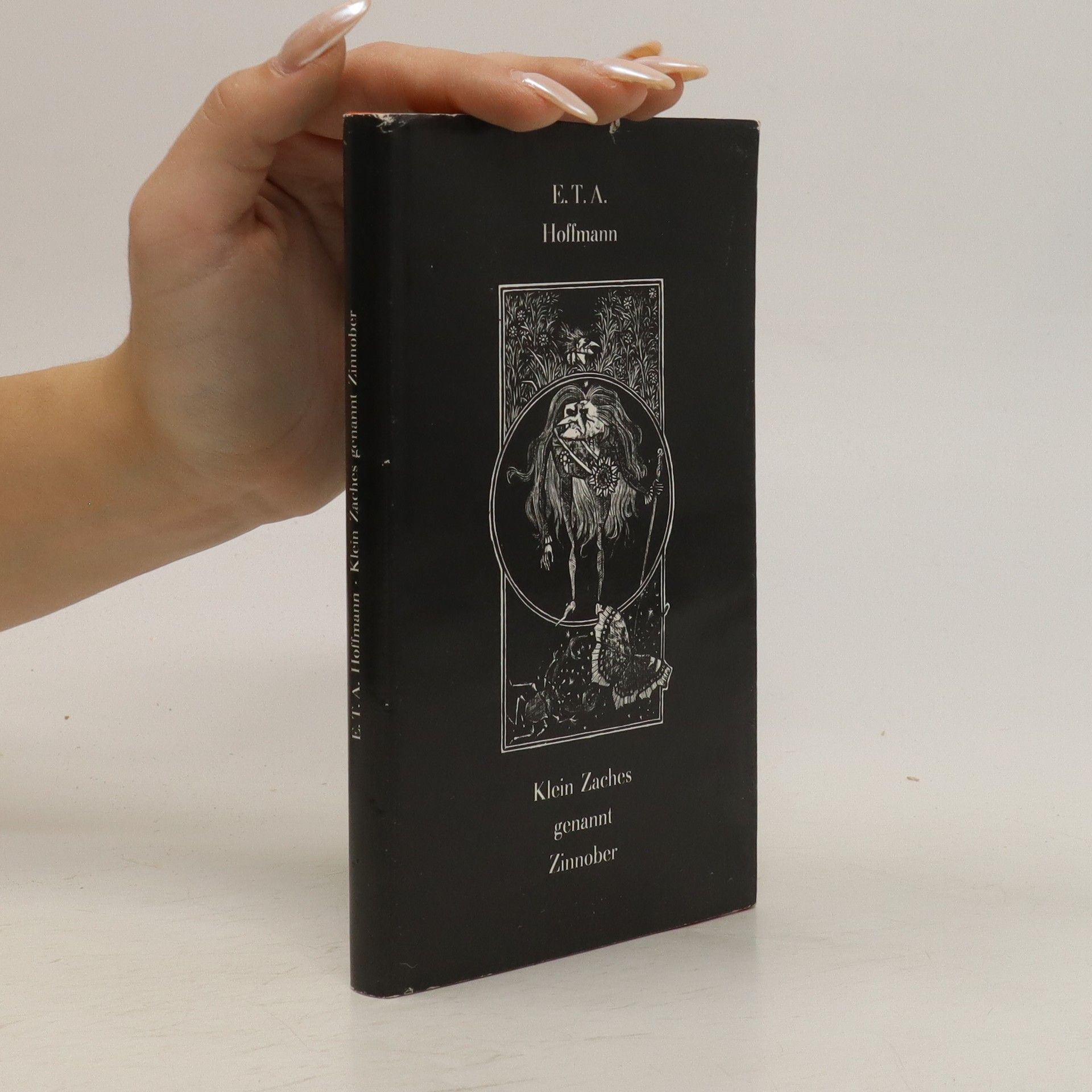


Imaginäre Orte des Dichtens. Auch eine Literaturgeschichte
Literatur und Leben zu Beginn von Weimars großer Zeit
Der kleine Ort Tiefurt, drei Kilometer östlich von Weimar, war um 1780 ein Zentrum des kulturellen Aufbruchs. Hier lebte die verwitwete Herzoginmutter Anna Amalia, die mit Freunden verschiedene kulturelle Aktivitäten initiierte. In Tiefurt entstand einer der ersten englischen Parks in Deutschland, und Goethes Singspiel »Die Fischerin« wurde im Park in einer neuen Form des Freilichttheaters uraufgeführt. Das handschriftlich zirkulierende »Journal von Tiefurt« mit Gedichten, Essays, Übersetzungen und Rätseln spiegelte die höfische Kultur im klassischen Weimar wider. Goethe ermutigte Eckermann, eine Betrachtung über Tiefurt zu verfassen, da der Stoff es wert sei. Er selbst konnte dies nicht tun, da er zu sehr in die bedeutenden Zustände involviert war. Eckermann nahm sich dieser Mühe jedoch nicht an. Gerhard R. Kaiser hat nun in sieben miteinander verwobenen Studien Goethes Aufforderung erfüllt. In einer Abschlussbetrachtung spannt er einen bemerkenswerten Bogen von dem beschaulichen Tiefurt des 18. Jahrhunderts bis in unsere gegenwärtige, von Problemen belastete Welt, und würdigt die besondere Bedeutung der Literatur.
Die kommentierte Textsammlung dokumentiert anderthalb Jahrhunderte anhaltender deutscher Faszination durch die französische Metropole. Unter den großen Zielen ragt Paris zwischen 1789 und 1933 für deutsche Reisende besonders hervor. Während dieser anderthalb Jahrhunderte erfuhren sie die französische Metropole nicht nur als sprachliche, ethnische und kulturräumliche Fremde, sondern auch als einen Ort der fortgeschrittenen Moderne. Meist unausgesprochen suchten sie an ihm Orientierung auf dem Weg in die eigene Zukunft. Spätestens mit dem Ersten Weltkrieg erlosch die utopische Leuchtkraft von Paris. Die Stadt wurde nun von vielen Autoren in weltgeschichtlicher Perspektive als eine Stadt der Vergangenheit vergegenwärtigt. Die über 200 Texte sind in dichter Folge chronologisch angeordnet. Sie präsentieren eine Vielfalt an Themen und sind fokussiert auf den Aspekt »Zeiterfahrung«. Neben bekannten kommen zahlreiche vergessene Autoren zu Wort, darunter etwa Ida Kohl oder Paul Cohen-Portheim, die eine Wiederentdeckung lohnen.
Der neu konzipierte und überarbeitete Band behandelt den Zeitraum von 1945 bis 1968. In neun, literarischen Gattungen gewidmeten Hauptkapiteln werden zeittypische Autoren vorgestellt und signifikante Textausschnitte ihrer Werke geboten.