Was tut ein armer Schlucker, der eine Million erbt? Daniel Dorner aus Berlin, 35, Hausbesetzer, muss entscheiden, was er mit dem vielen Geld denn macht, das ihm sein amerikanischer Onkel so unverhofft vermacht hat. Dafür reist er in die USA, »schaut sich um« – und kämpft Tag für Tag im Waldseehaus und dem ihm zugeteilten Besitz mit sich selbst: hin- und hergerissen zwischen seinem sozialen Gerechtigkeitsideal und seiner womöglich rosigen Zukunft. Peter Blickle erzählt mit viel Esprit und Sprachwitz von unser aller Widersprüchlichkeit und konfrontiert uns mit der unleugbaren Tatsache, dass wir in moralisch prekären Situationen doch (fast) alle dazu neigen, uns zu unsren eignen Gunsten zu entscheiden. Die Erbschaft ist ein packender Roman, eine ethische Herausforderung in Sachen Soll, Haben oder Sein. Für potentielle Erben wie für potentielle Nichterben, gleichermaßen, eine Probe auf Theodor Fontanes sarkastisch auf den Kopf gestellte Sentenz: »Moral ist gut, aber Erbschaft ist besser« …
Peter Blickle Bücher
Peter Blickle ist ein Historiker, der sich auf die Reformation und frühneuzeitliche Gemeinschaften spezialisiert hat. Seine Arbeit bietet tiefe Einblicke in die Gesellschaftsstrukturen und transformativen religiösen Bewegungen dieser entscheidenden Epoche.

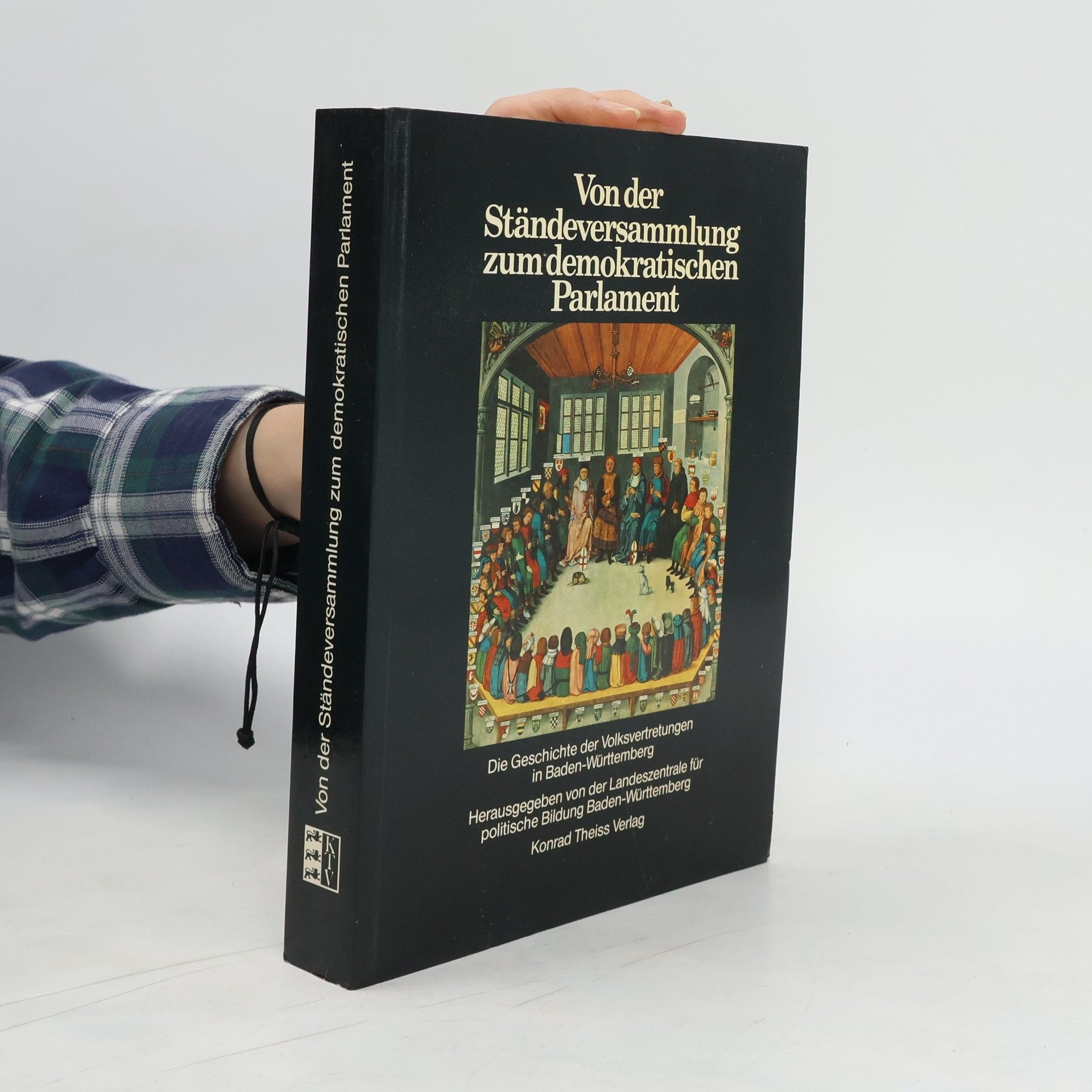
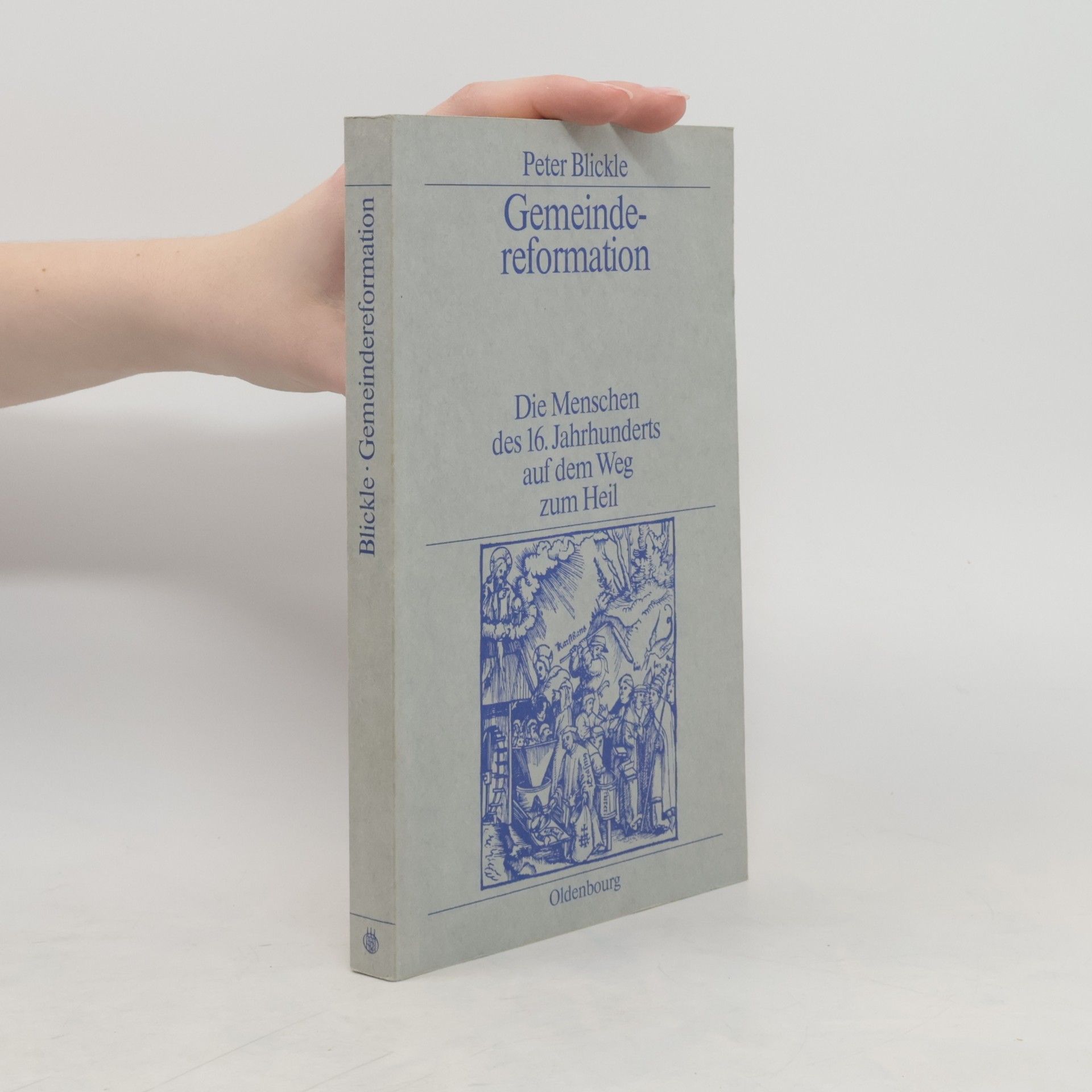

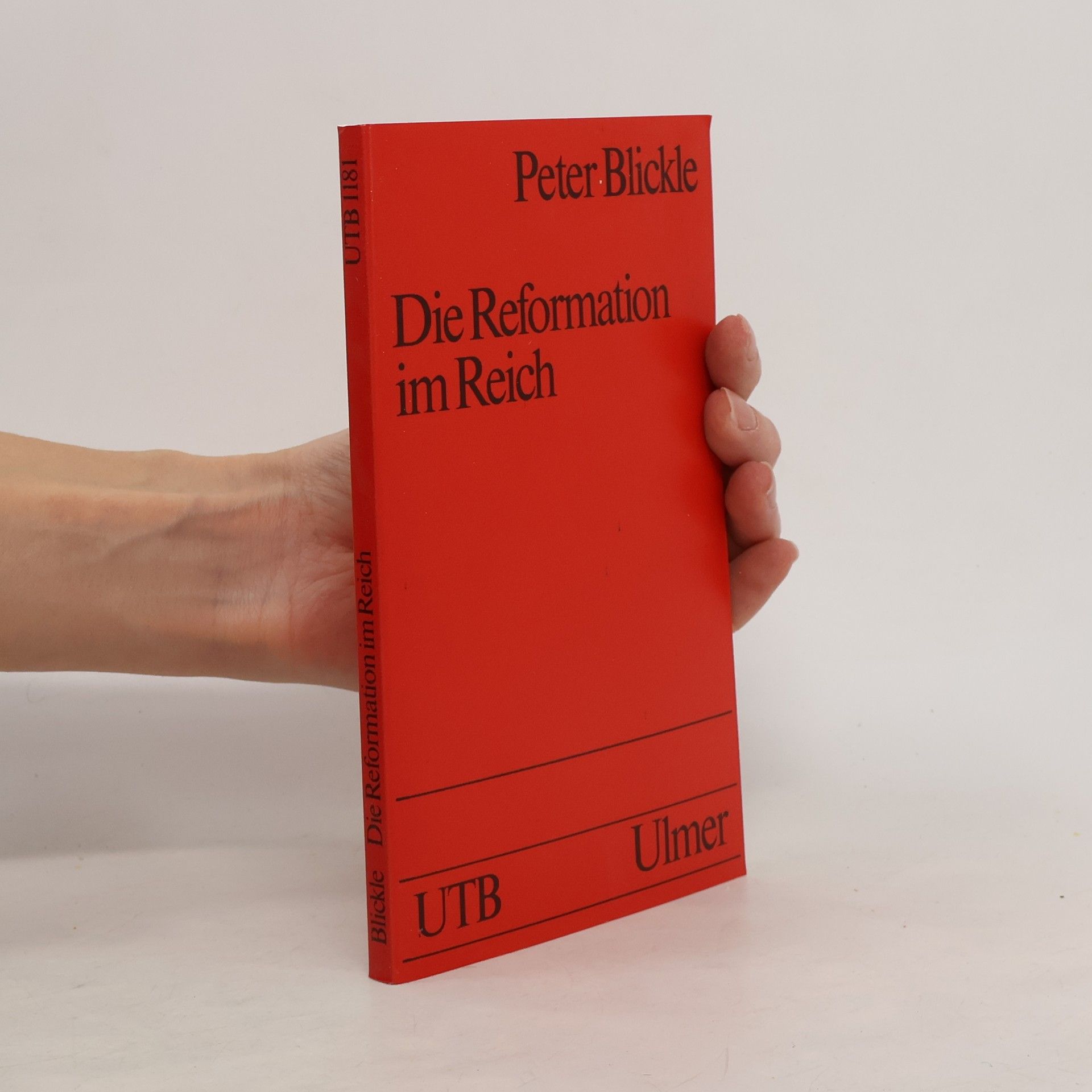

Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten
Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland
Natur des Menschen frei, die in die Forderung nach Herstellung von Freiheit und Eigentum in der Aufklärung mündeten.
Die Argumentationsschritte sind in den folgenden Überlegungen angedeutet: Was verstehen Bauern und Bürger unter Reformation, und wieweit läßt sich ein gemeinsames Reformationsverständnis feststellen (1)? Was übernimmt die bäuerlichbürgerliche Gesellschaft von den Reformatoren, und wo ist sie originär, anders gewendet, gibt es eine eigene Reformation der einfachen Leute (2)? Schließlich - wie erklärt sich der Rezeptionsprozeß in der Gesellschaft (3)?
Von der Ständeversammlung zum demokratischen Parlament
- 376 Seiten
- 14 Lesestunden
500. Jahrestag 2025 Kirchen, Klöster und Burgen gingen in Flammen auf, als die Bauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Jahren 1524 bis 1526 gegen ihre geistlichen und weltlichen Herren aufbegehrten. Pfaffen, Vögte und Grafen hatten versucht, ihnen zu viel von ihrer Freiheit zu rauben, und sie zu sehr mit Abgaben belastet. Die Freiheitsforderung der Bauern drückt im Kern die Überzeugung von der Universalität der Menschenrechte aus. Ursachen, Verlauf und Auswirkungen des Bauernkrieges werden in dem vorliegenden Band fesselnd erzählt und allgemeinverständlich erklärt.
Der Bauernkrieg
- 144 Seiten
- 6 Lesestunden
Hunderttausend tote Bauern – die Zahl lief um im Reich und war allgemein die grobe Aufsummierung dessen, was man gerüchteweise von den Schlachten des Bauernkriegs gehört hatte. „Das vergossene Blut des Jahres 1525“, schrieb ein Schweizer Beobachter, sei ausreichend, „alle Tyrannen zu ertränken“. Waren die Forderungen und Aktionen des Gemeinen Mannes so revolutionär, daß Fürsten und Adel sie wie Hochverrat und Landfriedensbruch behandeln mußten? Peter Blickle erklärt im vorliegenden Band, wie die Aufständischen einen Diskurs über Freiheit und Gerechtigkeit auslösten, der im Erfolgsfall zur Ausweitung kommunaler Rechte der Dörfer und Städte geführt und damit das Reich stark republikanisiert hätte. Daß der Bauernkrieg zur Revolution werden konnte, ist nicht zuletzt den Reformatoren geschuldet, mehr Huldrich Zwingli als Martin Luther. Schon deswegen, aber auch wegen seiner großen Ausdehnung in der Schweiz und Österreich, ist er nicht nur ein deutscher. Auch war er keineswegs folgenlos. Der Autor hebt heraus, daß die nach der militärischen Niederwerfung geschlossenen Verträge den Untertanen für ihre Person und ihren Besitz Rechte mit verfassungsmäßigen Garantien einräumten, die modernen Menschen- und Bürgerrechten nahekommen. Er zeigt weiter, wie die gescheiterte Revolution von 1525 seit 200 Jahren für Nationalismus, Sozialismus und Liberalismus nutzbar gemacht wurde und auch auf diese Weise geschichtlich weitergewirkt hat.
Andershimmel
Roman
Andershimmel: ein anrührender, ein poetisch-sensibler Roman von starker erzählerischer Kraft, gleichsam ein schwäbisches Geschwister von Deborah Feldmans berühmt gewordenem Roman Unorthodox. Ein Roman über das Andere in uns – das andere Geschlecht, die anderen Heimaten, die anderen Religionen, die anderen Himmel. Welten prallen aufeinander – christliche und muslimische, amerikanische und deutsche, pietistische und weltliche, wissenschaftliche und spiritistische, und dabei geht es um Menschen in ihrem Ringen um Liebe und Verbundenheit, in ihrer Sehnsucht nach Erlösung.
Aufhebung der Leibeigenschaft, Wahl des Pfarrers, Stärkung der Selbstverwaltung der Dörfer, Gesetze nach christlichen Normen – diese Forderungen der Bauern, die sie mit mächtigen Demonstrationen vertraten, wurden im Jahr 1525 Ursache für einen mit äußerster Grausamkeit geführten Krieg der Herren gegen ihre Untertanen. An der Spitze des Heeres der Fürsten, des Adels und der Städte, dem Zehntausende zum Opfer fielen, stand Georg Truchsess von Waldburg, der als Bauernjörg zu einer Schreckensgestalt wurde und dessen Geschichte dieses Buch erzählt. "Ein schöner und lesenswerter Band zu einem wichtigen Kapitel schwäbischer, deutscher, ja europäischer Geschichte." Joachim Worthmann, Stuttgarter Zeitung
Der Bauernjörg
- 586 Seiten
- 21 Lesestunden
Kaiser Karl V. hat ihn als Retter des Reiches gepriesen - Georg Truchsess Freiherr zu Waldburg. Als Oberster Feldhauptmann eines Fürstenheeres hat er den größten Aufstand niedergeworfen, den Europa vor der Französischen Revolution erlebt hat. Peter Blickle entwirft in seiner fulminanten Geschichte des Bauernjörg ein dramatisches Panorama des Bauernkriegs. Erstmals werden der Verlauf des Bauernkriegs in Süddeutschland und das Ringen um seine Legitimierung detailliert beschrieben. Anhand meisterhaft erzählter Episoden zeigt Peter Blickle das Hauptproblem des Konflikts: Machtdenken verbietet es den Herren, sich mit den berechtigten Anliegen ihrer Untertanen auseinanderzusetzen. Georg Truchsess von Waldburg ist nicht nur Vollstrecker dieser arroganten Mentalität des Adels, er selbst fördert sie durch die ihm eigene Kriegslüsternheit. Viele prägnante Zitate lassen ein lebendiges und anschauliches Charakterbild entstehen, das den Bauernjörg als autoritären militärischen Führer, robusten Politiker und begabten Redner zeigt.

