Theodor Bühler Bücher

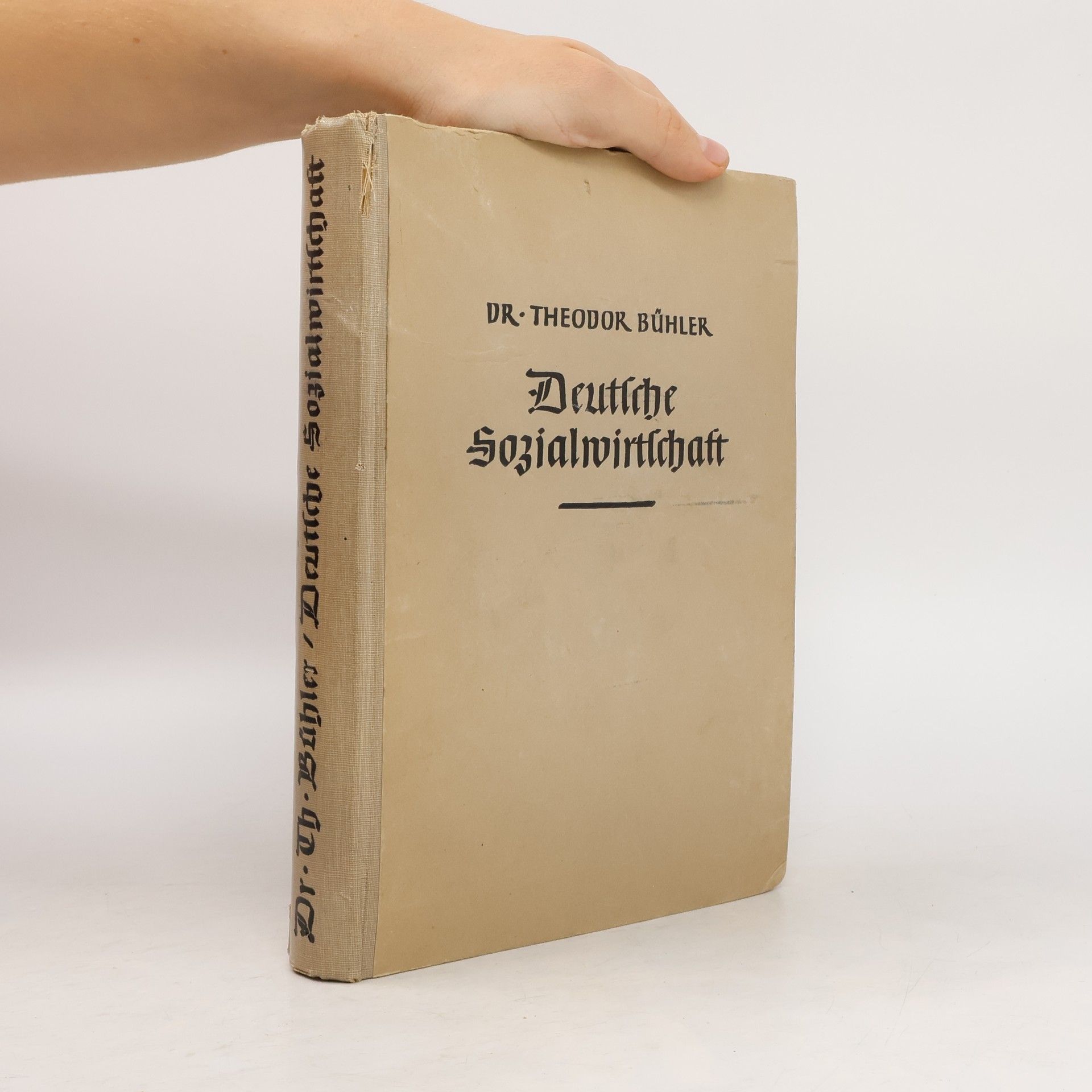
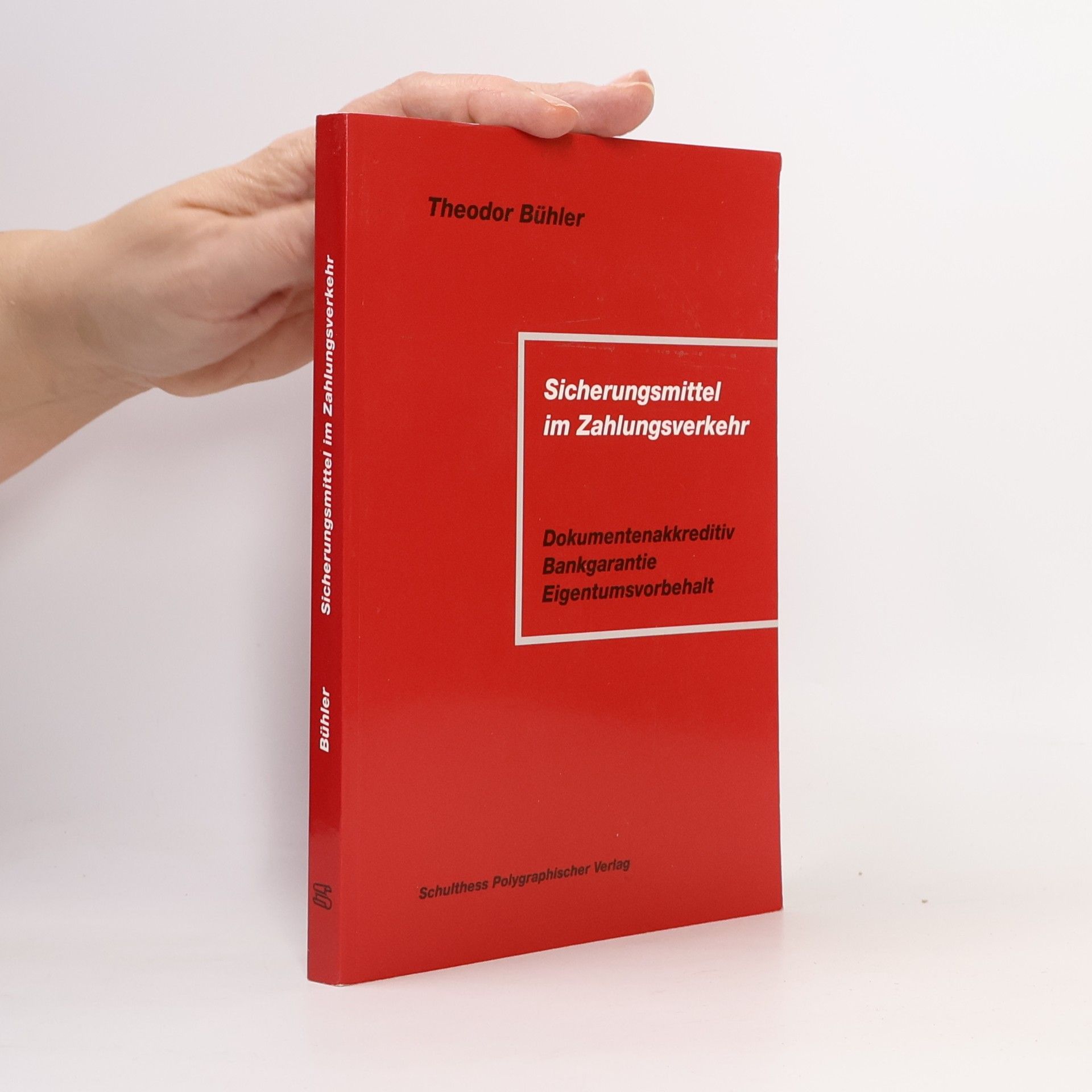


Geschichte des schweizerischen Obligationenrechts
Allgemeiner Teil
Bereits in der «Geschichte des Aktienrechts in der Schweiz» des Autors wurde auf die Geschichte des schweizerischen Obligationenrechts als Teil des Zivilgesetzbuches sowie auf die Biographien der an dieser Gesetzgebung Beteiligten eingegangen. Vorliegend werden diese Ausführungen ergänzt und korrigiert unter der Perspektive des Allgemeinen Teils. Dabei spielt die Rezeption von anderen Rechtsordnungen eine grössere Rolle. Im Vordergrund stehen das römische Recht und der französische Code civil. Der «Allgemeine Teil» enthält die Grundsätze des Obligationenrechts, aber auch des übrigen Privatrechts und ist daher auch der am wenigsten abänderbare Teil des OR. Das Wesentliche der Monographie ist es, die Entstehung und Entwicklung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen Teils nachzuzeichnen, womit die Überlegungen der Verfasser*innen aufgezeigt werden können. Damit wird eine solide Basis geschaffen für die Auslegung der betreffenden Bestimmung. Die Auslegung selbst wird der Rechtsprechung und der Rechtslehre überlassen.
Sicherungsmittel im Zahlungsverkehr
Dokumentenakkreditiv, Bankgarantie, Eigentumsvorbehalt
- 234 Seiten
- 9 Lesestunden
German
Europäische Rechts- und Regionalgeschichte - 10: Schweizerische Rechtsquellen und Schweizerische Verfassungsgeschichte nach einer Vorlesung von Ulrich Stutz (1868-1932)
Nach einer Nachschrift von Dr. Adolf Im Hof
- 604 Seiten
- 22 Lesestunden