Uwe Gerber Bücher



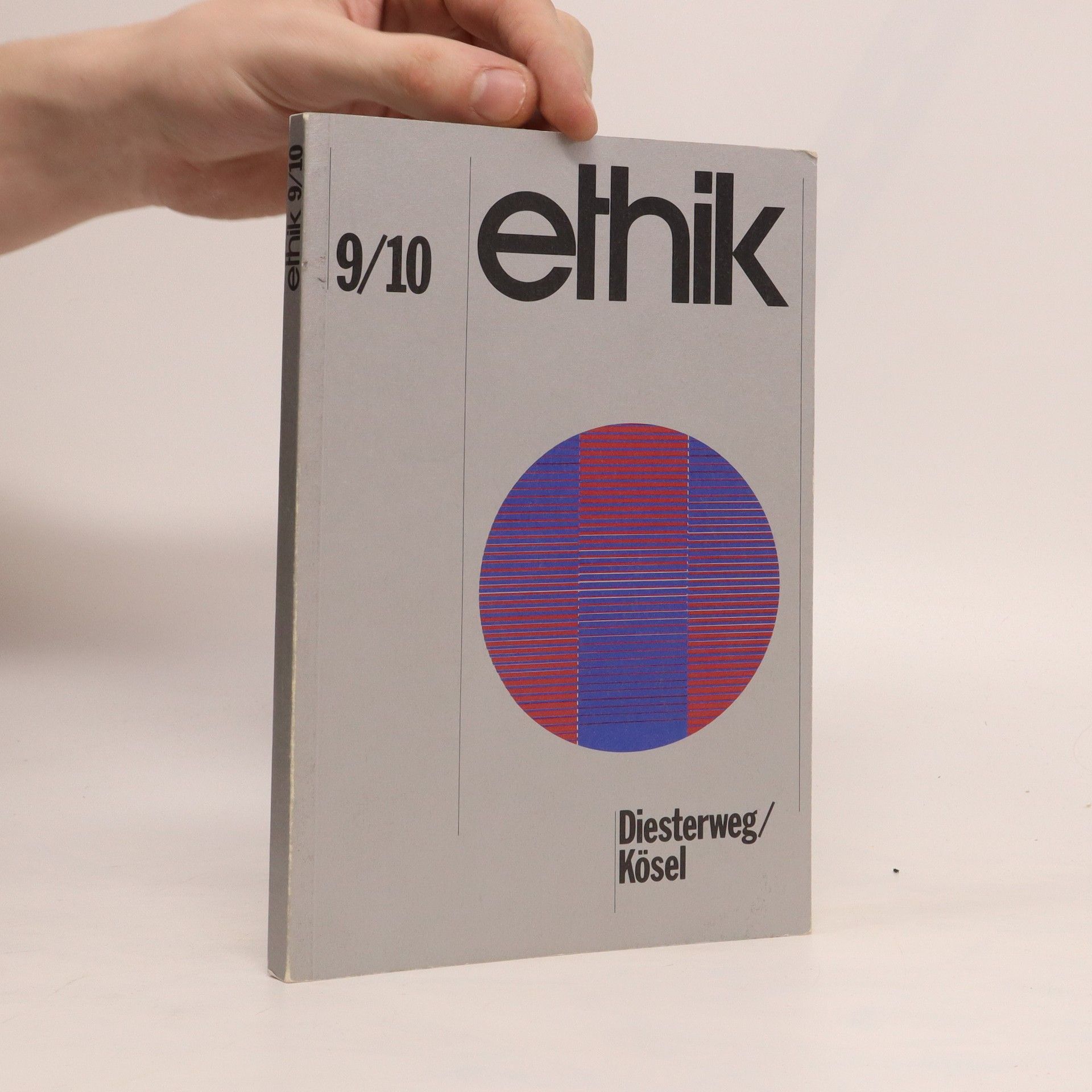
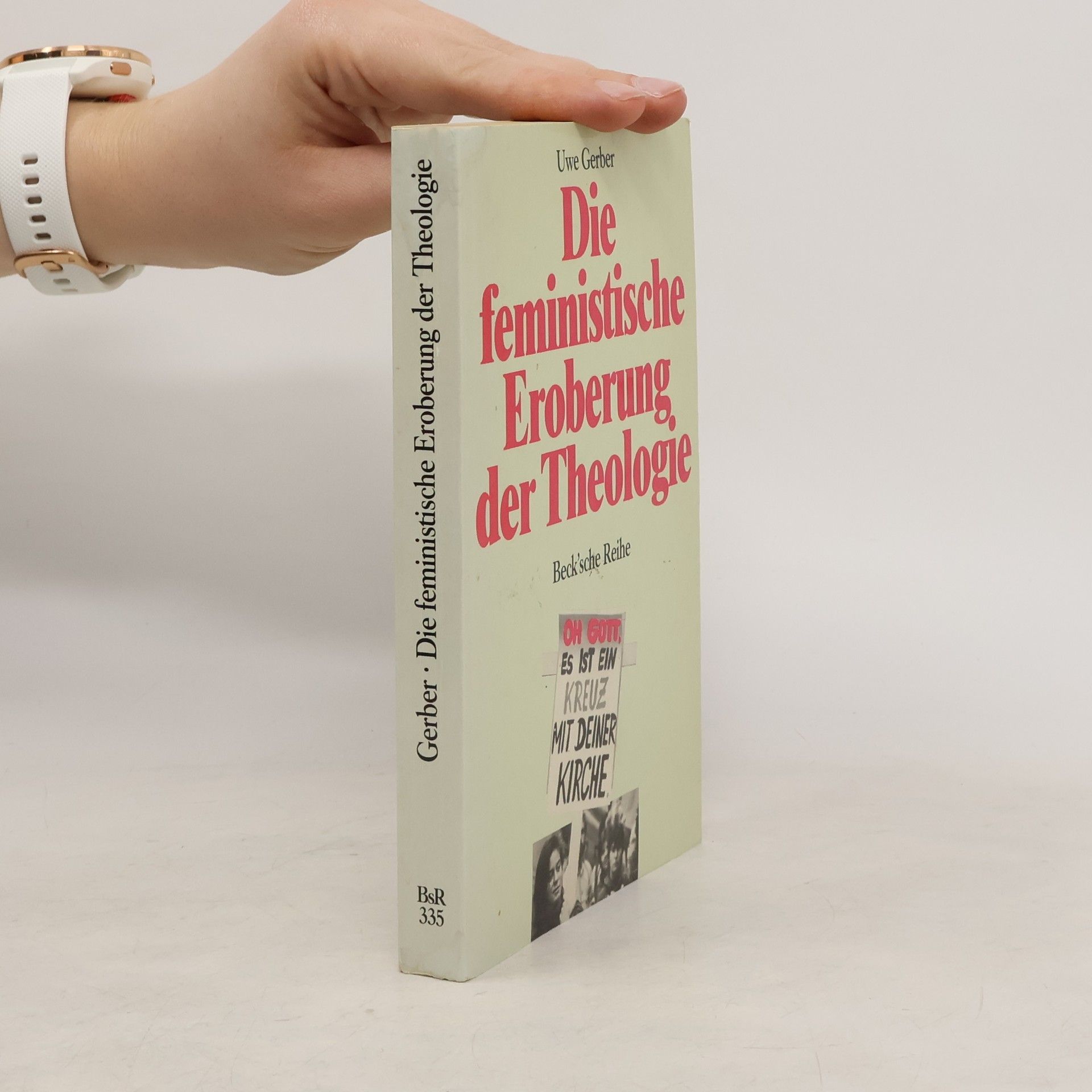
Der Protestantismus wird in diesem Werk kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf gewaltbelastete Gottesbilder und veraltete Sühnopfer-Vorstellungen. Die Autorin thematisiert, wie das traditionelle Konzept einer Heilsgeschichte an Bedeutung verliert und stattdessen die Bedeutung von heilsamen Begegnungen in der Gegenwart in den Vordergrund rückt. Es wird eine neue Perspektive auf Glauben und Spiritualität entwickelt, die die aktive und verpflichtende Nachfolge in der 'Spur' Gottes betont.
"Anerkennung soll die Leerstelle ausfüllen, die mit dem Zusammenbruch metaphysischer Systeme aufgetreten ist. Die Ethik sozialer Anerkennung wird damit aber mit Erwartungen überfrachtet. Durch technologische Veränderungen verändern sich permanent die Statusbestimmungen: Die Autonomie des Menschen konkurriert mit künstlich-intelligenten Maschinen, die Leidensfähigkeit mit der des Tieres, die Individualität mit der digitalen Selbstinszenierung und die Geschöpflichkeit mit der technologischen Selbstvergöttlichung. Die Beiträge suchen nach Bedingungen sozialer Anerkennung, die nicht zirkulär ausgehandelt werden können, sondern Kategorien einbringen, die auch von Menschen verwendet werden, wenn sie von Gott sprechen. Damit soll die Basis einer theologischen Anerkennungstheorie gelegt werden"-- Back cover