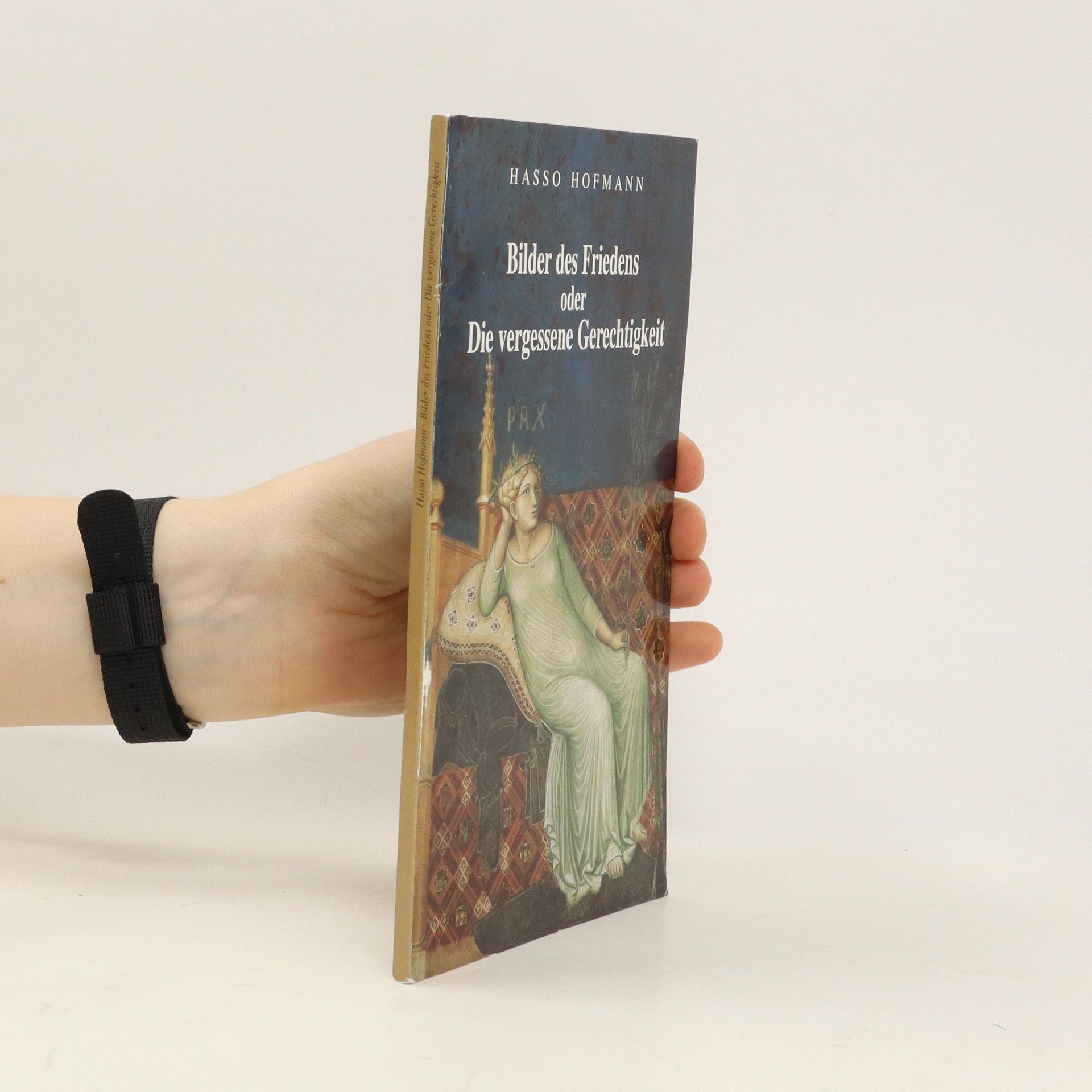Carl Schmitt (18881985) ist nach wie vor der umstrittenste deutsche Staatsrechtler des 20. Jahrhunderts. Die vorliegende entwicklungsgeschichtliche Gesamtdarstellung erschien zuerst 1964. Trotz anhaltender Diskussion und standig wachsender Literatur uber Schmitt ist sie bislang die einzige ihrer Art geblieben. Am rechtsphilosophischen Leitfaden des Problems der Begrundung von Recht beschreibt sie Schmitts Weg von der rationalen Legitimitat uber einen politischen Existenzialismus in eine rassische und dann geschichtliche Legitimitat. Die Vorbemerkung zur zweiten Auflage erweitert die Darstellung um Schmitts Veroffentlichungen nach 1964 und behandelt die wichtigsten Ergebnisse der literarischen Kontroversen bis 1991. Eine Aktualisierung und Vertiefung des Diskussionsstands erfolgt im Vorwort zur vierten Auflage 2002. Der Nachdruck des Textes von 1964 pladiert nach wie vor fur einen sachorientierten rechtstheoretischen Umgang mit dem umstrittenen Denker.
Hasso Hofmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
4. August 1934 – 21. Januar 2021