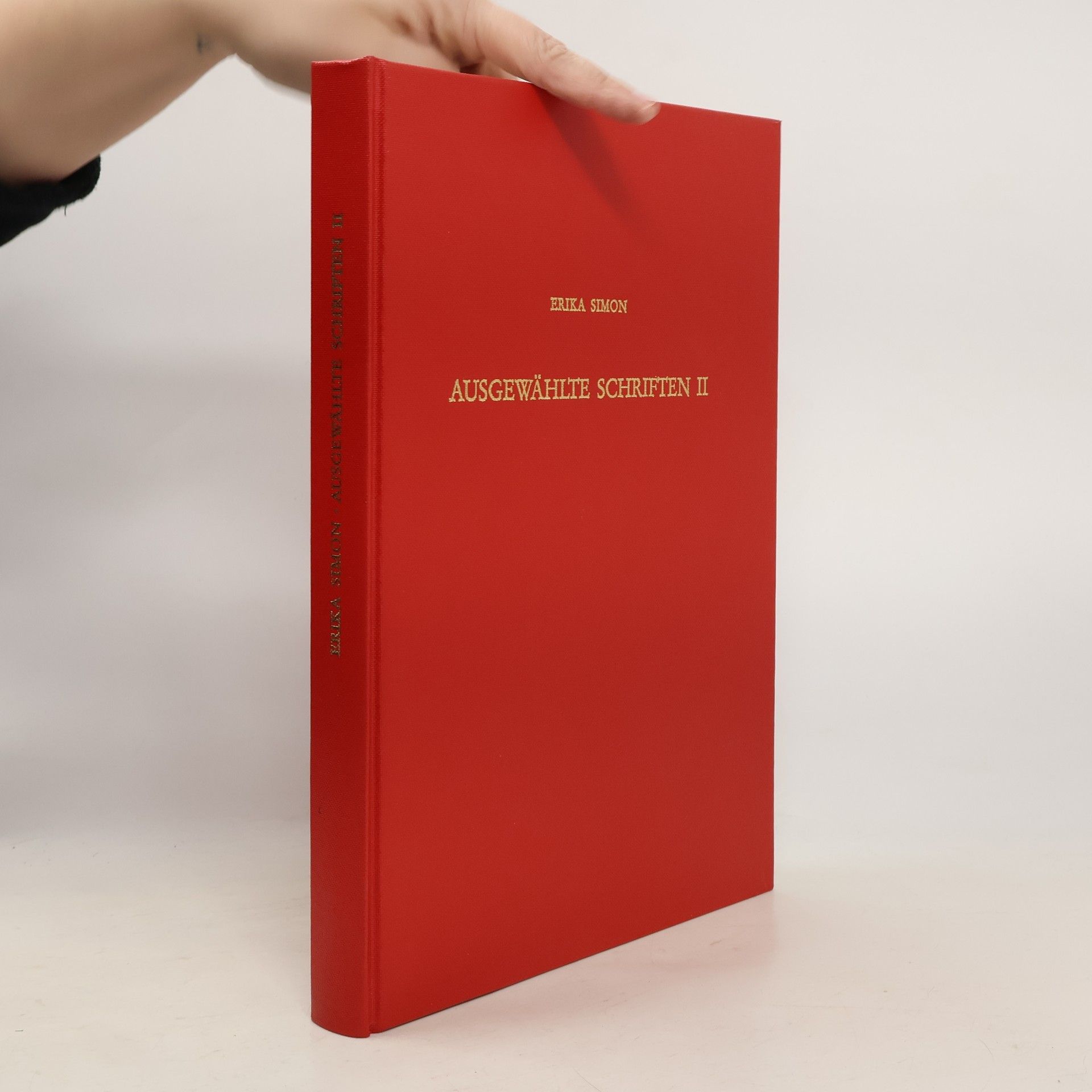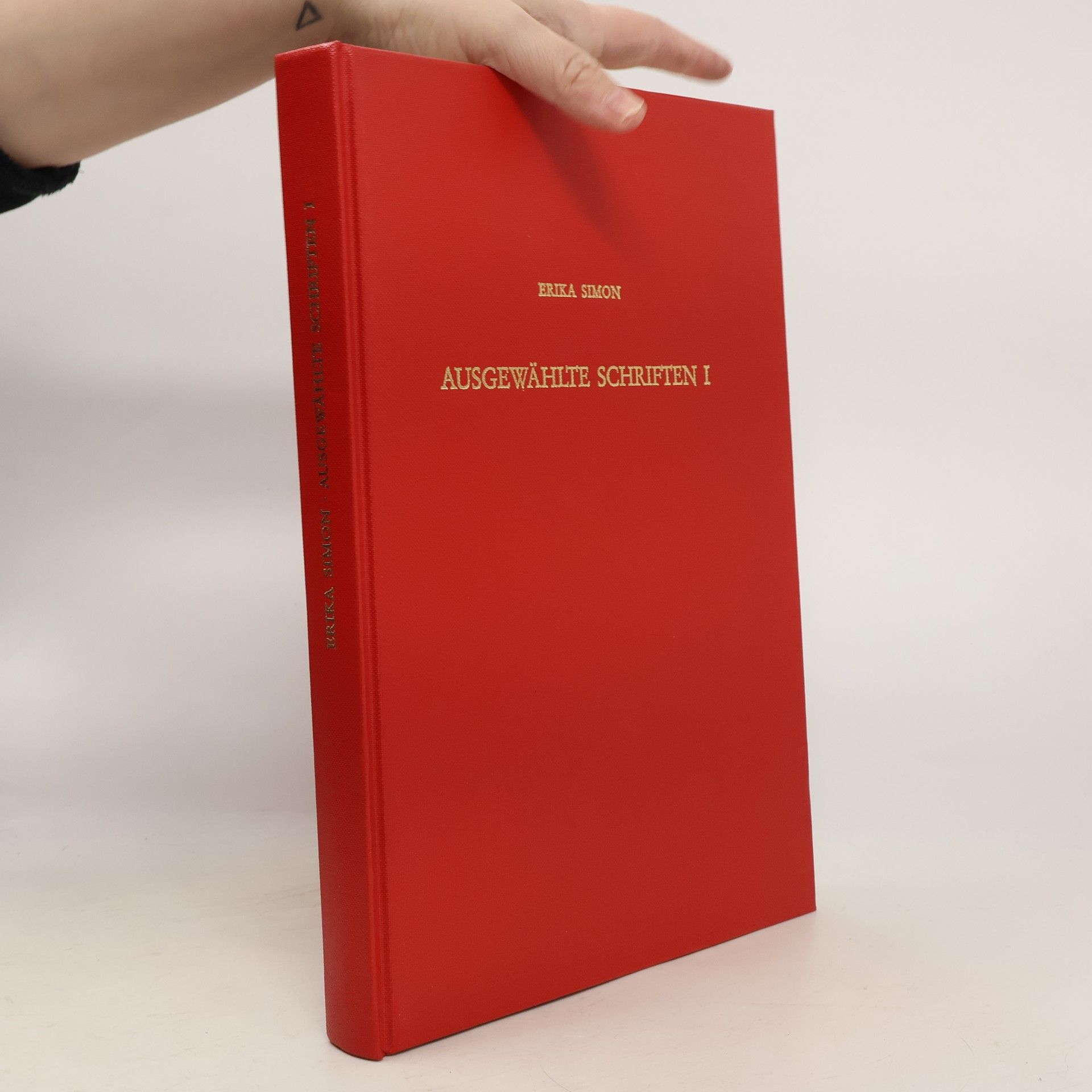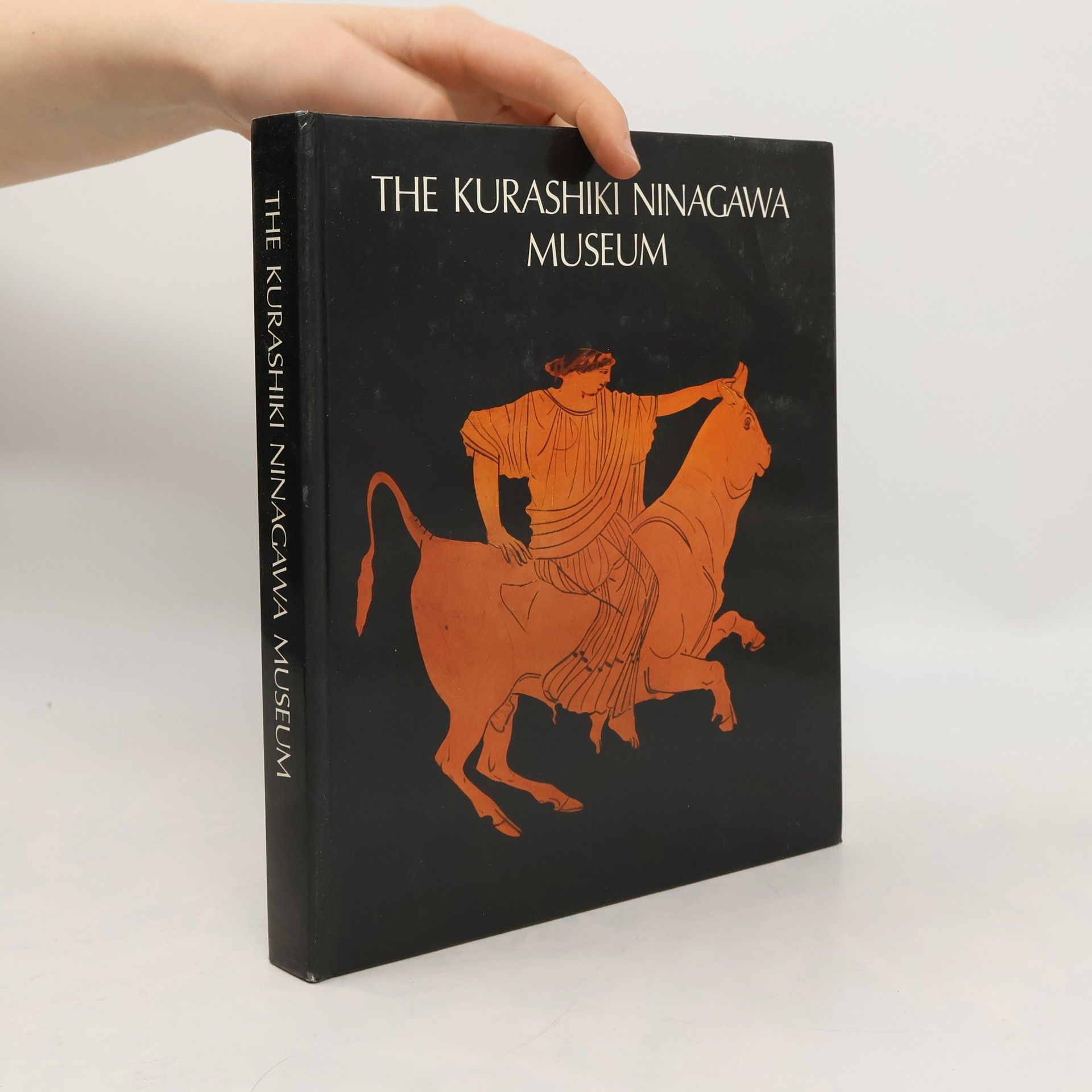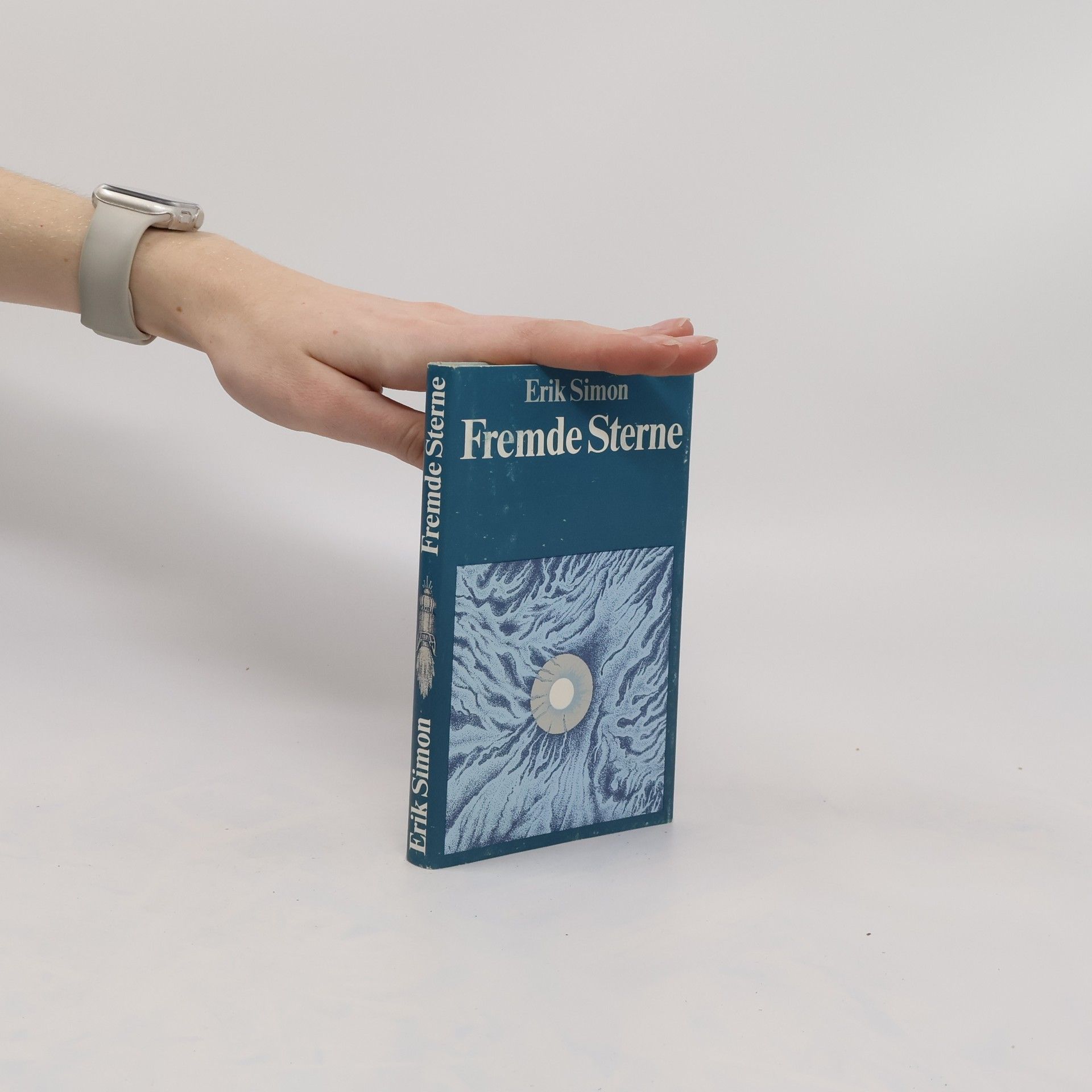Erika Simon Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
27. Juni 1927 – 15. Februar 2019
Dieser Autor ist auf die Übersetzung von Science-Fiction-Werken aus verschiedenen Sprachen ins Deutsche spezialisiert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf russischen und englischen Werken, aber er übersetzt auch aus einer Reihe anderer slawischer Sprachen. Seine Arbeit erweckt das Science-Fiction-Genre durch sorgfältige Übersetzungen zum Leben, die den ursprünglichen Geist der Geschichten bewahren. Sein Beitrag liegt darin, einem deutschsprachigen Publikum eine vielfältige Auswahl an Sci-Fi-Literatur zugänglich zu machen.
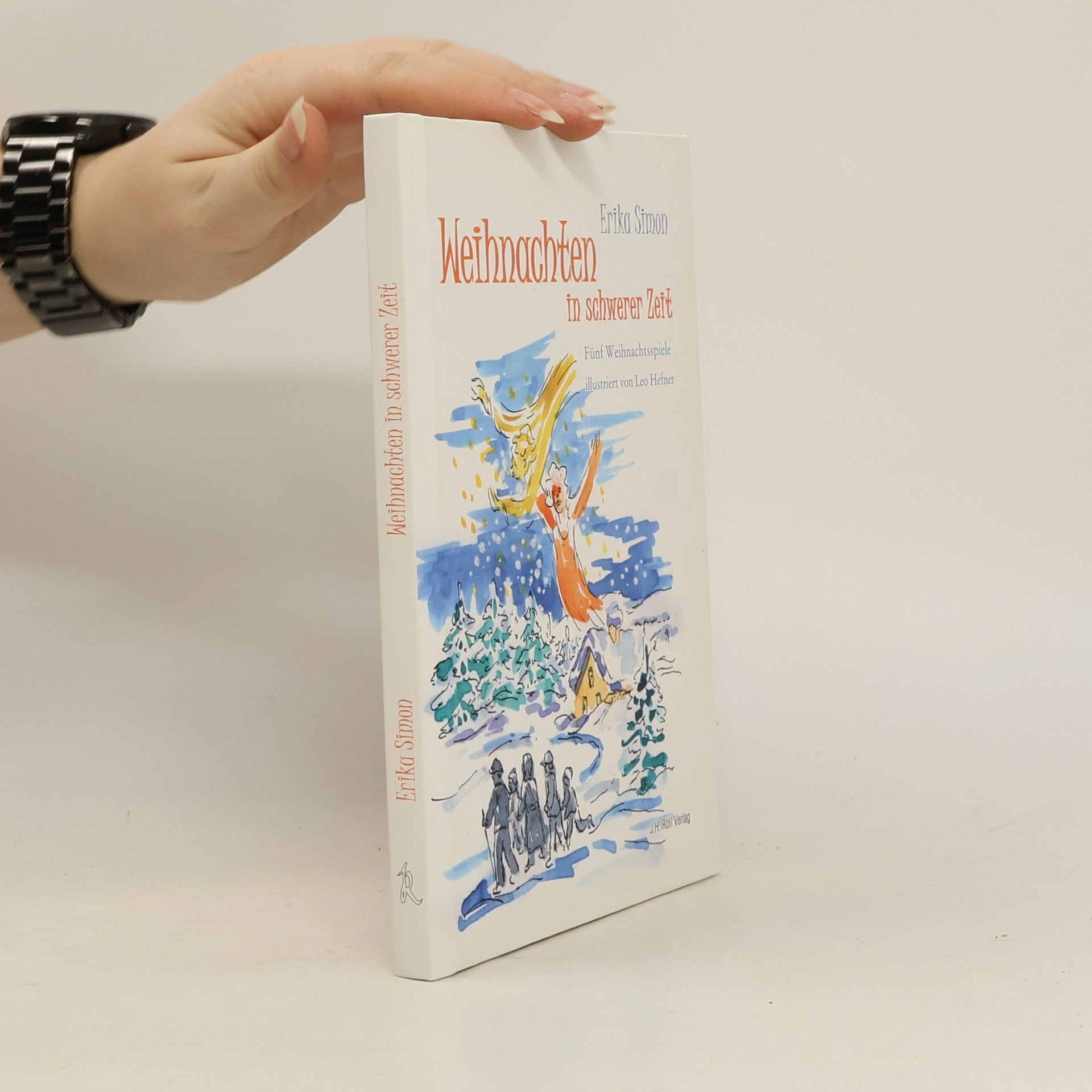
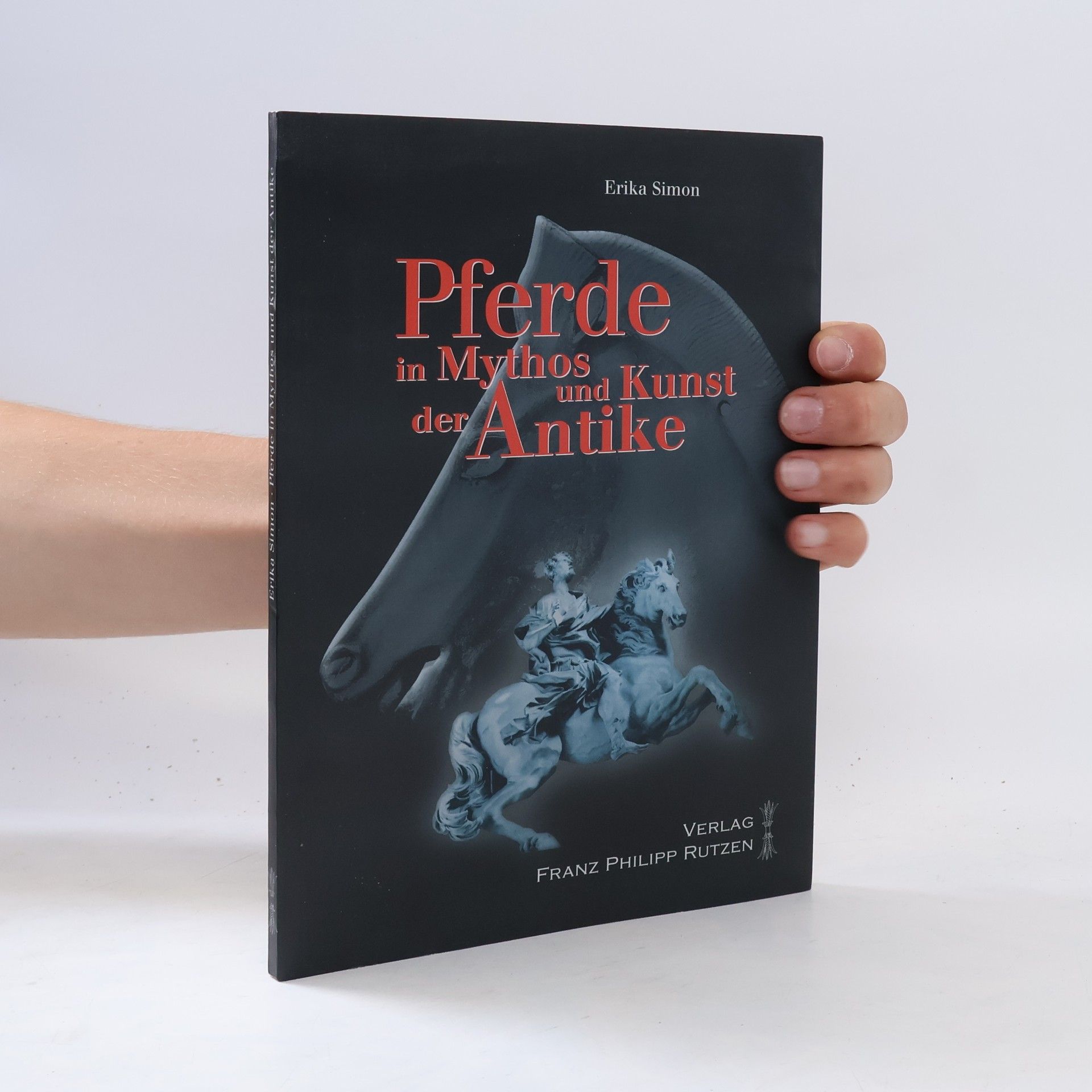
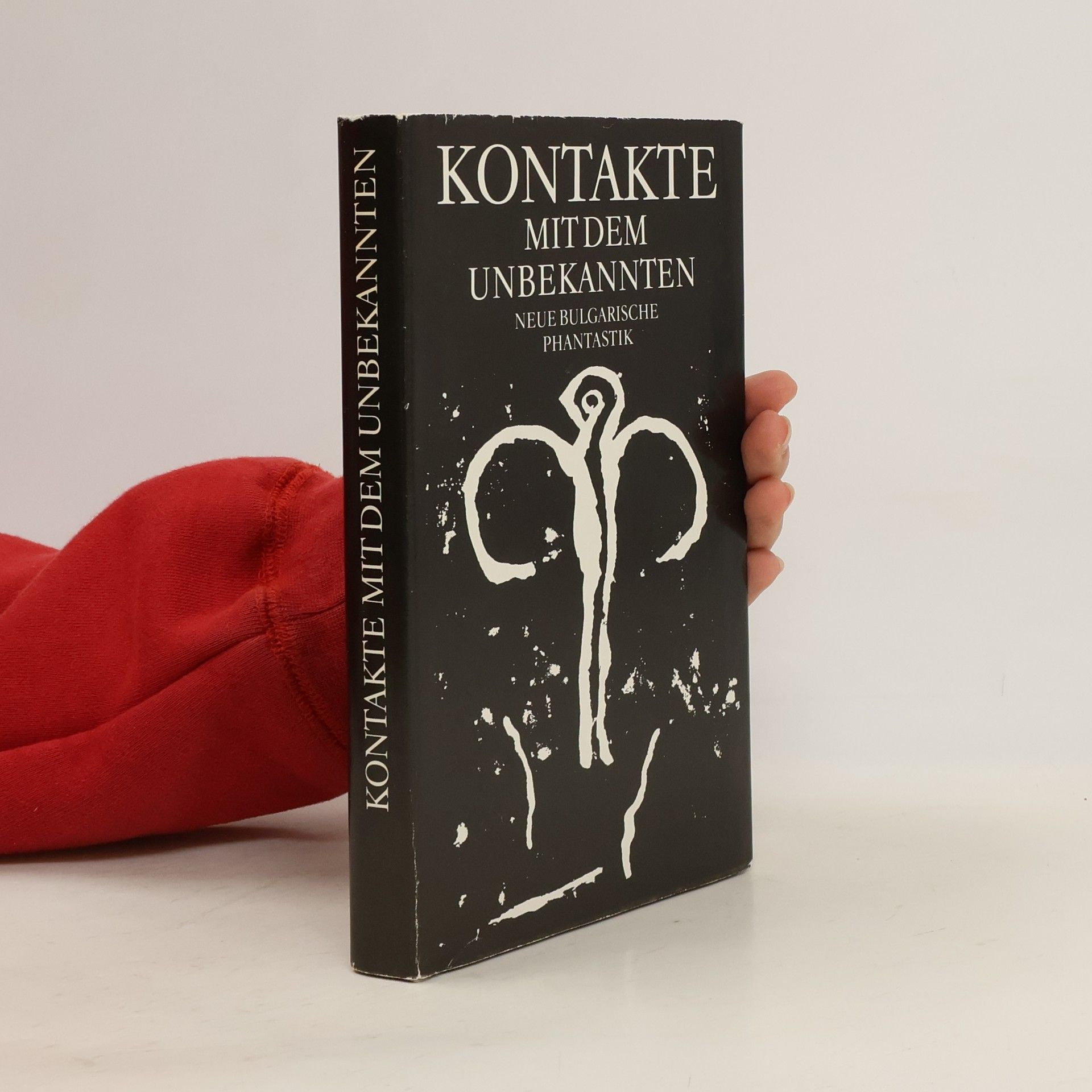

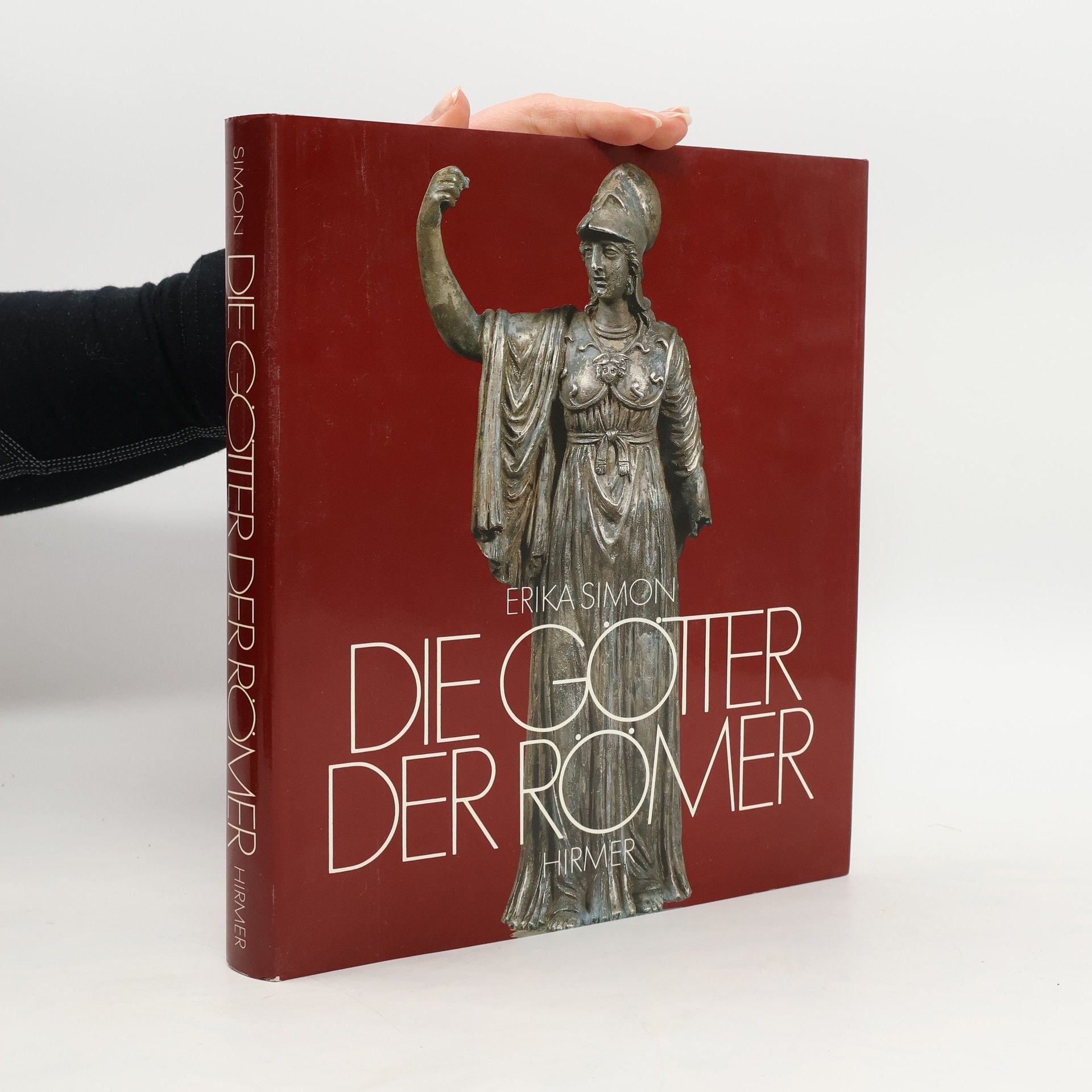

Ausgewählte Schriften
- 271 Seiten
- 10 Lesestunden