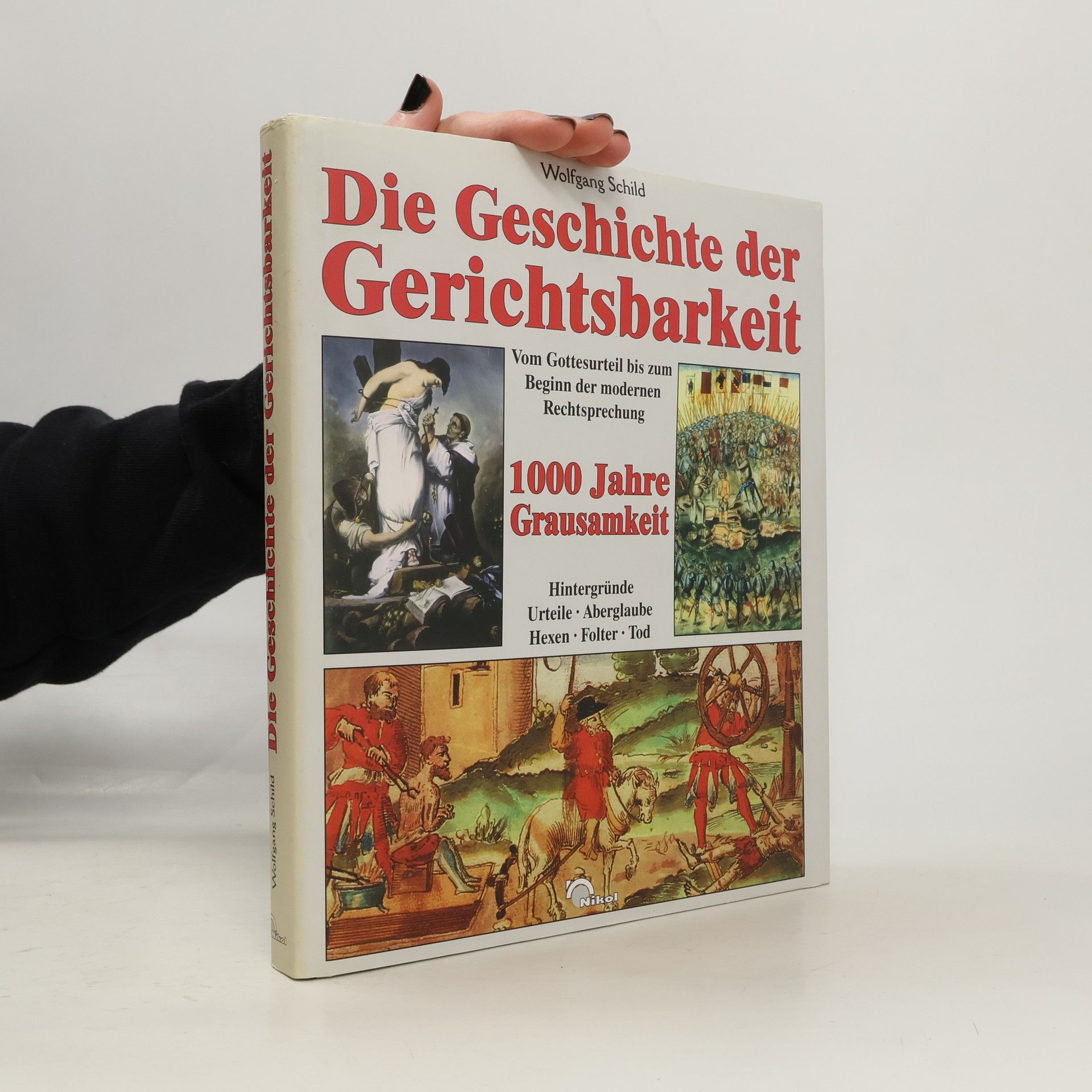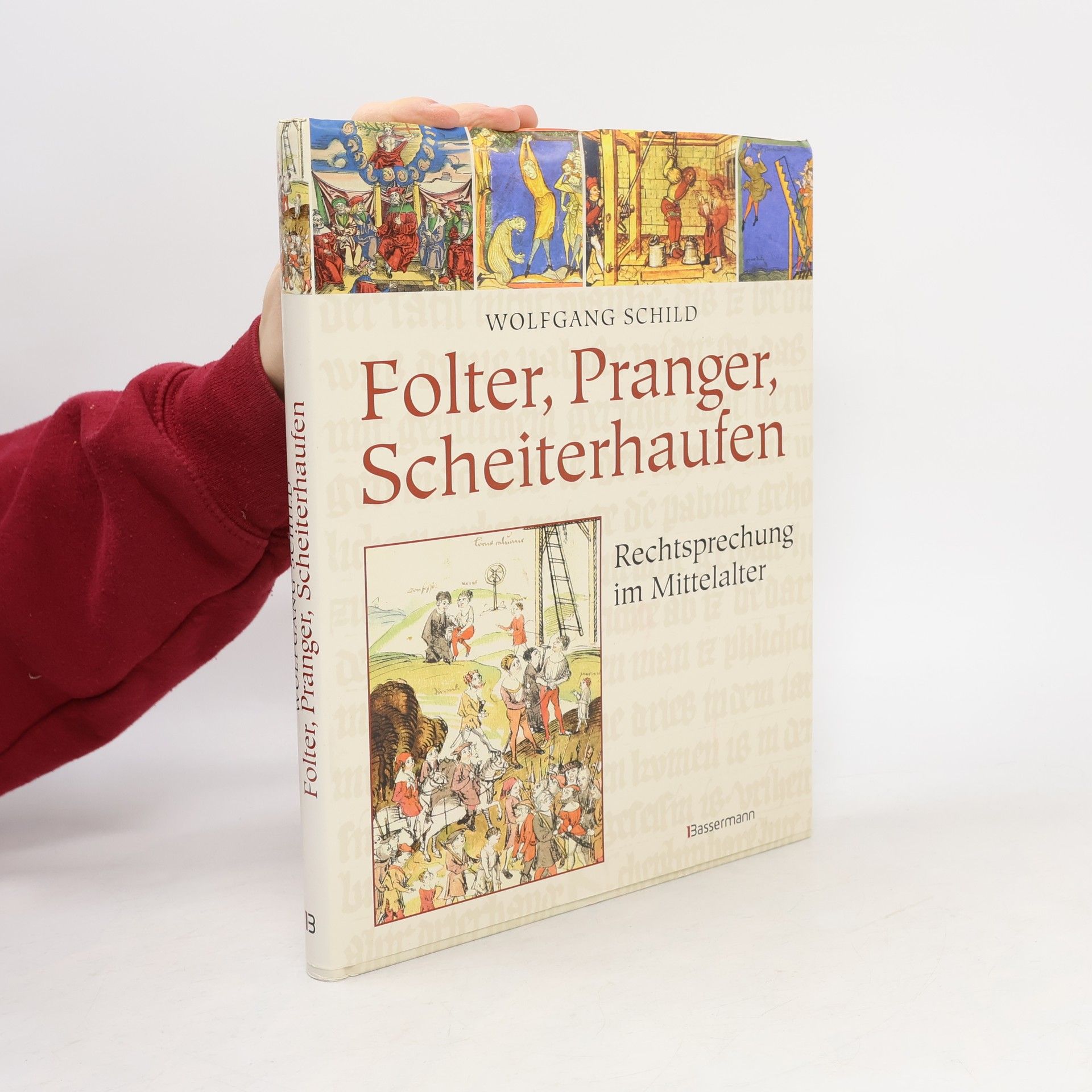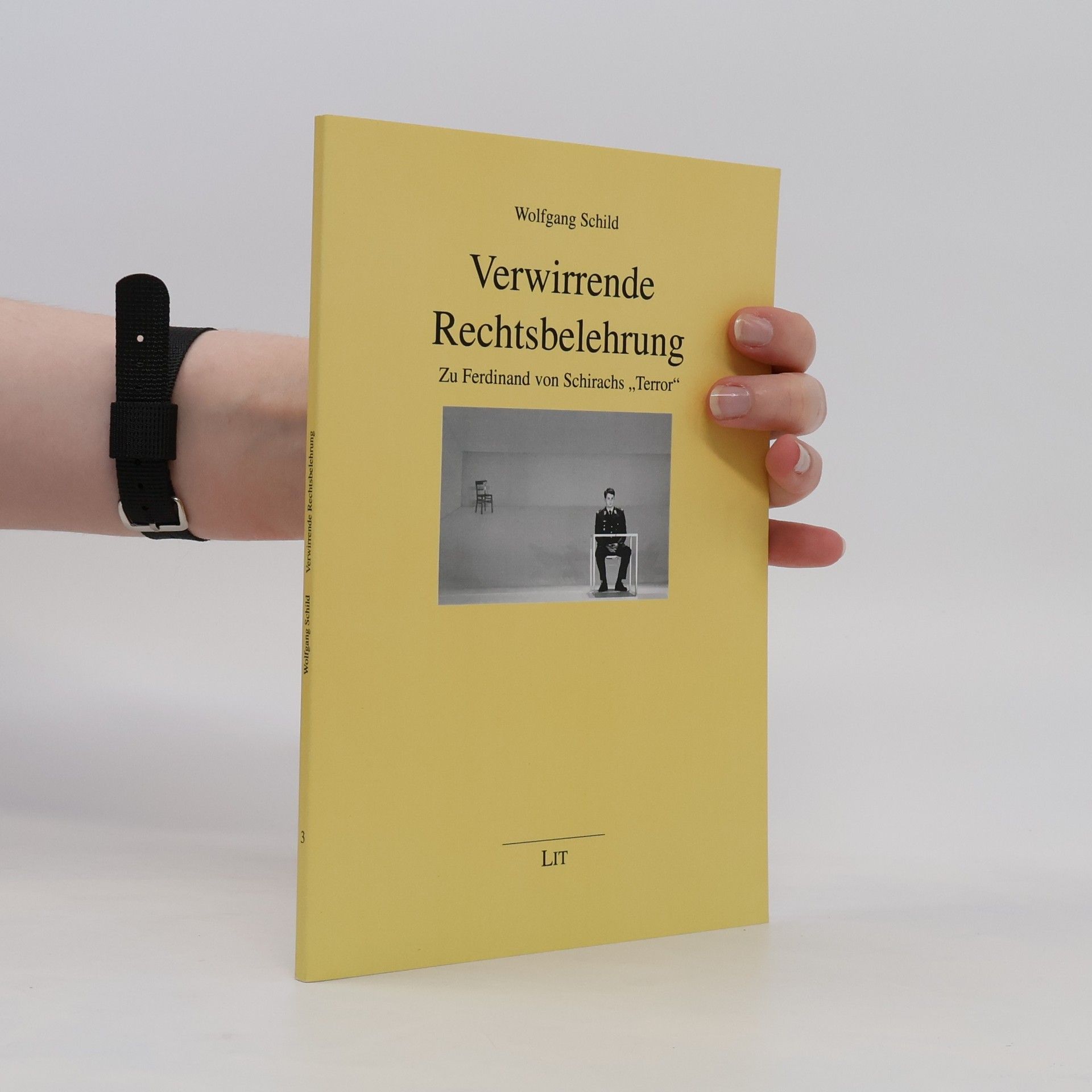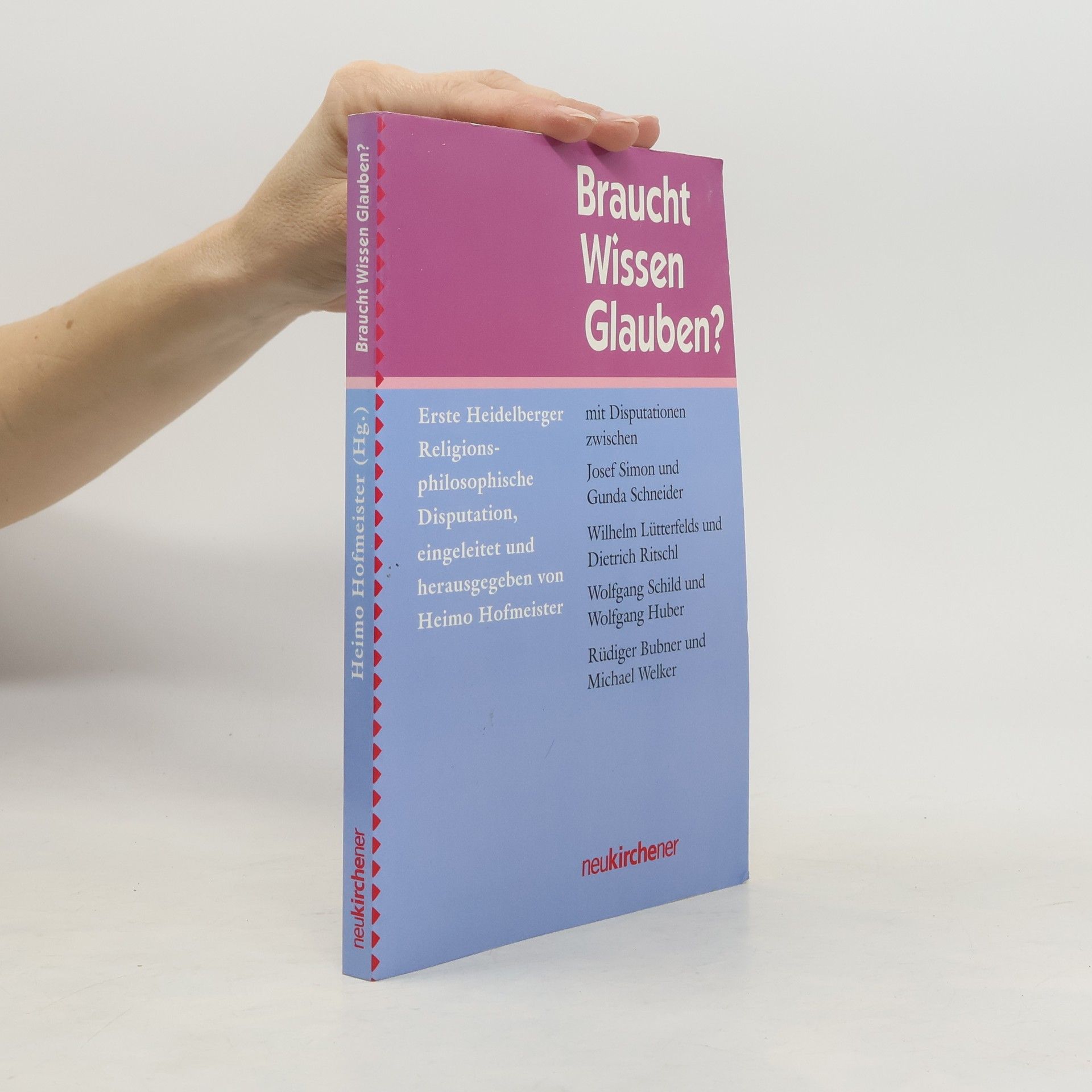Hegel-Versuche
Sechzehn Beiträge
In sechzehn Beiträgen versucht der Bielefelder Rechtsphilosoph Wolfgang Schild (geb. 1946), die Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770–1831) für heutige Fragen der Theorie von Staat und Recht aufzuarbeiten und weiterzudenken. So finden sich neben der Klärung des nicht-juristischen Begriffs des „Rechts“ (als „Dasein der Freiheit“) bei Hegel Ausführungen zu Person, Eigentum, Vertrag, Vergeltung und Strafe, Zurechnung, „Notrecht“, Gericht, Staat (und dessen Verhältnis zur Religion) und Weltstaat (im Zusammenhang mit dem Menschenrechtsethos). In zwei Beiträgen wird die Fortentwicklung der Thesen Hegels zur Monarchie und zu den Geschworenengerichten bei den Hegel-Schülern Eduard Gans (1797–1839) und Karl Ludwig Michelet (1801–1893) aufgezeigt. Ein Beitrag vergleicht das System Hegels mit den ästhetischen Ausführungen bei Richard Wagner (1813–1883). In einem geschichtsphilosophischen Beitrag wird schließlich Hegels Sicht auf Napoleon Bonaparte (1769–1821) dargestellt.