Anders als die klassische pädagogische Einzelberatung konzentriert sich die Pädagogische Organisationsberatung auf Strukturen und Konzepte in sozialen und pädagogischen Einrichtungen und Institutionen; neben der Analyse einer Organisationsstruktur richtet sich der Blick besonders auf die Organisationsdynamik, die sowohl von äußeren als auch von inneren Bedingungen und Gegebenheiten angeheizt wird. Die in dem vorliegenden Band publizierten Beiträge informieren sowohl über Methoden der Pädagogischen Organisationsberatung als auch über erste Versuche einer theoretischen Grundlegung. Gegenstand einer Organisationsberatung in sozialen und pädagogischen Handlungsfeldern kann beispielsweise die „Philosophie“ und/oder das Konzept einer Einrichtung sein. Eines der zentralen Anliegen der Pädagogischen Organisationsberatung ist die Qualitätsentwicklung in den pädagogischen und sozialen Institutionen. Von besonderem Interesse sind dabei die Leitungsstrukturen und -kompetenzen.
Ewald Johannes Brunner Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

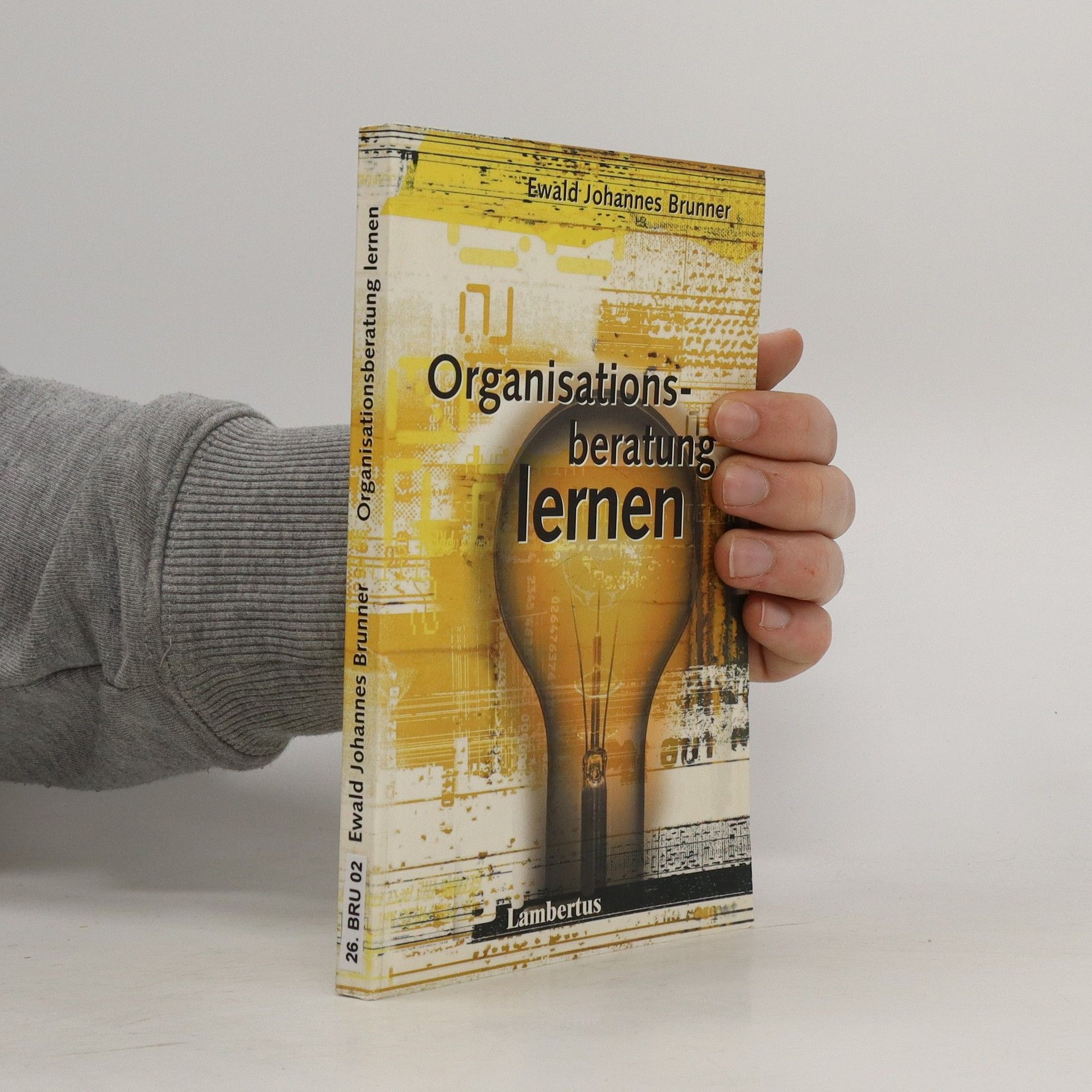

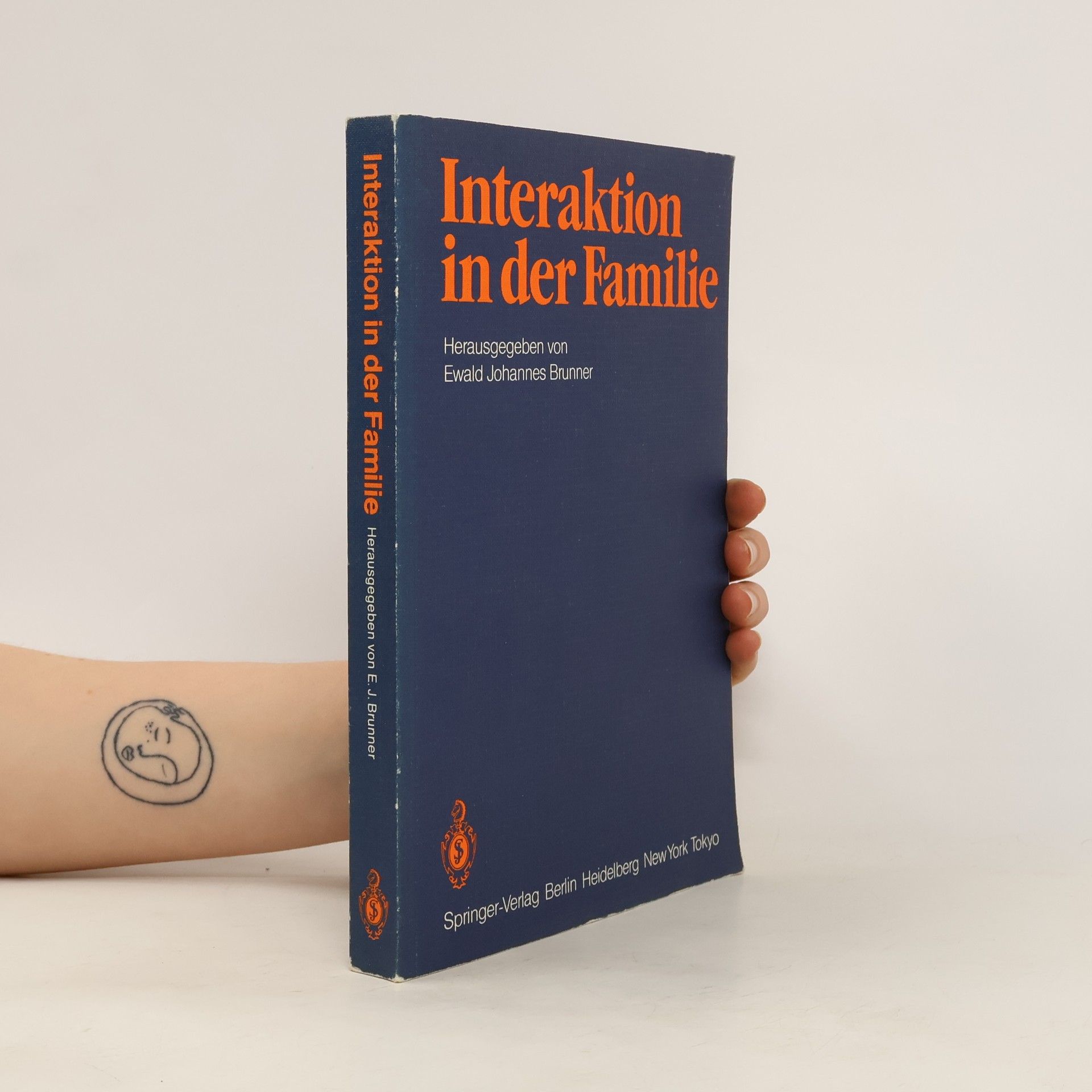
Organisationsberatung lernen
- 140 Seiten
- 5 Lesestunden
Organisationsberatung gewinnt auch für den Non-Profit-Bereich zunehmend an Bedeutung. Wie aber qualifiziert man sich dafür, pädagogische oder soziale Einrichtungen beraten zu können? Ewald Johannes Brunner setzt auf Professionalisierung und plädiert für eine fachbezogene Ausbildung, d. h., zur Organisationsberatung in pädagogischen oder sozialen Institutionen werden Erziehungswissenschaftler(innen) bzw. Sozialpädagog(inn)en qualifiziert. Als optimale Lernform preist der Autor das Projektstudium an, für das er als verantwortlicher Universitätsprofessor des postgradualen Studiengangs „Pädagogische Organisationsberatung“ an der Universität Jena Erfahrungen gesammelt und ausgewertet hat. Zum Verständnis von Veränderungsprozessen in pädagogischen und sozialen Einrichtungen propagiert der Autor einen systemischen Ansatz: die Synergetik, die Lehre vom Zusammenwirken.
Soziale Einrichtungen bewerten
- 262 Seiten
- 10 Lesestunden
Die Qualitätssicherung in sozialen Einrichtungen ist ein aktuelles Thema, das in der Fachwelt intensiv diskutiert wird. Es gibt Bedenken, ob wirtschaftliche Instrumente der Qualitätssicherung auf den sozialen Sektor übertragbar sind. In diesem Band wird diese Debatte aufgegriffen: Qualitätssicherung kann als Versuch der Ökonomisierung des Sozialen sinnvoll sein, bietet jedoch auch Chancen, um zukunftsweisende Modelle zur Bewältigung von Krisen im Sozialbereich zu entwickeln. Die Beiträge konzentrieren sich auf erprobte Methoden und Techniken der Qualitätssicherung in sozialen Einrichtungen. Methodologische Überlegungen zur „Messbarkeit“ sozialer Dienstleistungen werden diskutiert und anhand praktischer Beispiele veranschaulicht. Vertreter verschiedener Disziplinen, darunter Psychologen, Sozialpädagogen, Wirtschaftspädagogen, Mediziner und Betriebswirte, kommen zu Wort. Zudem äußert sich eine Vertreterin eines Zertifizierungsunternehmens konstruktiv-kritisch zu den Möglichkeiten und Grenzen der Zertifizierung sozialer Einrichtungen. Die Mitwirkenden sind unter anderem Prof. Dr. Ewald Johannes Brunner, Dipl.-Päd. Petra Bauer und Susanne Volkmar M. A., die alle an der Universität Jena tätig sind.
Interaktion in der Familie
- 336 Seiten
- 12 Lesestunden
Unter Mitarbeit zahlreicher Fachwissenschaftler