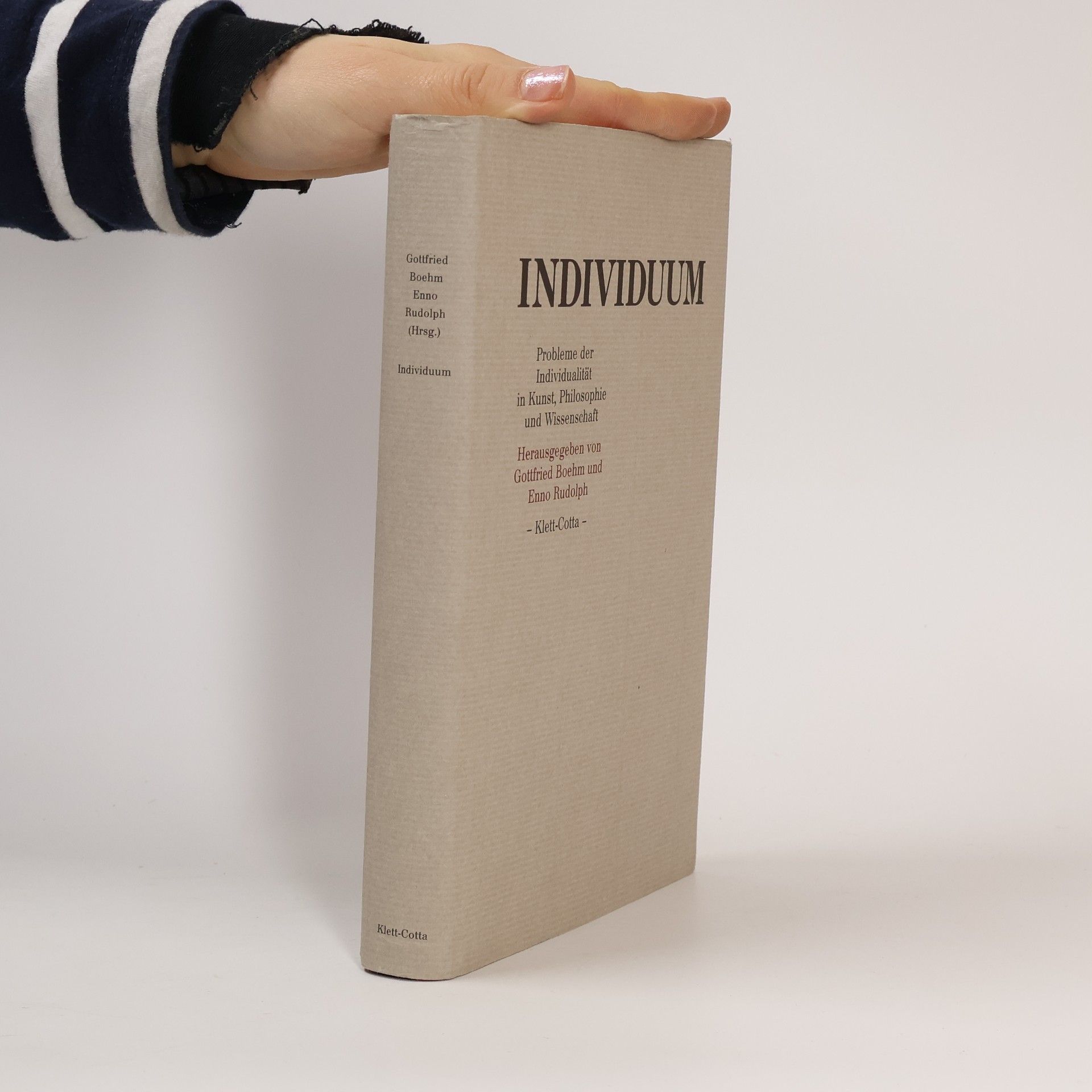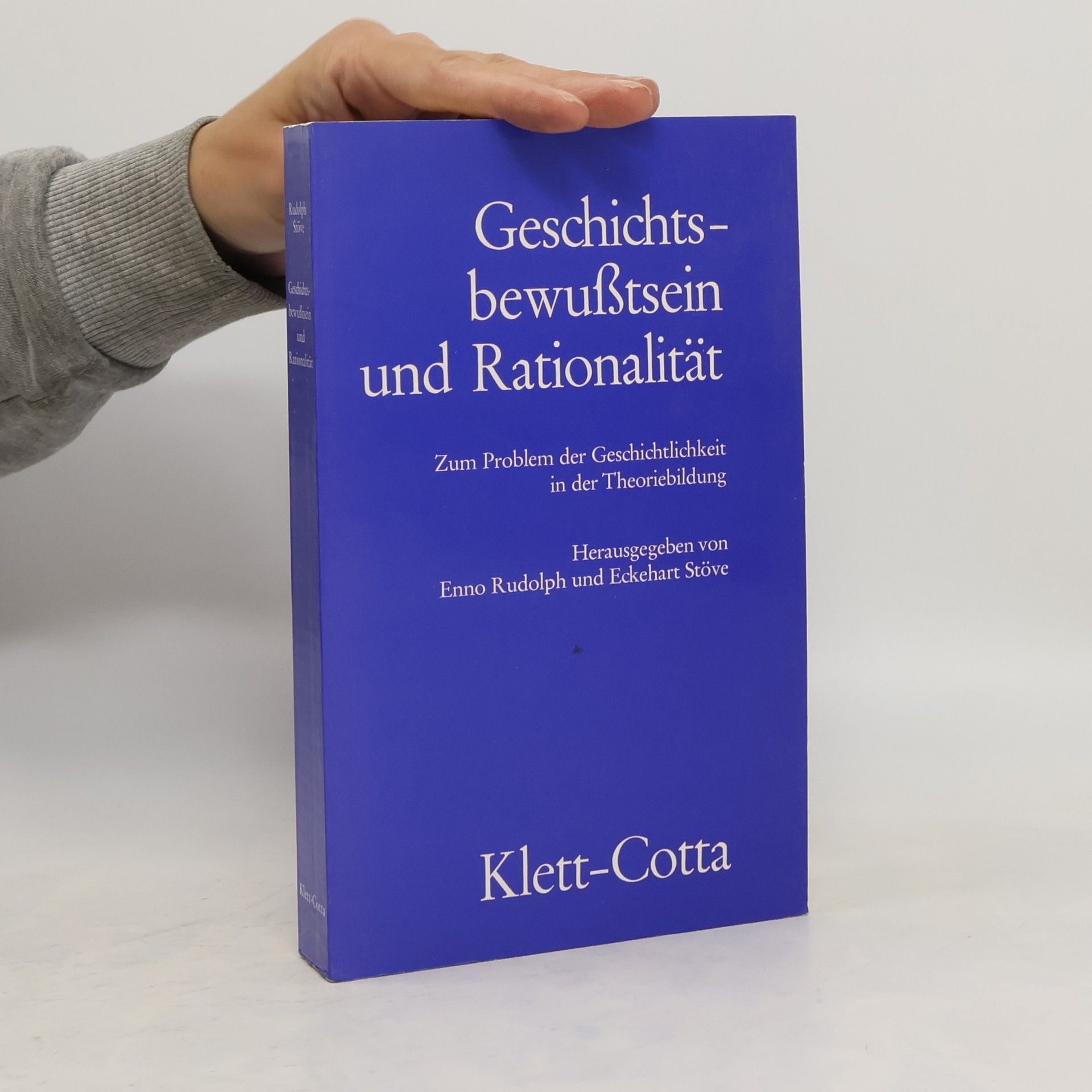Philosophie im 20. Jahrhundert
- 320 Seiten
- 12 Lesestunden
Die Philosophie des 20. Jahrhunderts verdankt sich ganz wesentlich den Impulsen, die von der Philosophie Friedrich Nietzsches (1844 - 1900) ausgegangen sind. Er war es, der die für das 19. Jahrhundert charakteristische Kritik an den Ansprüchen philosophischer Megasysteme, den Verlauf der gesamten Menschheitsgeschichte in einen systematischen Zusammenhang zu stellen, erfolgreich auf einen Höhepunkt trieb. Wie nachhaltig sein Wirken war, zeigt sich nicht nur in so unterschiedlichen Werkkomplexen wie denen von Martin Heidegger oder Michel Foucault, sondern auch an den aufklärungskritischen Intentionen der Frankfurter Schule. Die Schule der Hermeneutik, der Neoaristotelismus, der Neohegelianismus, der Existentialismus in Frankreich, die politische Philosophie und Sozialphilosophie, repräsentiert durch Jürgen Habermas, John Rawls, Charles Taylor u. a.: diese nach 1945 neu entstandenen Diskurse sind mit dem 20. Jahrhundert keineswegs zu Ende gegangen, sondern wurden mit durchaus bedeutenden Aussichten auf Nachwirkung in das 21. Jahrhundert transportiert.