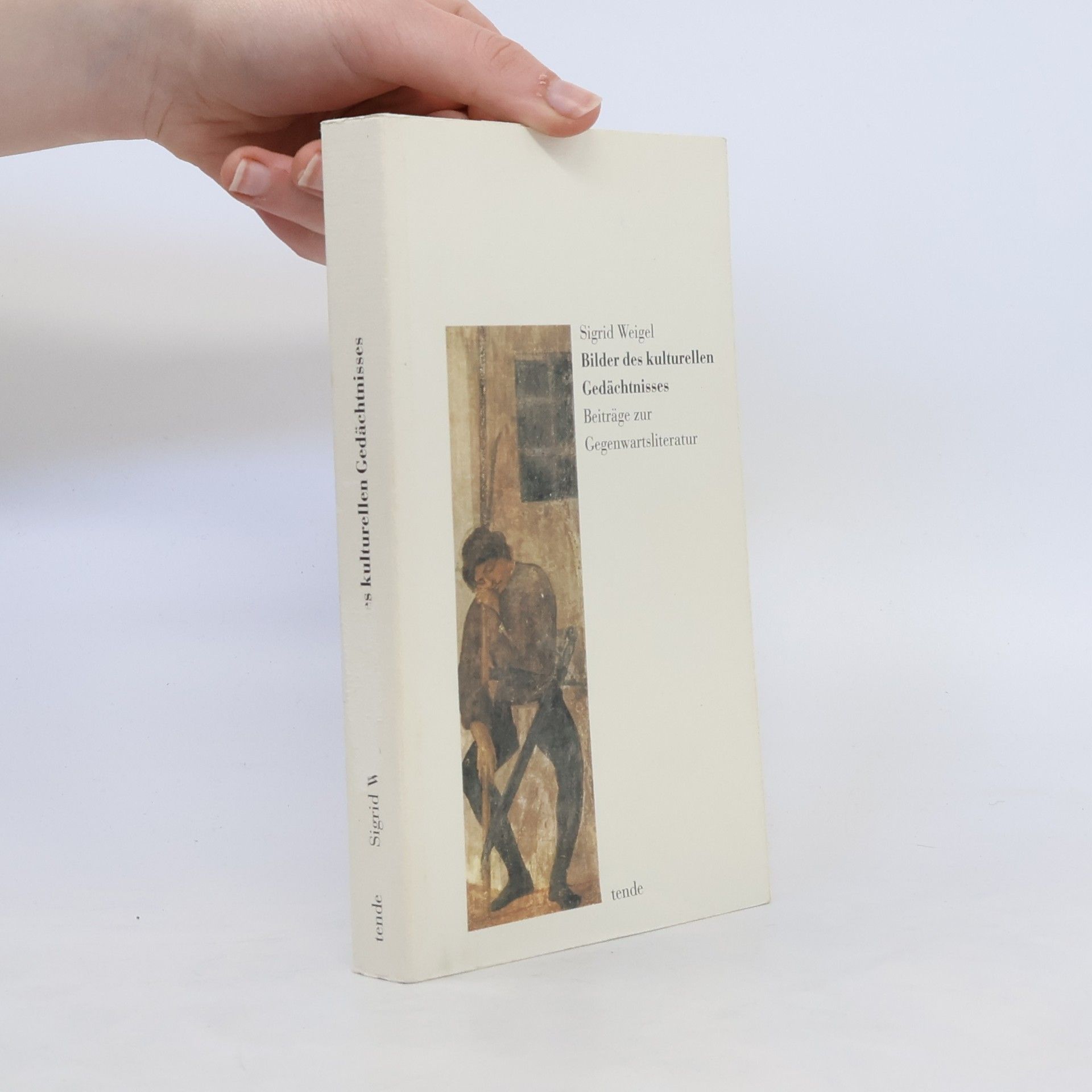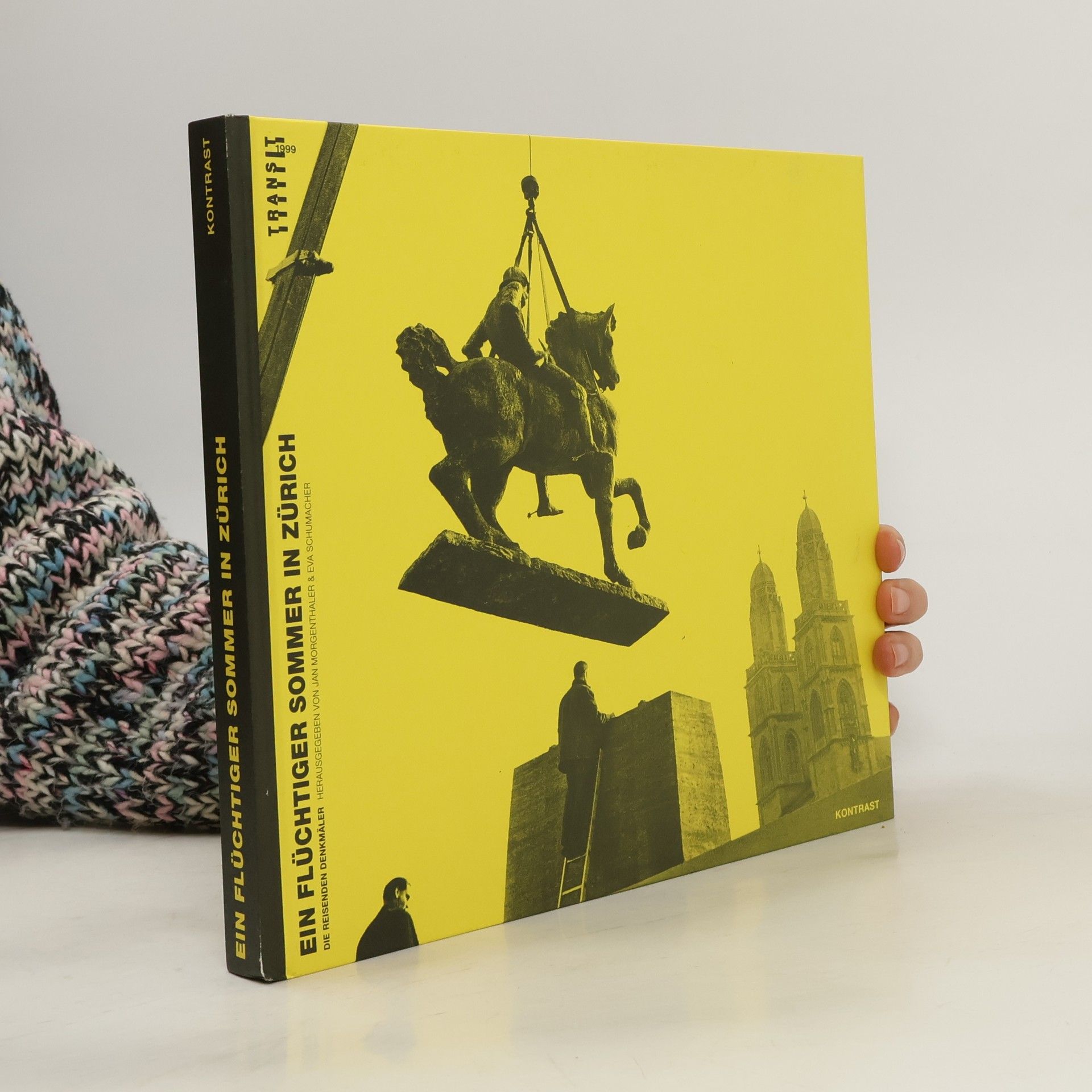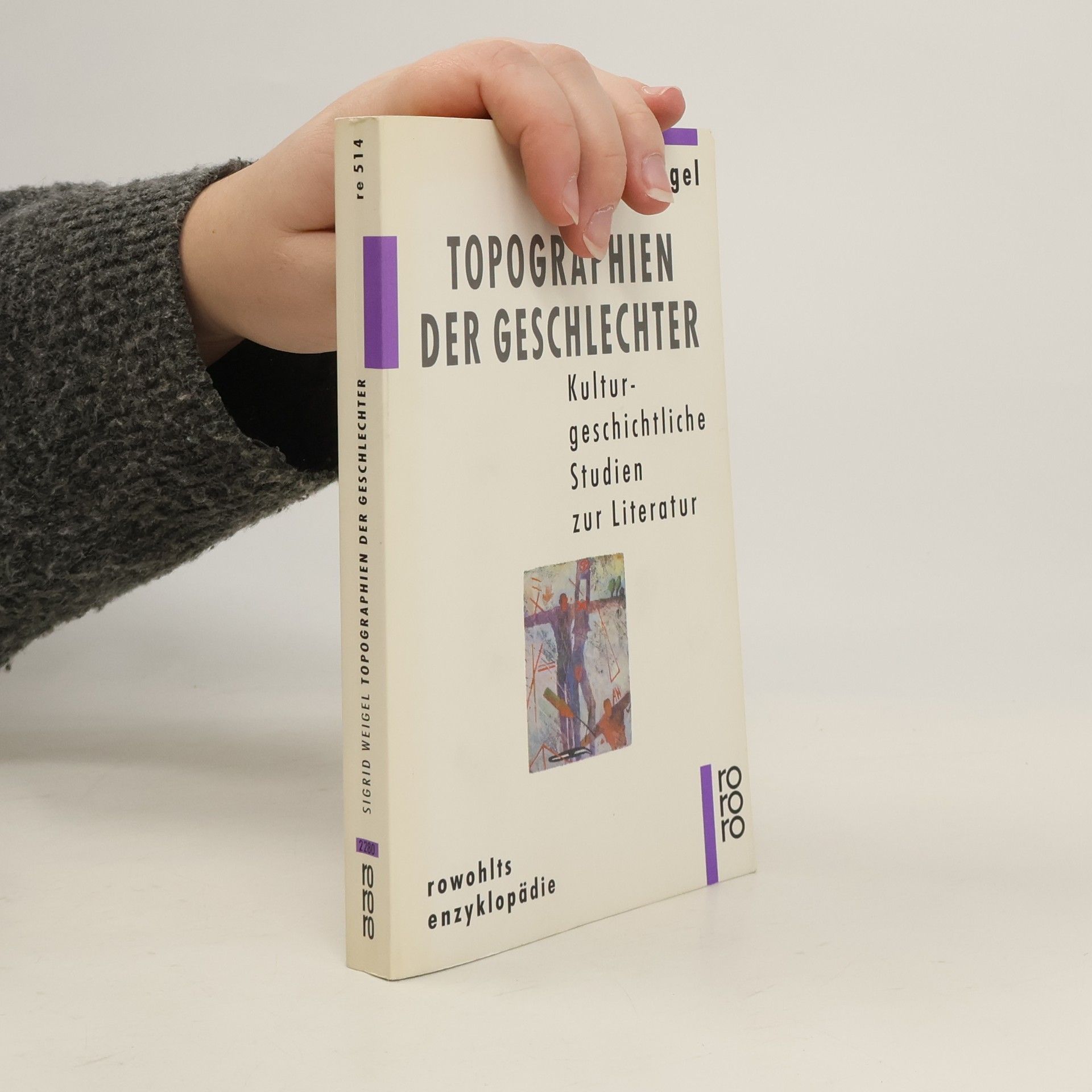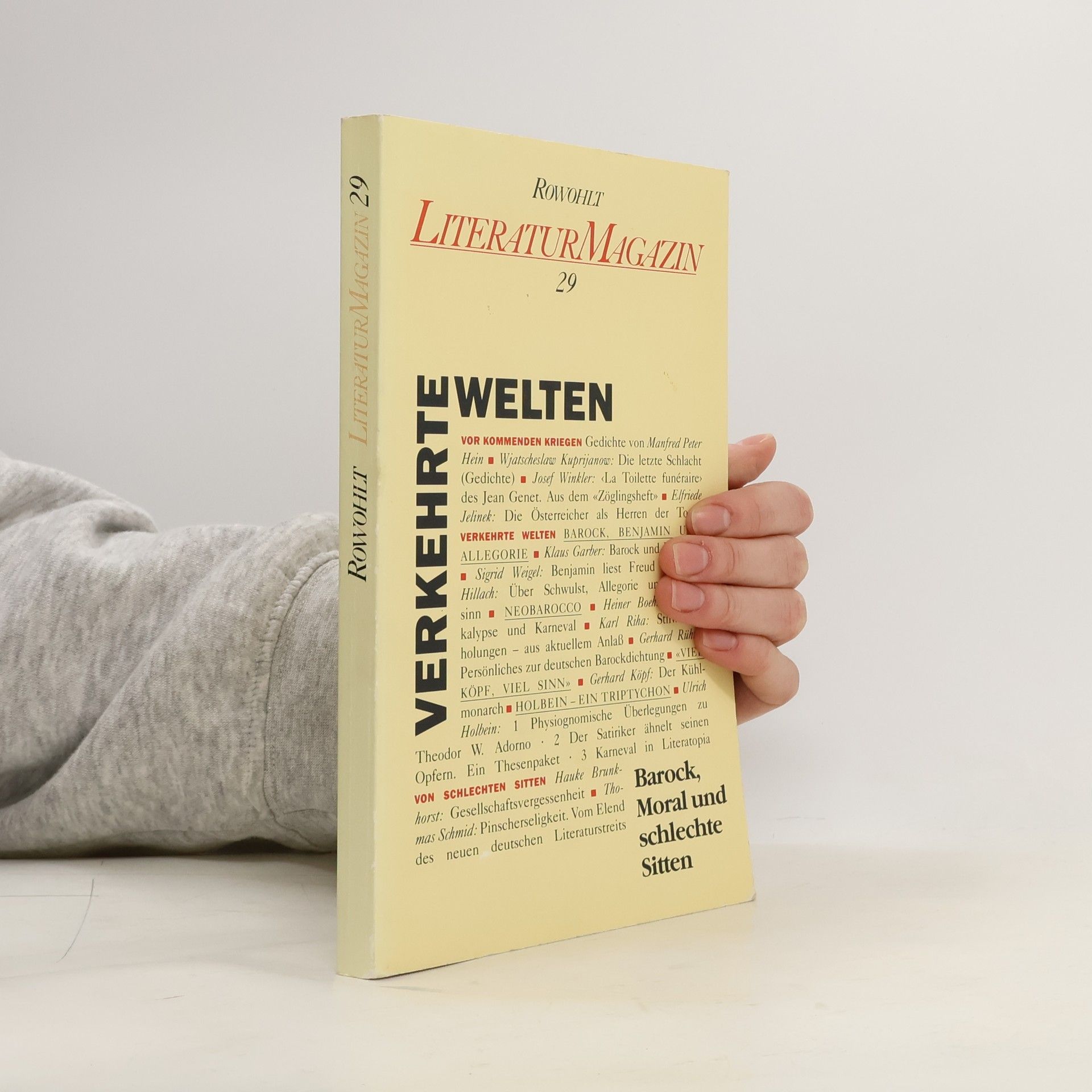»Ein ganz neues Bild von Ingeborg Bachmann« Die Weltwoche »Abstand, oder ich morde! Haltet Abstand von mir!« ruft der Erzähler in Ingeborg Bachmanns Werk ›Das dreißigste Jahr‹. Und diesen Abstand verlangte die Dichterin auch für sich, was zu vielerlei Spekulationen über ihre Person und ihr Schaffen führte. Die renommierte Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel legt hier die erste Gesamtdarstellung jenseits von Mythen und Legenden vor. Sie stützt sich dabei nicht nur auf den zugänglichen Teil des Nachlasses, sondern auch auf Briefe und Notizen in den Nachlässen von Hannah Arendt, Peter Szondi, Wolfgang Hildesheimer und anderen. So wird Ingeborg Bachmann inmitten eines Netzes aus Beziehungen und Korrespondenzen sichtbar, die ein neues und überraschendes Licht auf ihr Leben und Werk werfen.
Sigrid Weigel Bücher
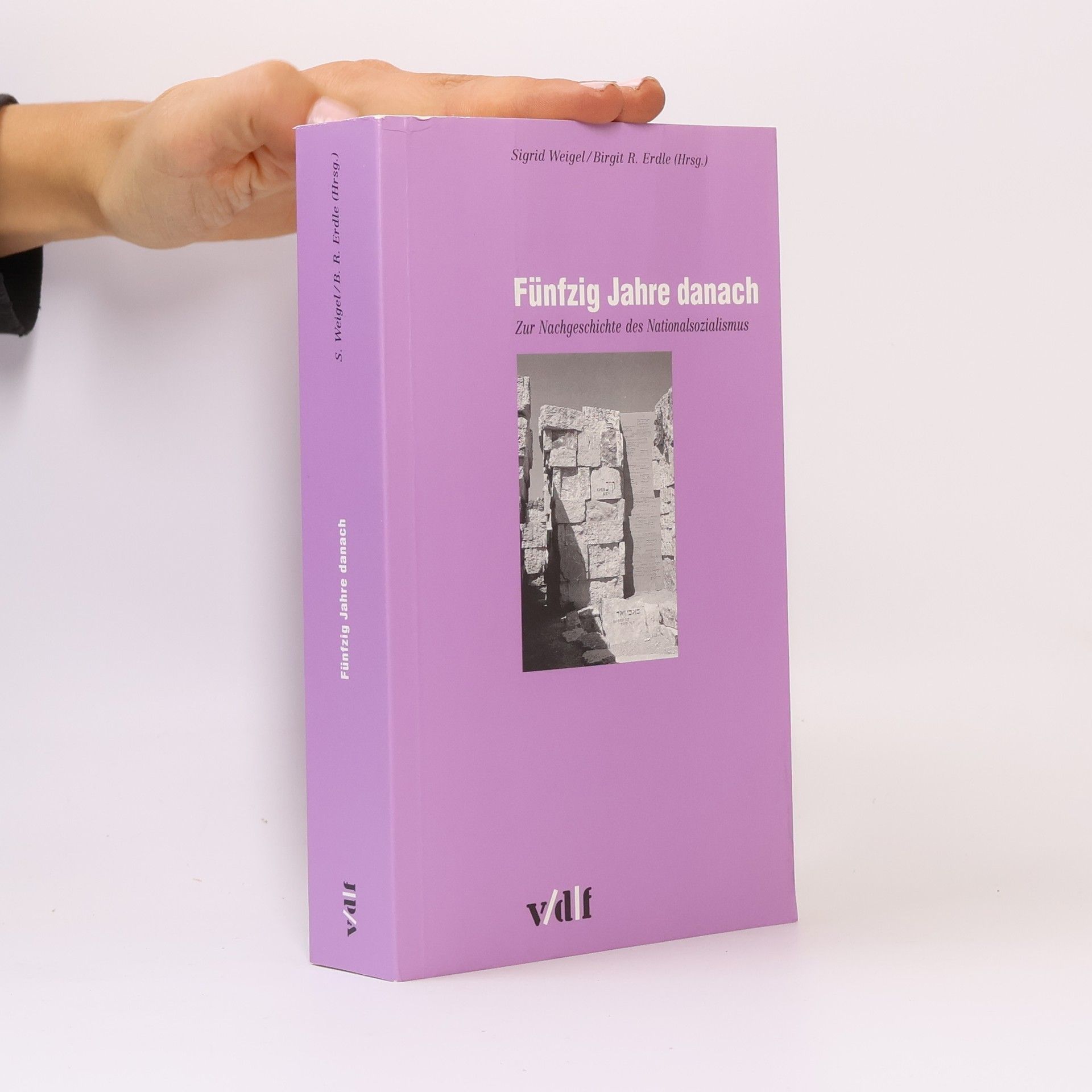
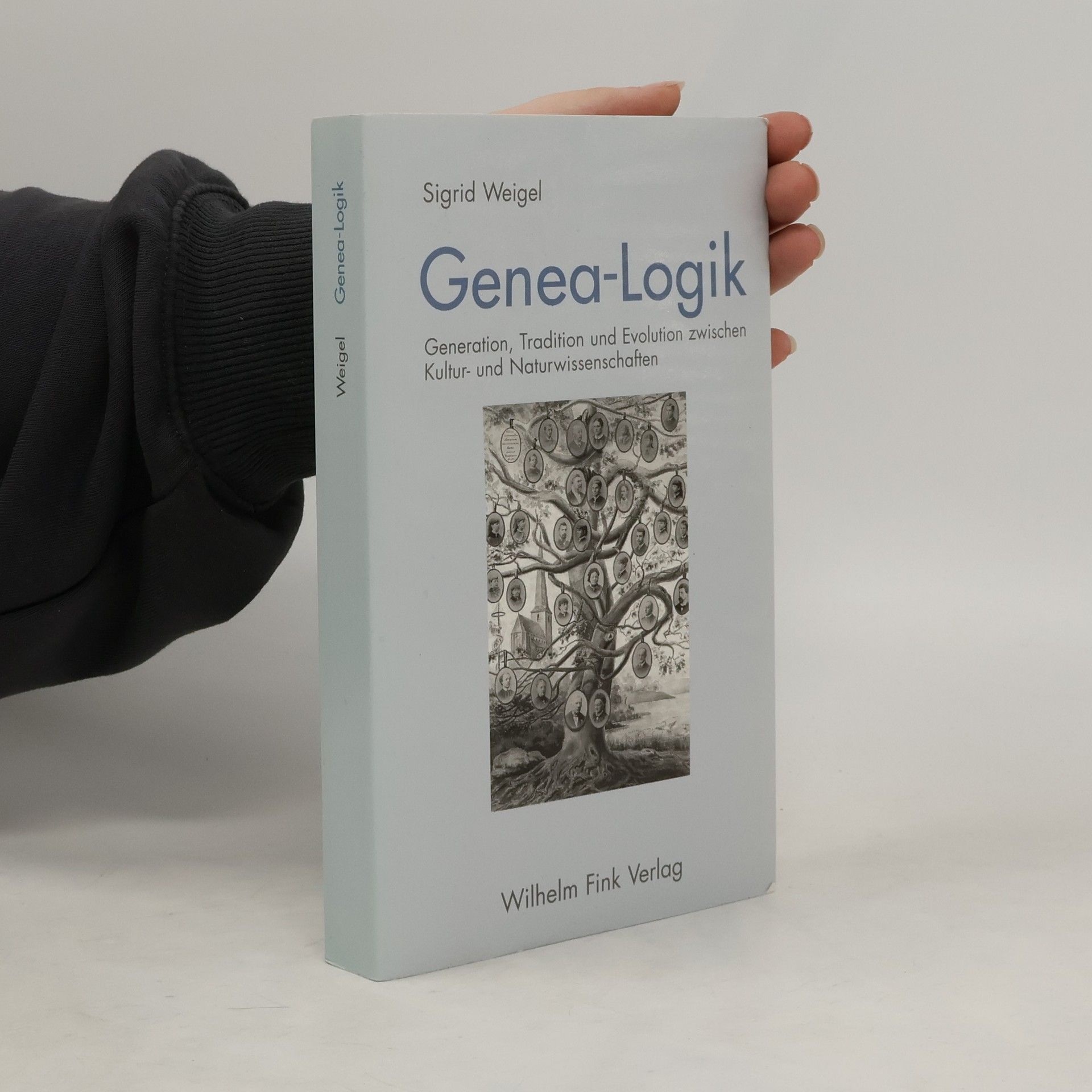

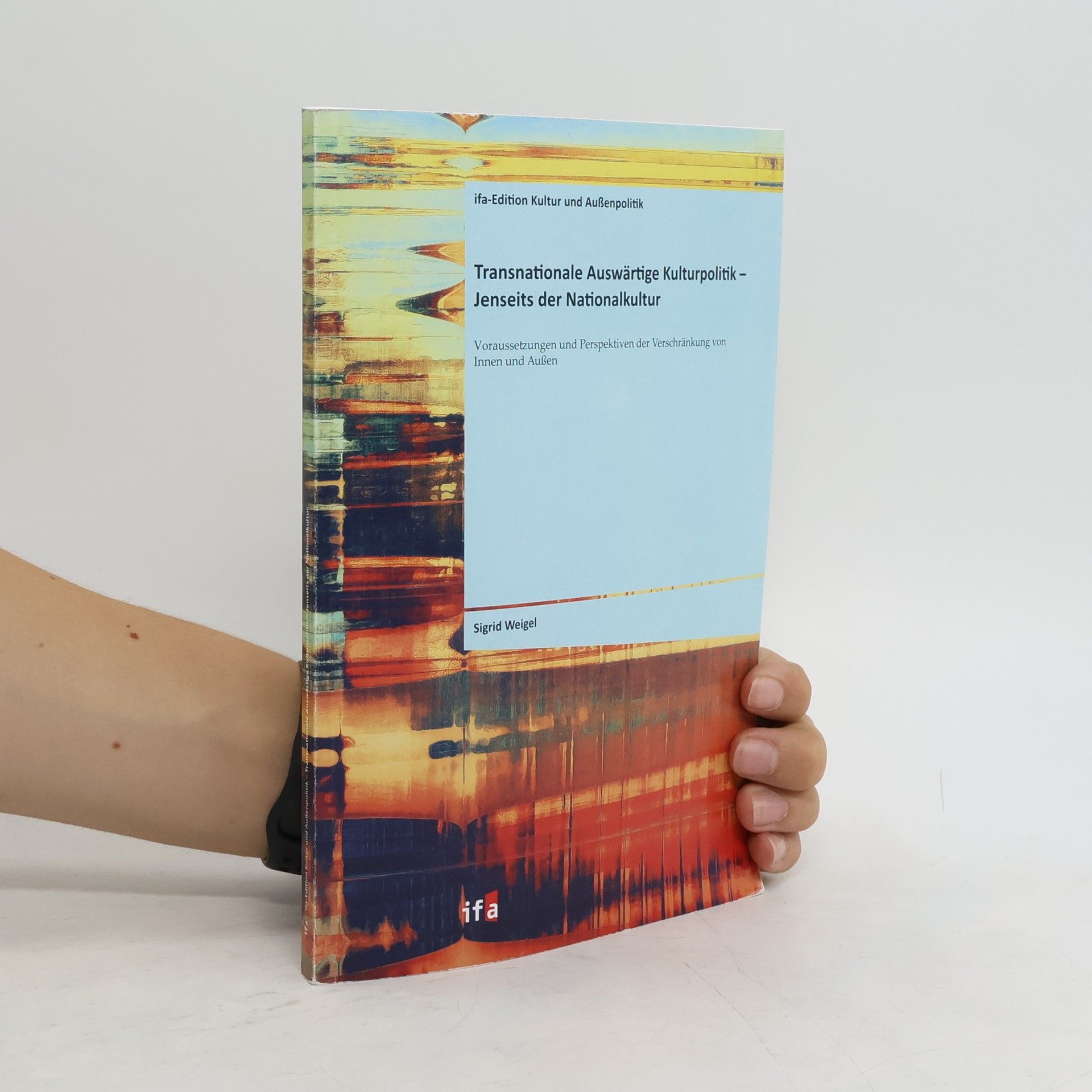

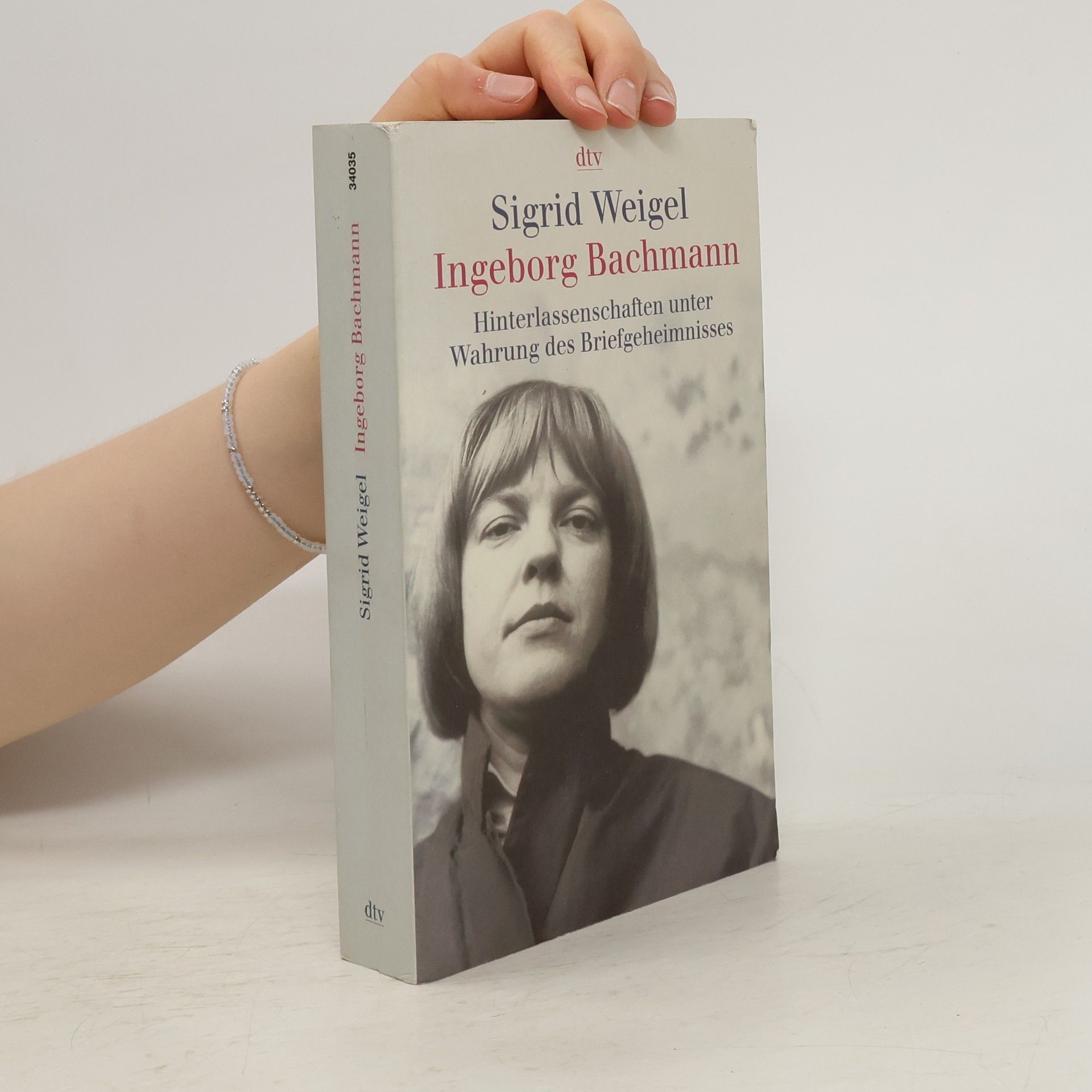
Die Stimme der Medusa
- 379 Seiten
- 14 Lesestunden
German
Transnationale auswärtige Kulturpolitik - jenseits der Nationalkultur
Voraussetzungen und Perspektiven der Verschränkung von Innen und Außen
Die Frage nach einer zukunftsfähigen Gestaltung der Auswärtigen Kulturpolitik (AKP) wird gerade in Zeiten der Globalisierung und wieder aufkeimender Nationalismen immer dringlicher. Um eine Neugestaltung vornehmen zu können, ist es künftig notwendiger denn je, Ansätze zu entwickeln, die ganzheitlich europäisch orientiert sind und sich von der bisherigen nationalstaatlich orientierten Herangehensweise entfernen. Die vorliegende Studie befasst sich eingehend mit der Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten des Handlungsfelds und plädiert für eine transnationale Stärkung der Auswärtigen Kulturpolitik. Dabei werden konkrete Ansätze zur Neuausrichtung einer nachhaltigen AKP und kulturpolitische Voraussetzungen zur Erstellung innovativer Kulturkonzepte entwickelt und auf ihre Zukunftstauglichkeit eingehend überprüft. Außerdem wird eine detaillierte Analyse der bisherigen Entwicklung und Ausrichtung der AKP vorgenommen und die Schwierigkeit des Dauerspagats beleuchtet, in dem sich die Auswärtige Kulturpolitik durchgängig befindet - sei es in Form organisatorischer Balanceakte zwischen Bund und Ländern oder inhaltlicher Zwiespalte wie innerer und auswärtiger Kulturpolitik. (ifa)
Grammatologie der Bilder
- 220 Seiten
- 8 Lesestunden
Das Buch der bekannten Literaturwissenschaftlerin untersucht die Formen des Bildertausches zwischen Wissenschaft, Religion, Kunst und Literatur. Jenseits der Kontroverse zwischen pictorial und linguistic turn geht es um das Wissen der Bilder an der Grenze zwischen Messen und Deuten: an der Schwelle zwischen Spur und Zeichen, Imaginärem und Sichtbarem, Material und Figur, Schauplatz und Erzählung, Daten und Graphik/Begriff. Momente des In-Erscheinung-Tretens stehen im Zentrum: von Bildern im Denken, von Affekten im Gesicht, von Transzendenz in Gemälden oder in der Dichtung. Ausgehend von der Differenz zwischen neuronalen Indikatoren und Semantik in den bildgebenden Verfahren der aktuellen naturwissenschaftlichen Forschung, widmet sich Sigrid Weigel vor allem dem Wissen, das Malerei und Einbildungskraft über Bilder bereithalten. Ziel ist es, durch die Aufmerksamkeit für das Detail und für das „Unbedeutende“ dem „Geist wahrer Philologie“ (Benjamin) zum Ausdruck zu verhelfen.
Genea-Logik
- 288 Seiten
- 11 Lesestunden
Die Konzepte und Praktiken des Erbes geben darüber Auskunft, in welcher Weise die Lebenden mit den vorausgegangenen und kommenden Generationen verbunden sind: durch Schrift oder Leib, Familie oder Gedächtnis, Hinterlassenschaften oder Gene. Dabei ist die kulturelle Überlieferung nicht unabhängig davon, ob sie im Zeichen von Tradition, Evolution oder etwa Genetik gedacht wird. Genea-Logik, die Rede über Überlieferung und Erbe, verbindet Literatur, Kunst, Philosophie und Wissenschaft. Etliche Begriffe – wie Generation, Gattung, Geschlecht – und viele Wissensfiguren und Narrative – wie Stammbaum, Entwicklungsmodell, Familienroman und Verwandtschaft – kommunizieren zwischen den „zwei Kulturen“ und belegen eher deren Nähe und Austausch als den vielbeschworenen Science War. Welche konkreten Vorstellungen von Überlieferung mit diesen Figuren hervorgebracht werden, das zeigt sich im Detail der Bilder und Konzepte. Indem sie zentrale Linien und Umbrüche des genealogischen Wissens in Literatur und Wissenschaftsgeschichte verfolgt, untersucht Sigrid Weigel deren manchmal unheimliche Bedeutungsstrukturen: die Tendenz zur Angleichung kultureller Prozesse an das Reproduktionsgeschehen, die Rolle familialer Metaphern, die Spannung zwischen genealogischen und klassifikatorischen Operationen und die Nähe genealogischer Vorstellungen zur Konstruktion von Einheiten: von der Generation über die Gattung bis zur Nation.
Bilder des kulturellen Gedächtnisses
- 280 Seiten
- 10 Lesestunden
Transit: Ein flüchtiger Sommer in Zürich
- 167 Seiten
- 6 Lesestunden
German