Der leidenschaftliche Sammler August der Starke, der die Königliche Porzellansammlung um 1715 gründete, hatte den kühnen Plan, die einzigartigen Stücke in dem eigens dafür umgebauten Japanischen Palais zu präsentieren. Der Plan blieb nach dem Tod des Königs 1733 unvollendet. Heute lässt sich in der historischen Kulisse des Zwingers die ganze Pracht der unvergleichlich kostbaren Porzellane aus Meißen, China und Japan erleben. Das Buch präsentiert die bedeutendsten Meisterwerke der etwa 20 000 Stücke umfassenden Sammlung. Die Porzellane umfassen die zeitgenössische Produktion der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Meißen, chinesisches Porzellan der Kangxi-Ära (1662–1722) sowie japanische Imari- und Kakiemon-Porzellane des 17. und frühen 18. Jahrhunderts.
Ulrich Pietsch Bücher



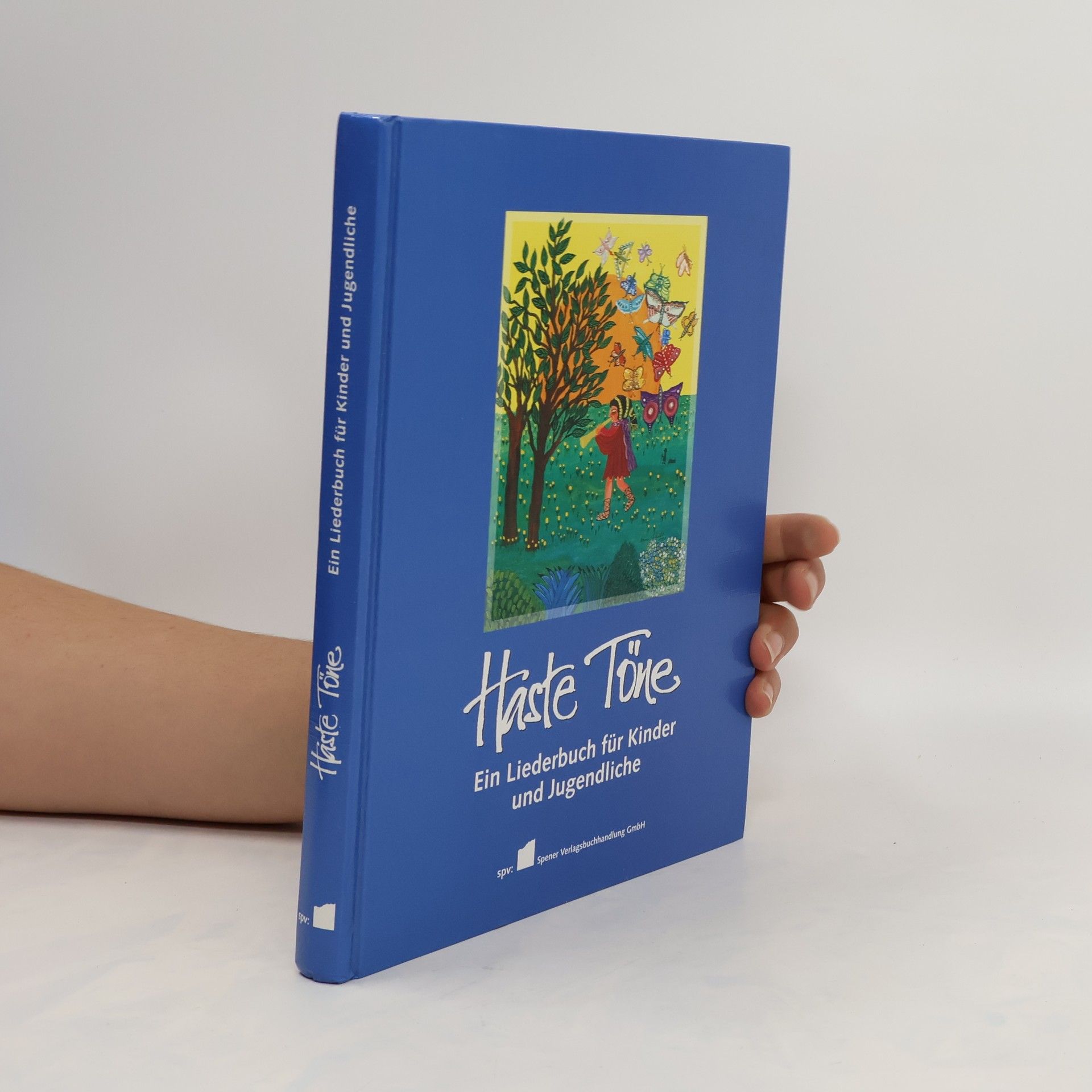

Zu Ehren des 300-jährigen Bestehens der Porzellan-Manufaktur Meissen präsentierte die Stadt Berlin 2010 eine Ausstellung im Ephraim-Palais. Der begleitende Katalog beleuchtet die Vorbildwirkung dieser Manufaktur und stellt chronologisch die rund 50 auf Meißen folgenden Manufakturgründungen in Europa vor: Sèvres, Wien, St. Petersburg, Berlin, Frankenthal, Nymphenburg und weiteren Orten. Über 400 Abbildungen zeigen unter anderem das höfisch-elegante französische Porzellan, das 'weiche' englische, das vielfältige deutsche und das italienische mit seinen kräftigen Farben.
Ein erstaunlich kurzweilig zu lesendes Werk, das den ersten Band der Bestandskataloge der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden – Porzellansammlung präsentiert. Dieser Katalog umfasst die figürlichen Werke von Gottlieb Kirchner und Johann Joachim Kaendler, deren Modelle stilbildend für die europäischen Manufakturen wurden. Unter der Leitung von Ulrich Pietsch und Daniela Antonin wird der Dresdner Figurenbestand umfassend verzeichnet, kommentiert und illustriert. Die Sammlung beherbergt über 300 herausragende figürliche Einzelwerke dieser beiden bedeutenden Bildhauer. Anlässlich des 300. Geburtstags der Meißner Porzellanmodelleure erscheint dieser Katalog, der sich ausschließlich ihrem Schaffen widmet. Kirchner und Kaendler gelten als Begründer der europäischen Porzellanplastik, wobei großformatige Tierplastiken eine herausragende Rolle in ihrem Werk spielen. Diese wurden von August dem Starken für sein Porzellanschloss, das 'Japanische Palais', in Auftrag gegeben. Kaendler entwarf zudem monumentale Werke, darunter ein überlebensgroßes Reiterdenkmal für König August III. von Polen. Mit diesem Katalog beginnt die Veröffentlichung des Gesamtbestandes der Dresdner Porzellansammlung, die zu den bedeutendsten Sammlungen von Meißner Porzellans des 18. Jahrhunderts sowie chinesischem und japanischem Porzellan gehört. Der Katalog schließt eine Lücke in der Meissen-Literatur und setzt einen Maßstab für zukünftige Bestandskataloge.