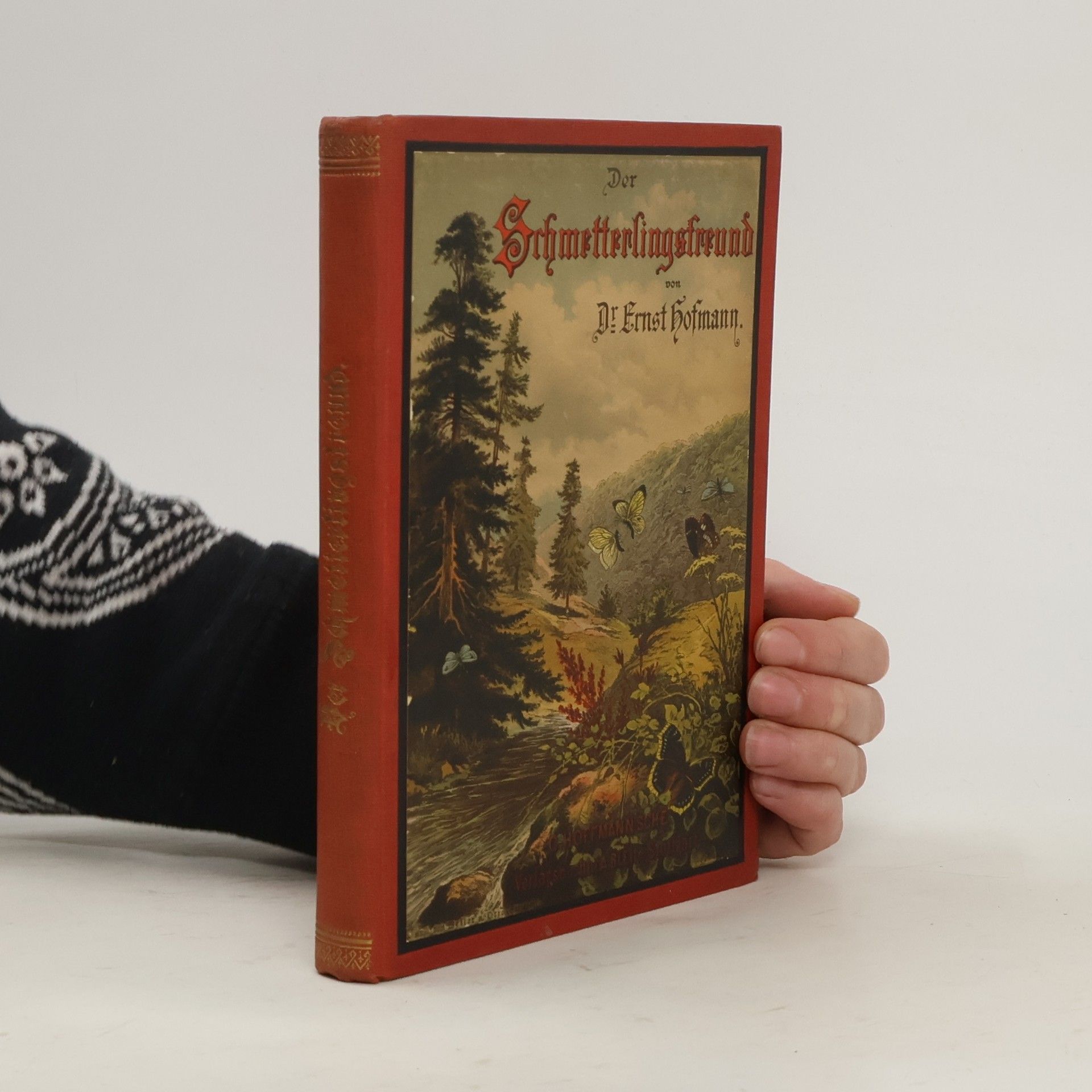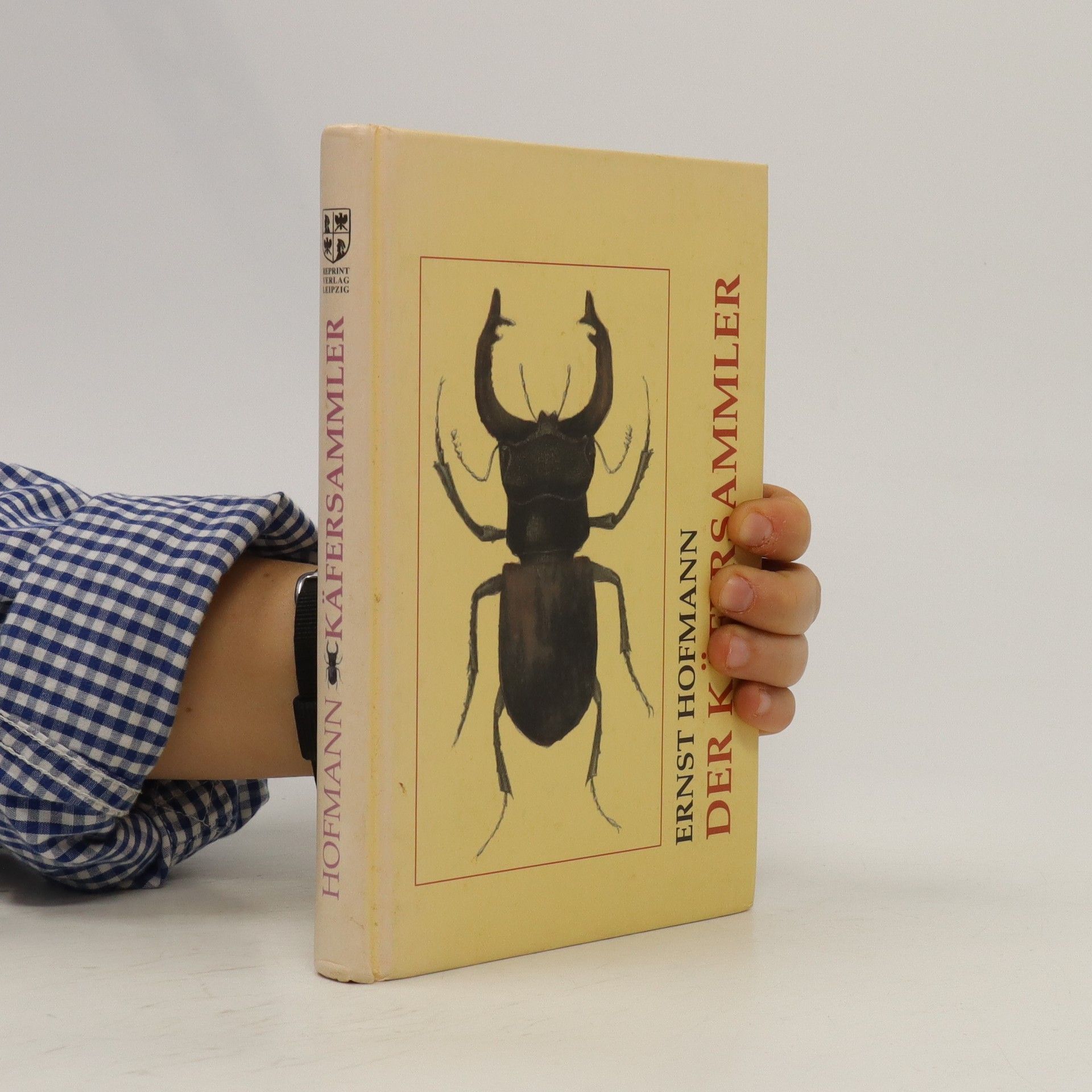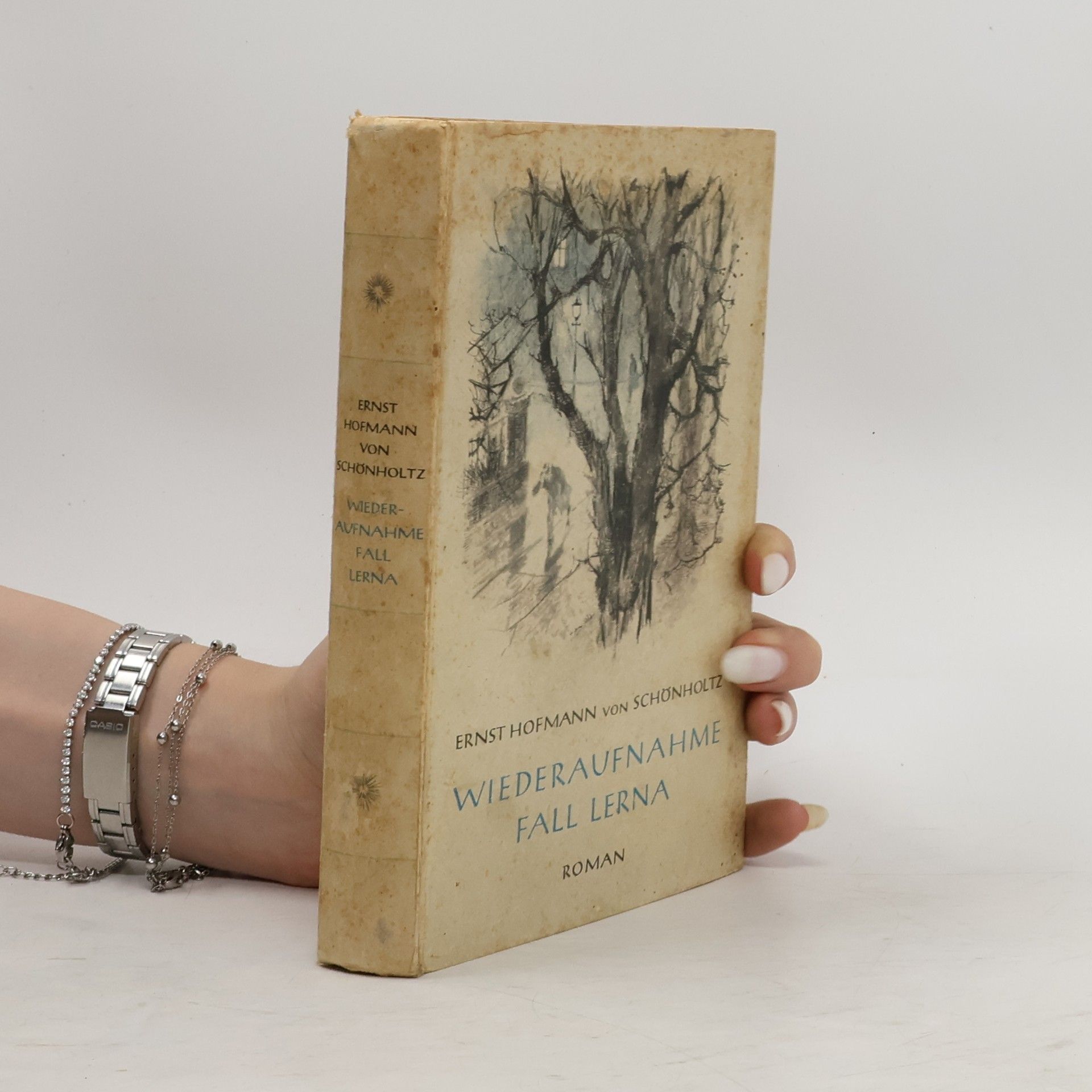Zünikon
- 448 Seiten
- 16 Lesestunden
Die Geschichte Zünikons beginnt mit seiner Ersterwähnung als Vogteimitglied im Jahr 1263, wobei die Wurzeln bis in die Alemannenzeit im 7. Jahrhundert zurückreichen. Über Jahrhunderte war Zünikon ein dreifaches Klosterdorf, dessen Grund und Boden den Benediktinern in St. Gallen, den Dominikanerinnen zu Töss und den Augustinerchorherren von Kreuzlingen gehörten. Die weltliche Ordnung lag in den Händen der Vögte, zuletzt des Grafen von Kyburg und später der Stadt Zürich. Die Dorfgemeinde Zünikon regelte ihre Angelegenheiten weitgehend autonom. Im frühen 20. Jahrhundert wurde die Zivilgemeinde aufgelöst, und das Dorf entwickelte sich innerhalb der politischen Gemeinde Bertschikon. Das Dorfleben war eng mit der Nachbarschaft verbunden, besonders mit Elgg, wo wichtige religiöse und soziale Funktionen stattfanden. Die Bevölkerung lebte lange von der Landwirtschaft, bis in den 1830er Jahren die Bauern sich vom Zehnten loskauften und kurzzeitig unternehmerische Freiheit genossen. Bald darauf wurden sie jedoch auf Bundessubventionen angewiesen, und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wandelte sich das Bauerndorf zum Pendlerdorf. Der Abschluss der Dorfgeschichte widmet sich den heute lebenden Familien und ihren Häusern, ergänzt durch ein Kapitel über die Schule Zünikon und Tabellen zur Baugeschichte und den Hausbesitzern von der Helvetik bis heute.