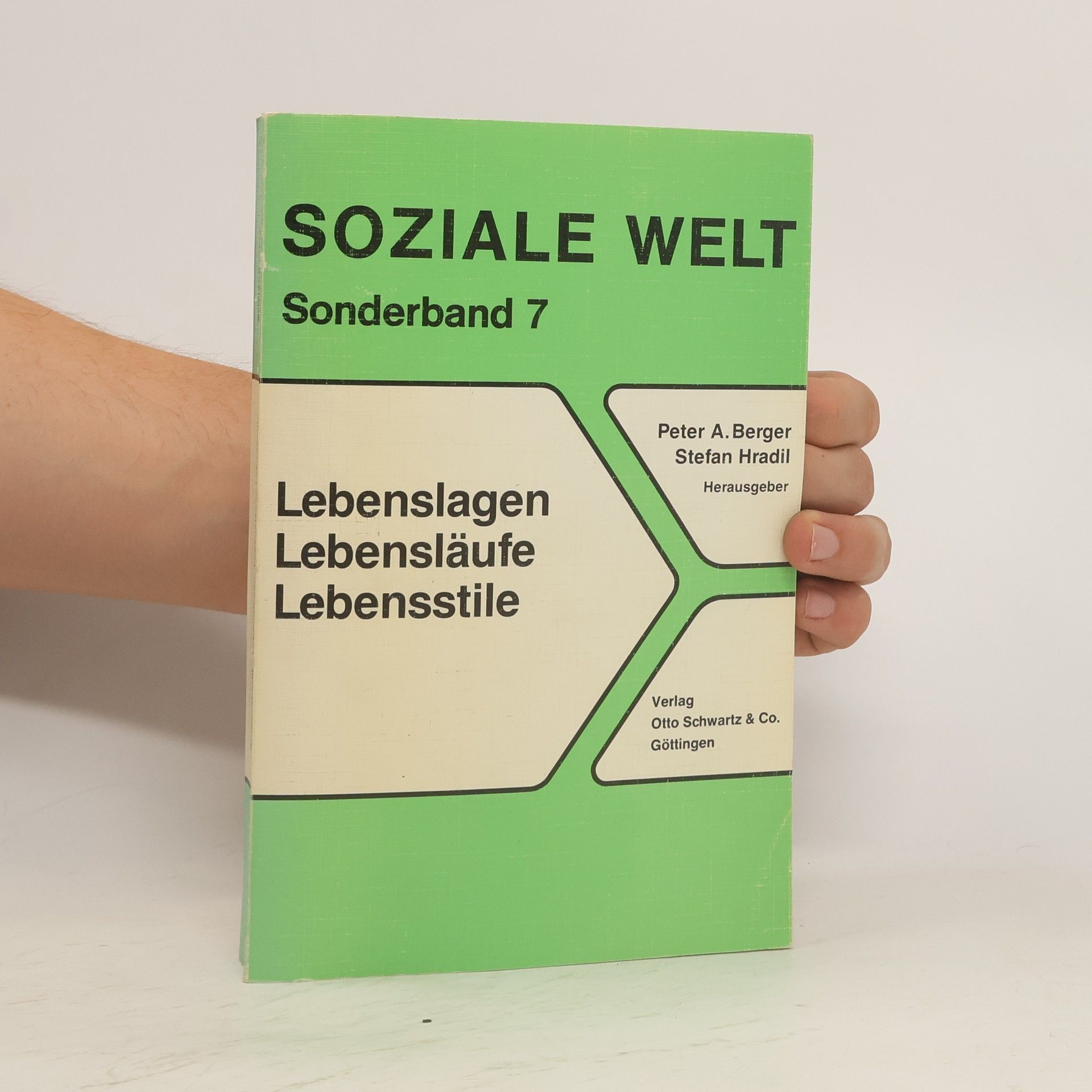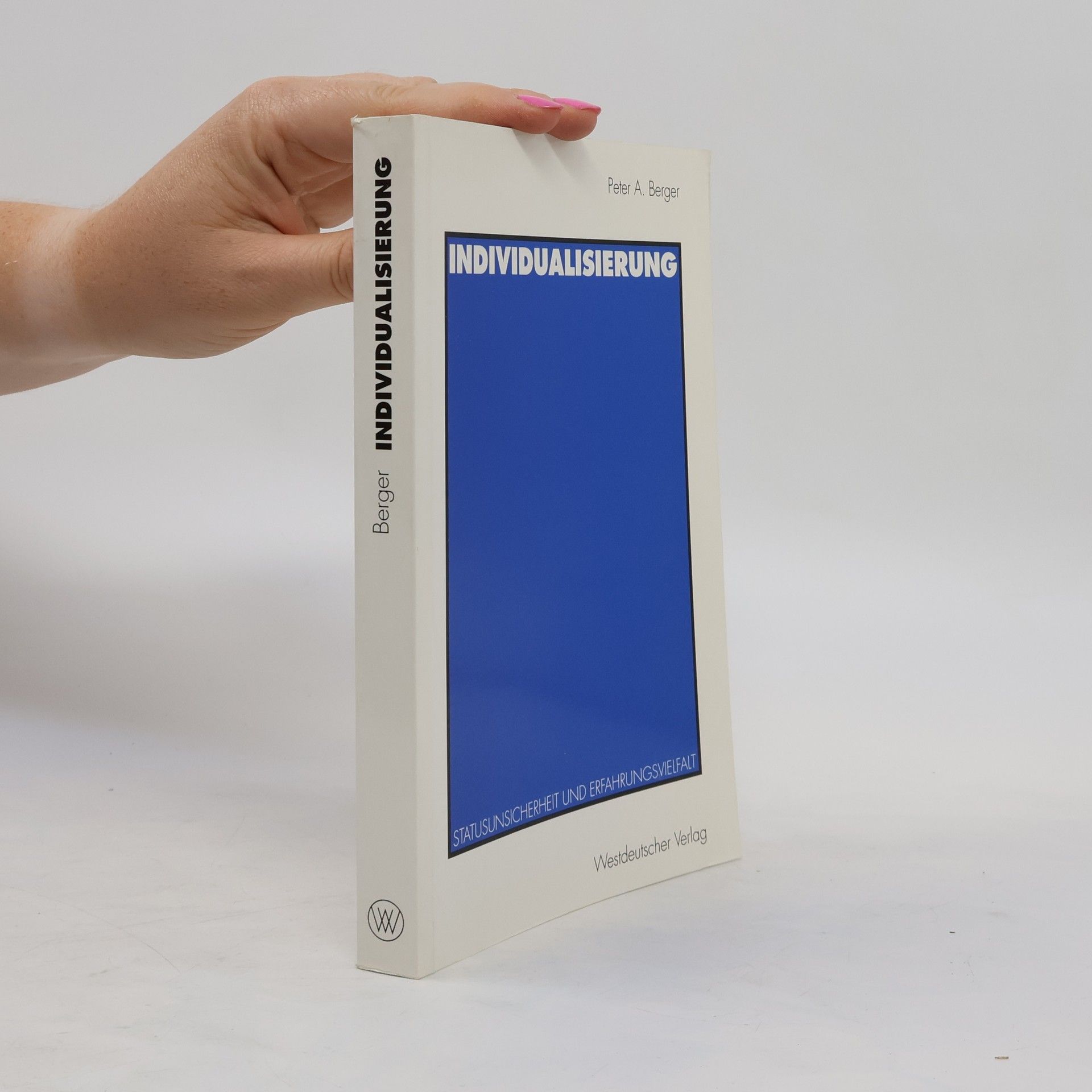Individualisierung
Statusunsicherheit und Erfahrungsvielfalt
Individualisierungsprozesse stehen seit Mitte der 80er Jahre im Mittelpunkt einer kontroversen Diskussion um sozialstrukturelle Wandlungen in (West-)Deutschland. Bedeutung und Reichweite solcher Prozesse des Herauslösens aus vertrauten Kontexten, die durch den Strukturbruch in Ostdeutschland noch verstärkt wurden, können jedoch mit statischen Sozialstrukturbeschreibungen nur unzureichend erfaßt werden. Angeregt durch die Lebenslauf- und Mobilitätsforschung plädiert diese Studie deshalb für eine konsequente "Verzeitlichung" sozialstruktureller Analysen. Zugleich präsentiert sie zahlreiche empirische Indizien für eine wachsende Vielfalt von Erwerbs- und Berufsbiographien bzw. für eine gestiegene "Beweglichkeit" von Individuen in sozialen Strukturen, die sowohl neuartige Statusunsicherheiten wie auch vielfältigere Sozialstrukturerfahrungen mit sich bringen können.