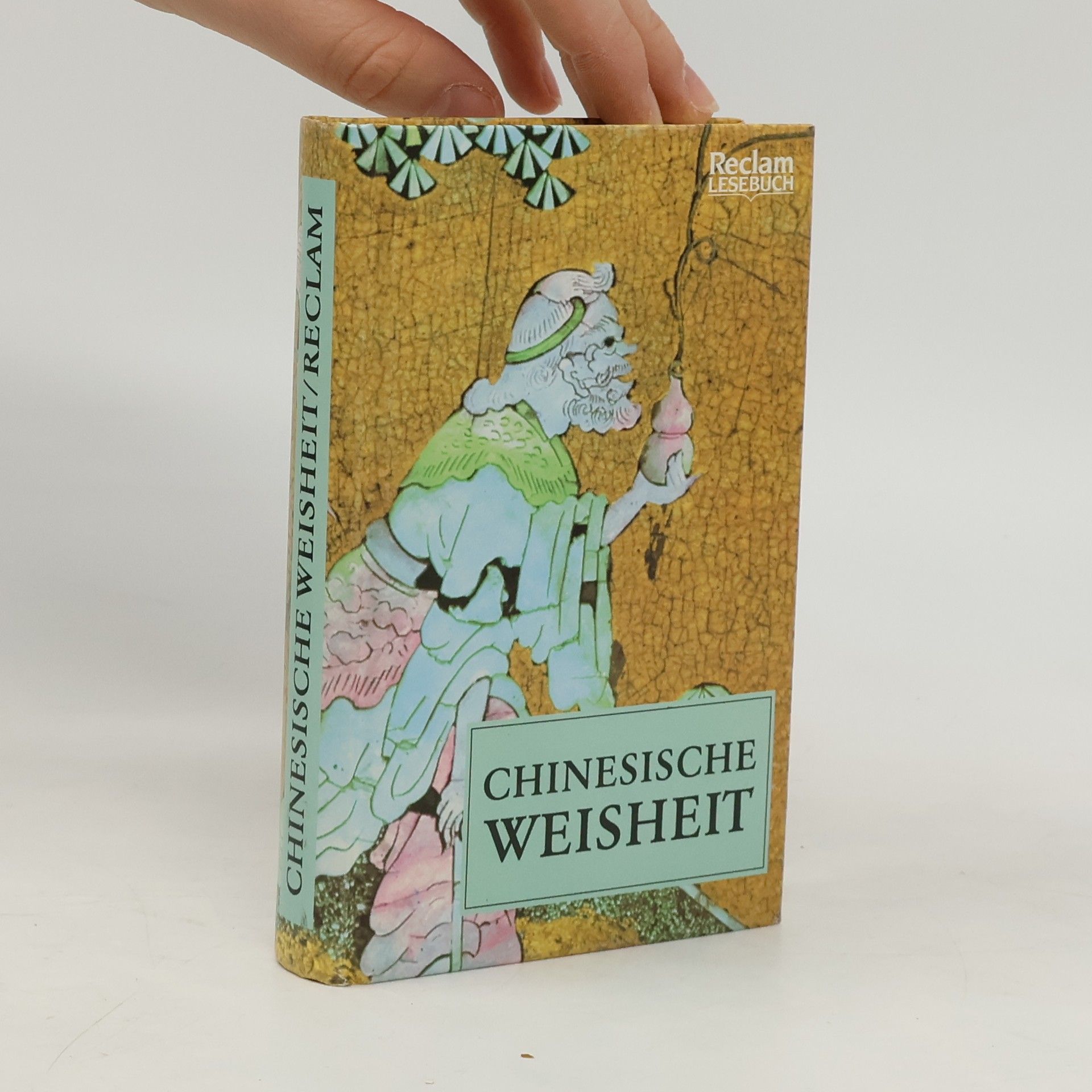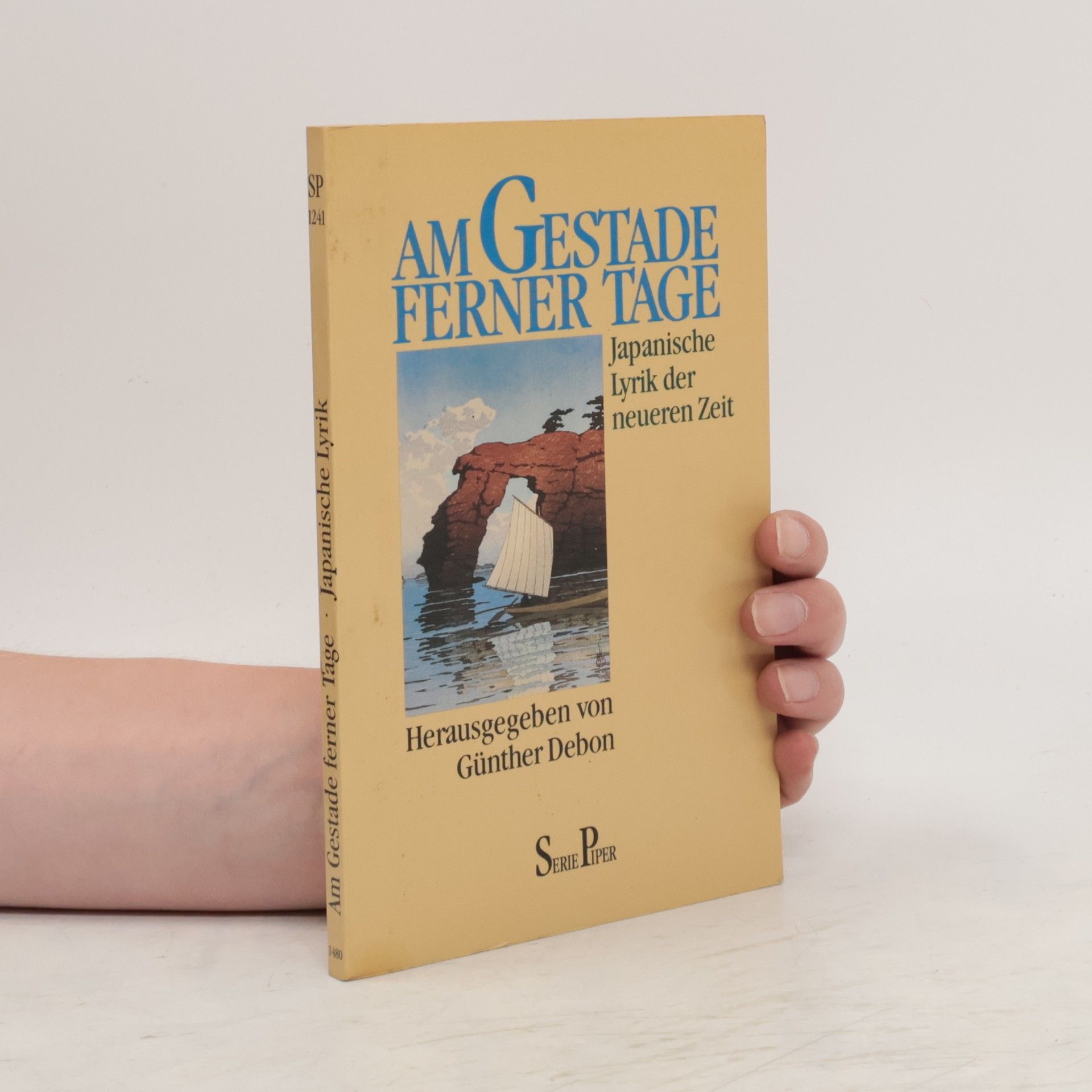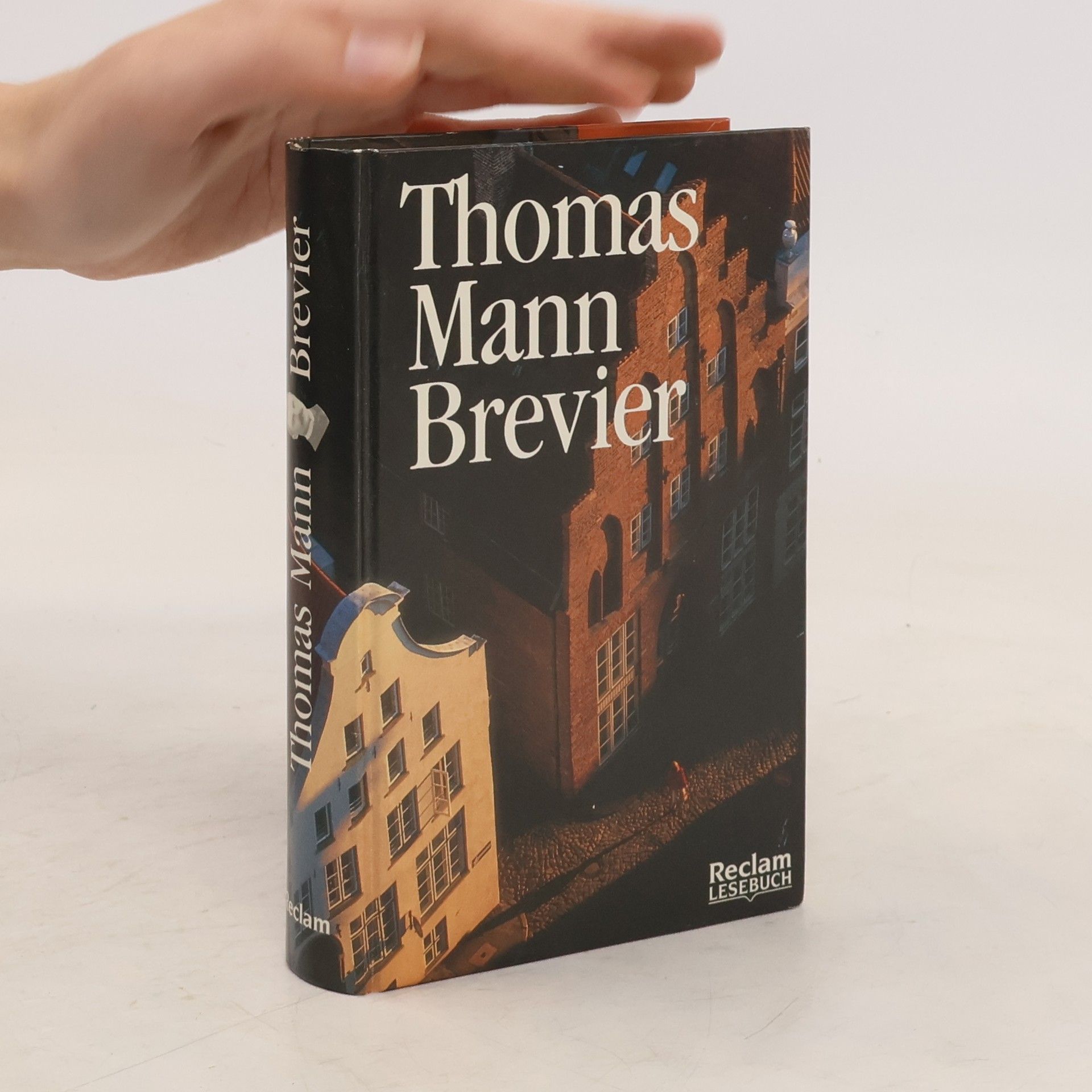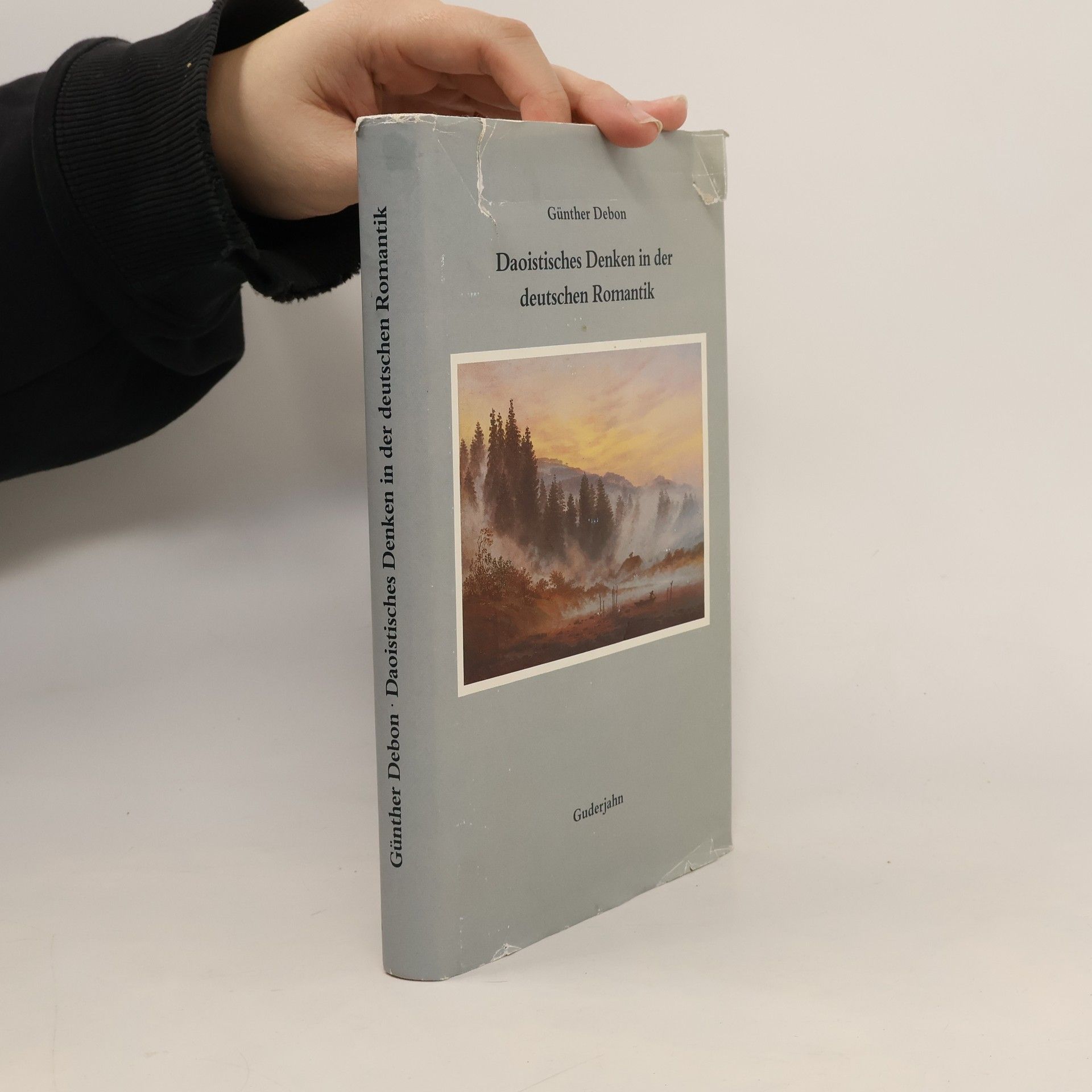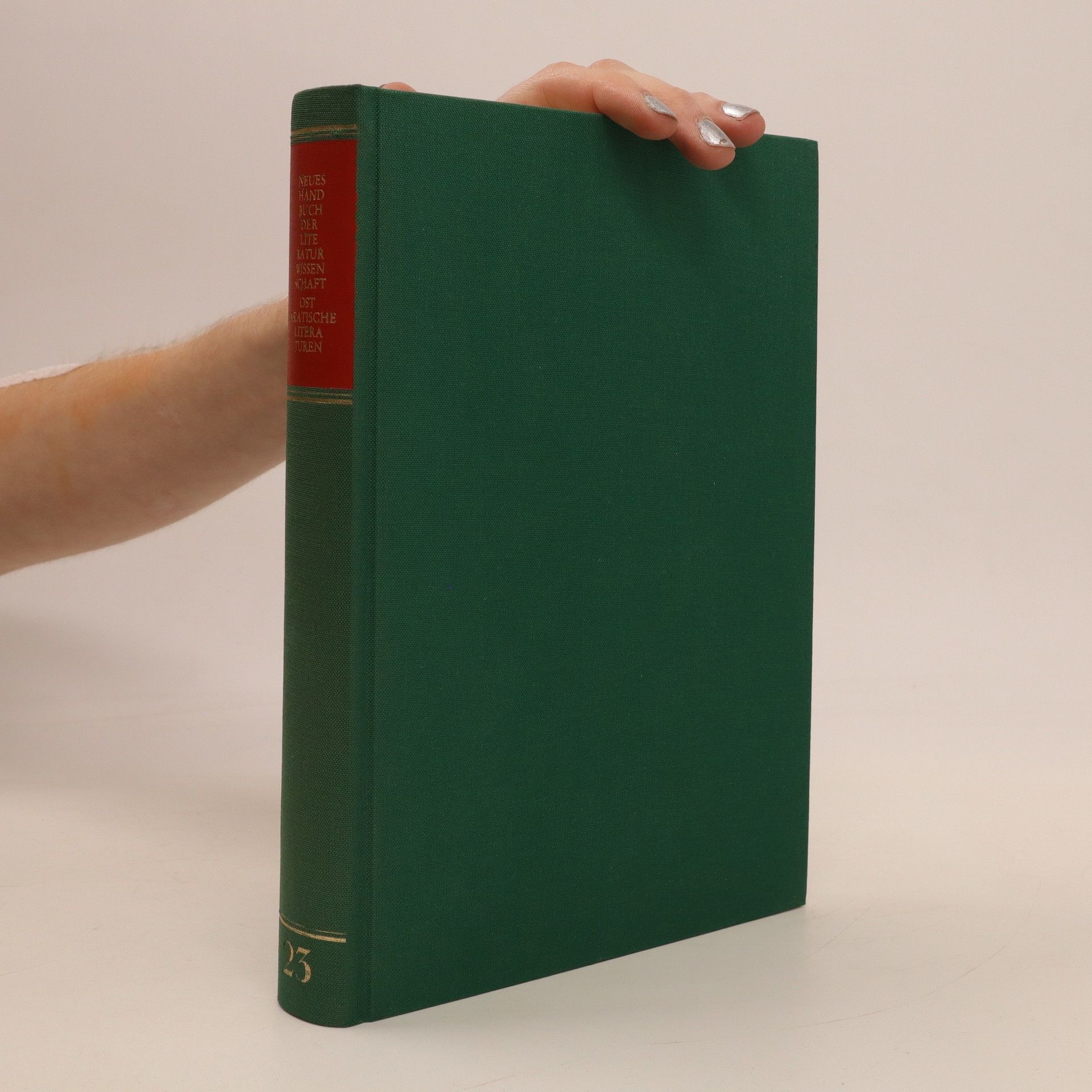Der Kranich ruft
Chinesische Lieder der ältesten Zeit
Mit dem ›Kanonischen Buch der Lieder‹ (Schih-ging) beginnt die dreitausendjährige Literatur Chinas, und mit ihr feiert auch die Weltliteratur eine Geburststunde: die des Reimes. Denn mit wenigen Ausnahmen sind die 305 Lieder des Shih-ging, die dem 10. bis 6. Jahrhundert v. Chr. entstammen, gereimt. Die vorliegende Auswahl enthält aus allen vier Gruppen - den volkstümlichen Liedern »nach Landesart« (Guo-fong), den Kleinen und Großen Festgesängen (Siao-ya und Da-ya) sowie den Hymnen (Sung) - Gedichte, dia auch dem deutschen Leser ohne größeren Kommentar und historisch-geographische Vorkenntnisse verständlich sind. 70 der Übersetzungen von Günther Debon erscheinen hier zum ersten Mal.