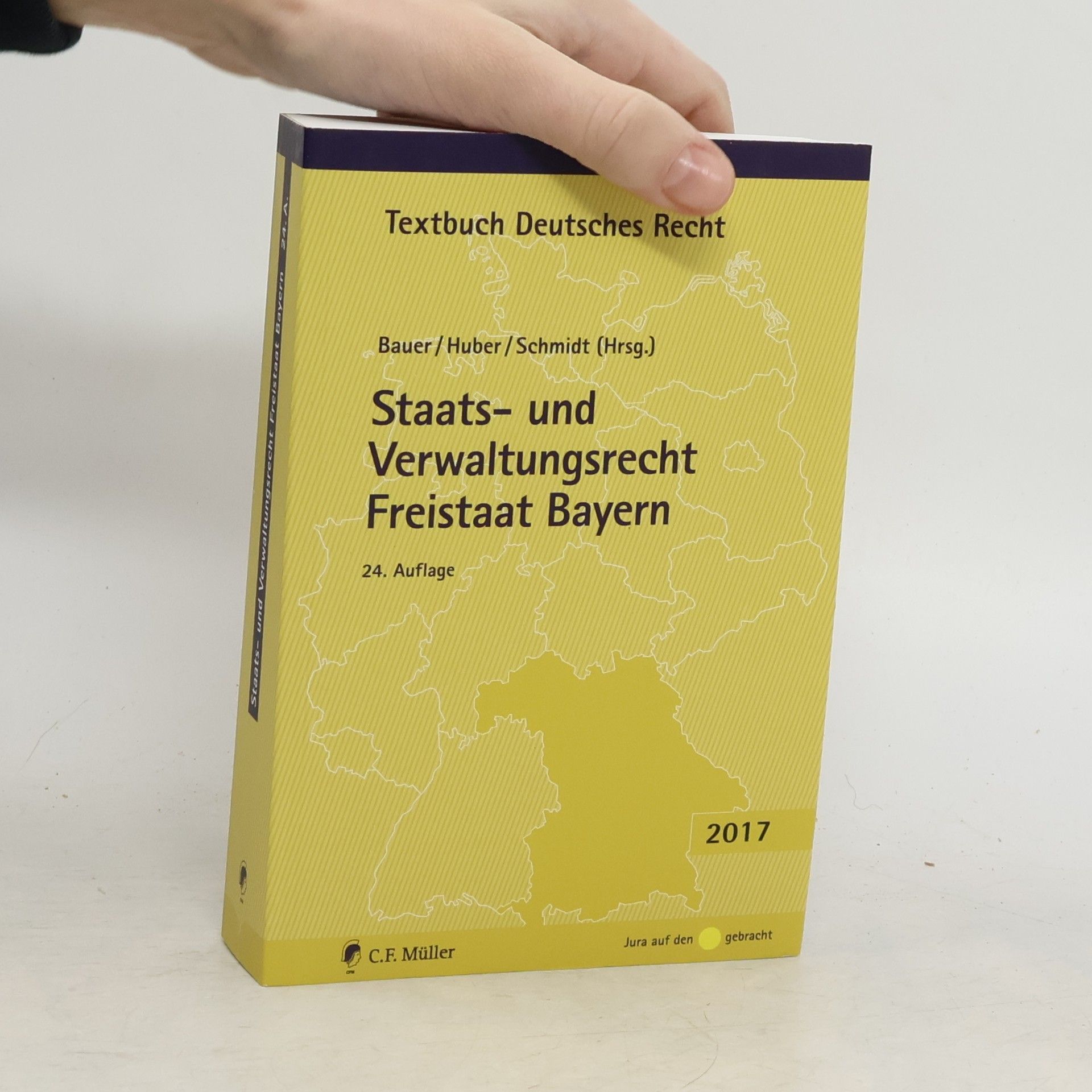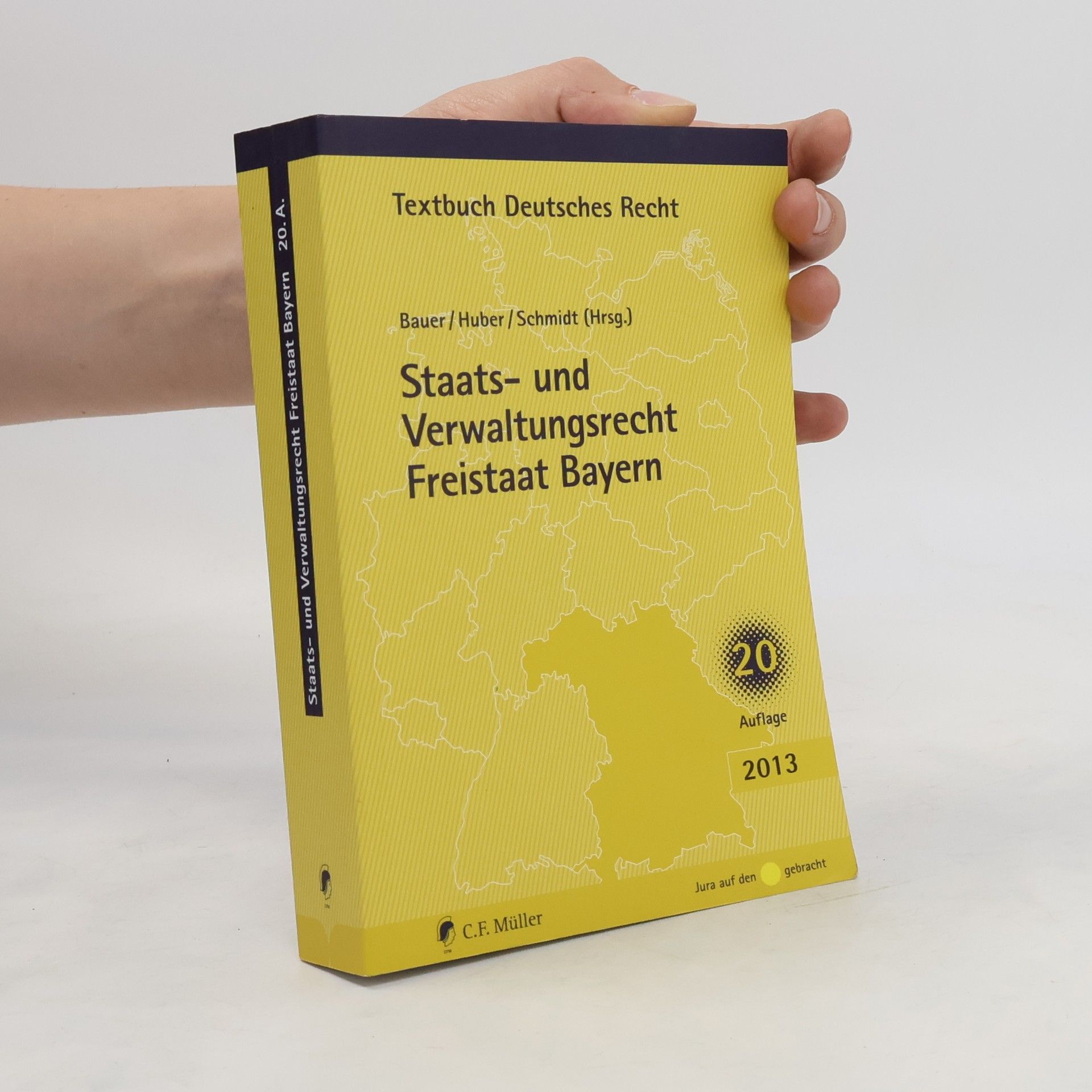Landesrecht Brandenburg. Studienbuch
- 344 Seiten
- 13 Lesestunden
Das Studienbuch bietet Lernenden, Lehrenden und Praktikern ubersichtliche systematische Einfuhrungen zu wichtigen landesrechtlichen Regelungsmaterien, die so an keiner anderen Stelle zu finden sind. Es deckt ausbildungs- und praxisrelevante Kerngebiete des brandenburgischen Rechts (Verfassungsrecht, Verwaltungsorganisationsrecht, Kommunalrecht, Polizei- und Ordnungsrecht sowie Bauordnungsrecht) ab und empfiehlt sich zur Vorbereitung auf das erste wie auf das zweite juristische Examen. Zahlreiche Beispiele vereinfachen das Verstandnis, und Klausurhinweise scharfen den Blick fur fehlertrachtige Fallgestaltungen.